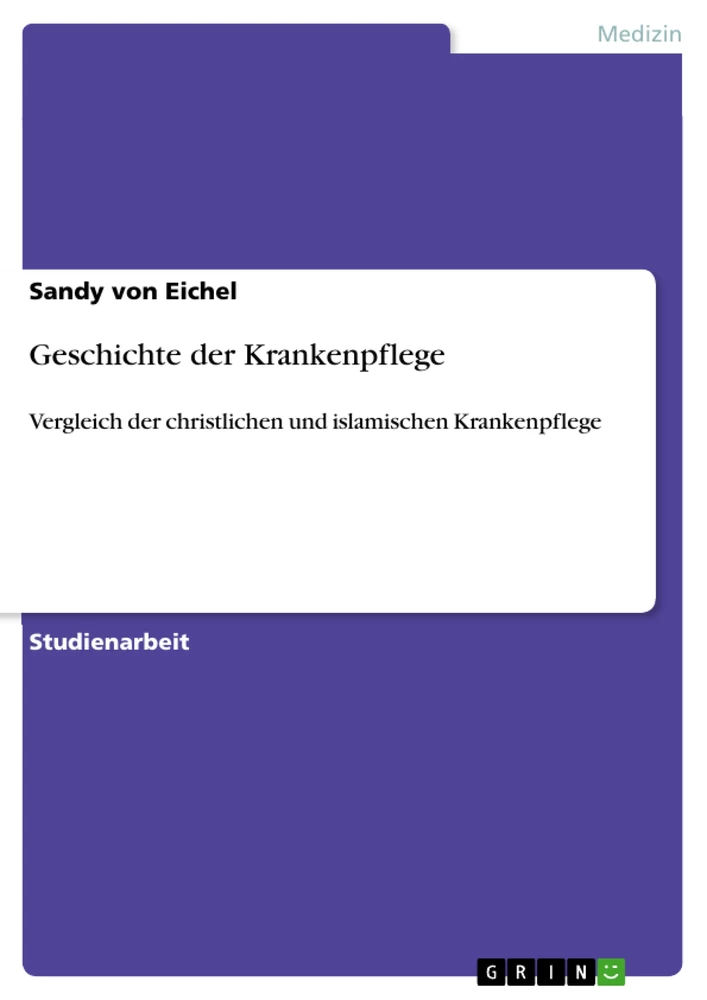Gegenstand dieser Arbeit ist es, das Wirken und die Bedeutung der Pflegenden im beginnenden
abendländischen Mittelalter mit denen des frühen arabisch-islamischen Kulturkreises
unter dem Einfluss der beiden Religionen zu vergleichen. Ist es möglich in dieser
Epoche eine einheitliche Definition für Pflege bzw. Pflegende zu erkennen? Lassen sich
anhand der Quellen Rückschlüsse auf die Existenz eines organisierten Berufsstandes der
Pflege ziehen?
Um einen Einblick in die Pflege dieser Epoche zu erhalten, widmet sich daher Kapitel 3
der Definition des grundsätzlichen Begriffes der Pflege.
In den folgenden Kapiteln wird dann unter Berücksichtigung der religiösen Einflüsse, der
Aufbau und die Organisation der Krankenhäuser, die medizinische Entwicklung und das
pflegerische Wirken im Bezug zur Fragestellung beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Methodisches Vorgehen
- 2. Kurze Erläuterung der Begrifflichkeiten Christentum und Islam
- 2.1 Begriff Christentum und das daraus resultierende Menschenbild
- 2.2 Begriff Islam und das daraus resultierende Menschenbild
- 3. Begriff der Pflege im Mittelalter
- 4. Krankenhäuser im Christentum und im Islam
- 4.1 Krankenhäuser im abendländischen Mittelalter
- 4.2 Krankenhäuser im arabisch-islamischen Kulturkreis
- 5. Einfluss der Religionen auf die medizinischen Entwicklungen
- 5.1 Einfluss der christlichen Lehre auf die medizinische Entwicklung
- 5.2 Einfluss der islamischen Lehre auf die medizinische Entwicklung
- 6. Pflege im christlichen Mittelalter und im frühen Islam
- 6.1 Pflege im christlichen Mittelalter
- 6.2 Pflege im frühen Islam
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Pflege im beginnenden abendländischen Mittelalter und im frühen arabisch-islamischen Kulturkreis unter dem Einfluss der jeweiligen Religionen. Sie zielt darauf ab, Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Verständnis und der Ausübung von Pflege in diesen beiden Kontexten zu beleuchten und die Frage nach einer einheitlichen Definition von Pflege in dieser Epoche zu diskutieren. Weiterhin wird die Frage nach der Existenz eines organisierten Berufsstandes der Pflege untersucht.
- Begriff und Verständnis von Pflege im Mittelalter
- Einfluss des Christentums und des Islams auf das Menschenbild und die Pflege
- Organisation und Aufbau von Krankenhäusern im christlichen und islamischen Kontext
- Medizinische Entwicklungen und deren Zusammenhang mit religiösen Einflüssen
- Vergleich der pflegerischen Praxis im abendländischen und arabisch-islamischen Mittelalter
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung erläutert die Schwierigkeit, das Wirken der Pflege im Mittelalter umfassend zu betrachten und grenzt den Fokus der Arbeit auf einen Teilaspekt ein. Sie thematisiert die Problematik der zeitlichen Abgrenzung des Mittelalters und betont den starken Einfluss des Christentums im Abendland und des Islams im arabischen Raum auf diese Epoche. Die Arbeit formuliert die zentrale Forschungsfrage nach der Möglichkeit einer einheitlichen Definition von Pflege im Mittelalter und der Existenz eines organisierten Berufsstandes.
2. Kurze Erläuterung der Begrifflichkeiten Christentum und Islam: Dieses Kapitel bietet einen knappen Überblick über das Christentum und den Islam, einschließlich ihrer jeweiligen Menschenbilder. Es beschreibt die zentralen Glaubensgrundlagen, die Heiligen Schriften und die kultischen Praktiken beider Religionen, um den religiösen Kontext der folgenden Kapitel zu beleuchten. Der Einfluss des alttestamentarischen Judentums auf das Christentum und die Rolle Mohammeds im Islam werden hervorgehoben.
3. Begriff der Pflege im Mittelalter: Dieses Kapitel befasst sich mit der Schwierigkeit, den Begriff "Pflege" im Mittelalter präzise zu definieren, aufgrund des Mangels an einheitlichen Definitionen selbst in der heutigen Zeit. Stattdessen fokussiert es sich auf das Verständnis und die Motivation von Pflegenden und betont den Einfluss von Faktoren wie Bildung, Kultur und vor allem Religion auf das Menschenbild und somit auf die Ausübung der Pflege. Der starke Einfluss der Religion im Mittelalter auf die Vorstellung vom Menschen und seiner Beziehung zu Gott und der Gesellschaft wird besonders herausgestellt.
4. Krankenhäuser im Christentum und im Islam: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung und Organisation von Krankenhäusern im abendländischen und arabisch-islamischen Mittelalter. Im abendländischen Mittelalter werden die verschiedenen Hospitaltypen innerhalb von Klöstern (Hospitale pauperum, Domus hospitus, Infirmarium, Leprosium) und in Städten (z.B. Hotel-Dieu in Paris) beschrieben. Der Text erläutert deren Aufbau und die darin vorgesehenen Rollen von Ärzten und Hilfskräften.
Schlüsselwörter
Pflege im Mittelalter, Christentum, Islam, Krankenhäuser, Medizin, Menschenbild, religiöser Einfluss, Vergleich, Berufsstand, abendländisches Mittelalter, arabisch-islamischer Kulturkreis.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Pflege im Mittelalter - Ein Vergleich zwischen christlichem Abendland und arabisch-islamischem Kulturkreis
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Pflege im beginnenden abendländischen Mittelalter und im frühen arabisch-islamischen Kulturkreis unter dem Einfluss der jeweiligen Religionen. Sie beleuchtet Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Verständnis und der Ausübung von Pflege und diskutiert die Frage nach einer einheitlichen Definition von Pflege in dieser Epoche sowie die Existenz eines organisierten Berufsstandes der Pflege.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Begriff und Verständnis von Pflege im Mittelalter; Einfluss des Christentums und des Islams auf das Menschenbild und die Pflege; Organisation und Aufbau von Krankenhäusern im christlichen und islamischen Kontext; Medizinische Entwicklungen und deren Zusammenhang mit religiösen Einflüssen; Vergleich der pflegerischen Praxis im abendländischen und arabisch-islamischen Mittelalter.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung (mit methodischem Vorgehen), eine kurze Erläuterung der Begrifflichkeiten Christentum und Islam (inkl. Menschenbilder), den Begriff der Pflege im Mittelalter, Krankenhäuser im Christentum und Islam (abendländisch und arabisch-islamisch), den Einfluss der Religionen auf medizinische Entwicklungen, Pflege im christlichen Mittelalter und frühen Islam und schließlich ein Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detaillierter beschrieben.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Einleitung beschreibt das methodische Vorgehen, jedoch sind die konkreten Methoden in der gegebenen Vorschau nicht detailliert aufgeführt. Der Fokus liegt auf dem Vergleich und der Analyse von Quellenmaterial zum Thema Pflege im Mittelalter in den beiden untersuchten Kulturkreisen.
Wie werden Christentum und Islam in der Arbeit betrachtet?
Kapitel 2 bietet einen knappen Überblick über das Christentum und den Islam, einschließlich ihrer jeweiligen Menschenbilder. Es werden zentrale Glaubensgrundlagen, Heilige Schriften und kultische Praktiken beider Religionen beschrieben, um den religiösen Kontext der folgenden Kapitel zu beleuchten. Der Einfluss des alttestamentarischen Judentums auf das Christentum und die Rolle Mohammeds im Islam werden hervorgehoben.
Wie wird der Begriff "Pflege" im Mittelalter definiert?
Kapitel 3 thematisiert die Schwierigkeit, den Begriff "Pflege" im Mittelalter präzise zu definieren. Es konzentriert sich auf das Verständnis und die Motivation von Pflegenden und betont den Einfluss von Faktoren wie Bildung, Kultur und Religion auf das Menschenbild und die Ausübung der Pflege. Der starke religiöse Einfluss auf die Vorstellung vom Menschen wird besonders herausgestellt.
Welche Rolle spielten Krankenhäuser im Mittelalter?
Kapitel 4 beschreibt die Entwicklung und Organisation von Krankenhäusern im abendländischen und arabisch-islamischen Mittelalter. Im abendländischen Mittelalter werden verschiedene Hospitaltypen (Hospitale pauperum, Domus hospitus, Infirmarium, Leprosium) und deren Aufbau sowie die Rollen von Ärzten und Hilfskräften beschrieben. Der Vergleich mit Krankenhäusern im arabisch-islamischen Kulturkreis wird ebenfalls durchgeführt.
Wie beeinflussten die Religionen die medizinischen Entwicklungen?
Kapitel 5 untersucht den Einfluss der christlichen und islamischen Lehre auf die medizinische Entwicklung in den jeweiligen Kulturkreisen. Die genaue Art und Weise dieser Einflüsse wird in der Vorschau nicht im Detail erläutert, jedoch wird der Zusammenhang zwischen religiösen Überzeugungen und medizinischem Fortschritt thematisiert.
Wie lässt sich die pflegerische Praxis im Abendland und im arabisch-islamischen Raum vergleichen?
Die Arbeit vergleicht die pflegerische Praxis im abendländischen und arabisch-islamischen Mittelalter. Die Ergebnisse dieses Vergleichs sind in der gegebenen Vorschau nicht explizit genannt, aber die Fragestellung nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden ist ein zentraler Bestandteil der Arbeit.
Gibt es ein Fazit und welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Arbeit endet mit einem Fazit (Kapitel 7). Relevante Schlüsselwörter sind: Pflege im Mittelalter, Christentum, Islam, Krankenhäuser, Medizin, Menschenbild, religiöser Einfluss, Vergleich, Berufsstand, abendländisches Mittelalter, arabisch-islamischer Kulturkreis.
- Quote paper
- Sandy von Eichel (Author), 2011, Geschichte der Krankenpflege, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177234