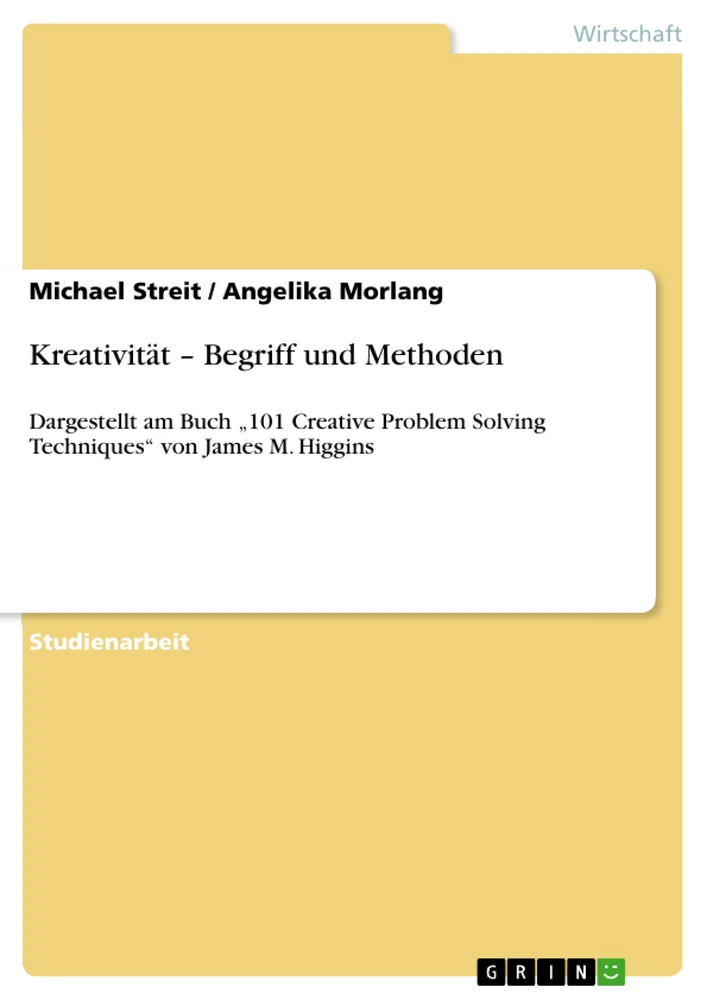In der Einleitung des Buches spricht der Autor von vielen Veränderungen, die sich in den letzten Jahren in der Wirtschaft und der Gesellschaft ereignet haben und nach wie vor geschehen. Zu diesen Veränderungen zählt er neben dem drastischen Anstieg und Stärke der Wettbewerber und verkürztes Time-to-market neuer Technologien auch die instabilen Marktbedingungen und das Verhalten der Unternehmer gegenüber der globalen Erwärmung. Alle diese Ereignisse basieren darauf, dass das gesamte wirtschaftliche Umfeld immer komplexer wird und Veränderungen sich in einer immer schneller werdenden Geschwindigkeit ereignen.
Wenn man von der Vielzahl der Veränderungen liest, so würde in jedem Leser zunächst die Meinung aufkommen, dass der Autor von erstzunehmenden Problemen spricht. Ein Problem ist bekanntlich eine Aufgabe, deren Lösung mit Schwierigkeiten verbunden ist und für die befriedigende Zielsituation ein Hindernis ist.
Doch der Autor sieht die Veränderungen nicht als ein Problem, sondern als eine Herausforderung. Higgins sieht sie nämlich nicht von ihrer negativen Seite als Tatsache eines bestehenden Problems, sondern von ihrer positiven Seite als außergewöhnliche Aufgaben, deren Lösung ein angenehmes Gefühl wie Eifer, Aufregung und Hochstimmung auslöst. Denn wenn eine Aufgabe als Herausforderung angesehen wird, kann durch diese auch eine befriedigende Zielsituation erreicht werden. Ein Unternehmen, das das verstanden hat, wird auch in der Lage sein, den stetigen Veränderungen zu begegnen und Probleme aufs Neue lösen zu können.
Den genannten Herausforderungen begegnen viele Unternehmen, indem sie die Gelegenheit der kreativen Problemlösung und Innovation verstärkt ergreifen. Der Schlüssel für die effiziente Nutzung der Kreativität, liegt nach Higgins in der methodischen Erlernung von Kreativitätstechniken.
Der Autor hat sich der kreativen Problemlösung angenommen und ein umfassendes Werk über verschiedene Techniken des Problemlösungsprozesses geschrieben. Dieses Buch beschreibt neben den Grundlagen des kreativen Problemlösungsmodells 101 Techniken für die Entfaltung von individueller und gruppenbezogener Kreativität, wobei das eigentliche Lösen des Problems bzw. Generierung von Alternativen zur Problemlösung im Vordergrund steht. Damit können nicht nur Führungskräfte und Manager, sondern auch Mitarbeiter ihren Arbeitserfolg und die Gruppenleistung verbessern.
Inhaltsverzeichnis
1. Problemstellung
2. Kreativität und Innovation
2.1 Einführung – „Innovate or evaporate“
2.2 Kreativitätsbegriff
2.3 Rahmenbedingungen und Barrieren für Kreativität
2.4 Ist Kreativität erlernbar?
2.5 Erweiterung des Kreativitätsbegriffs zum Innovationsbegriff
2.6 Innovationsgleichung
2.7 Kreativität, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit
3. Der kreative Problemlösungsprozess
3.1 Kreatives Problemlösen
3.2 Divergentes und konvergentes Denken
3.3 Aufnahme der Kreativität in den Problemlösungsprozess
4. Kreative Problemlösungstechniken
4.1 Umweltanalyse
4.2 Problemerkennung
4.3 Problemidentifikation / -bestimmung
4.4 Festlegung von Annahmen
4.5 Generierung von Alternativen / Problemlösungen (Einzelpersonen)
4.6 Generierung von Alternativen / Problemlösungen (Gruppen)
4.7 Bewertung und Auswahl von Alternativen
4.8 Implementierung
4.9 Kontrolle
5. Anwendung der Techniken
6. Kritische Würdigung
Literaturverzeichnis
-
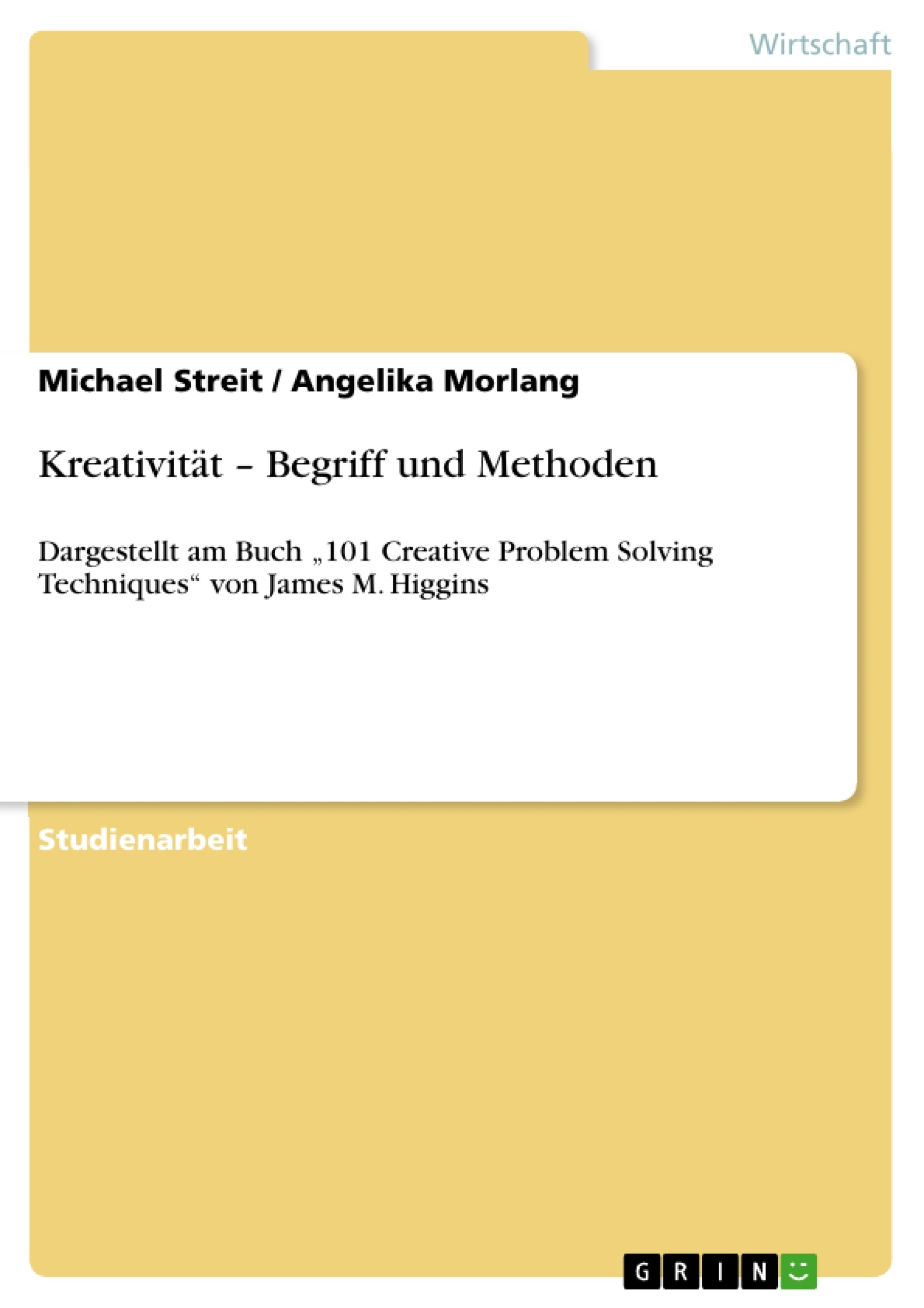
-

-

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X.