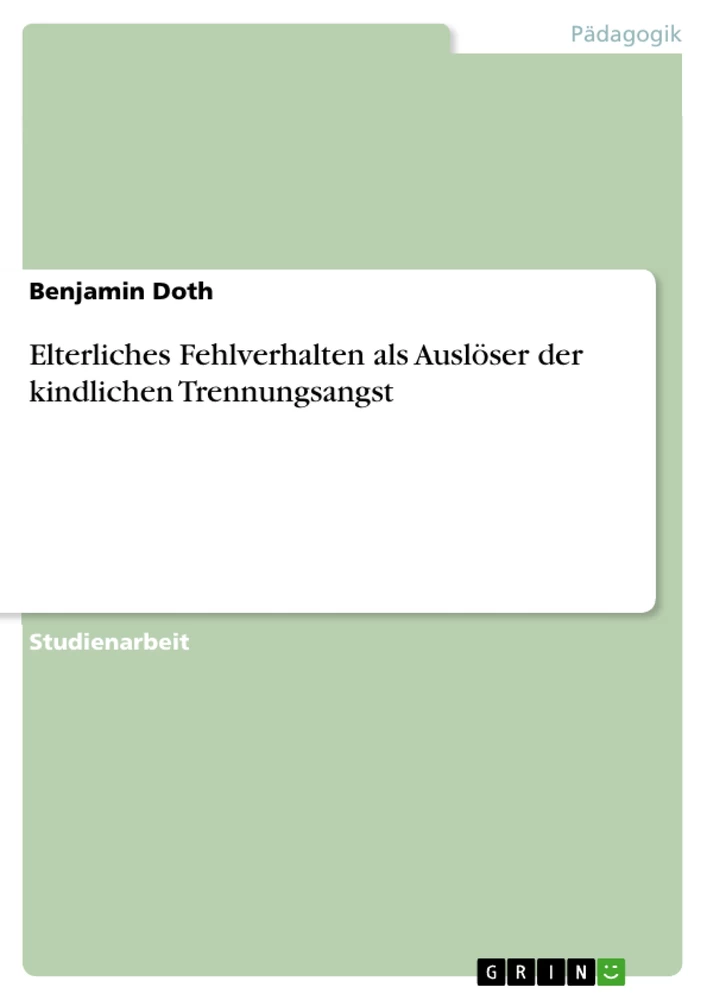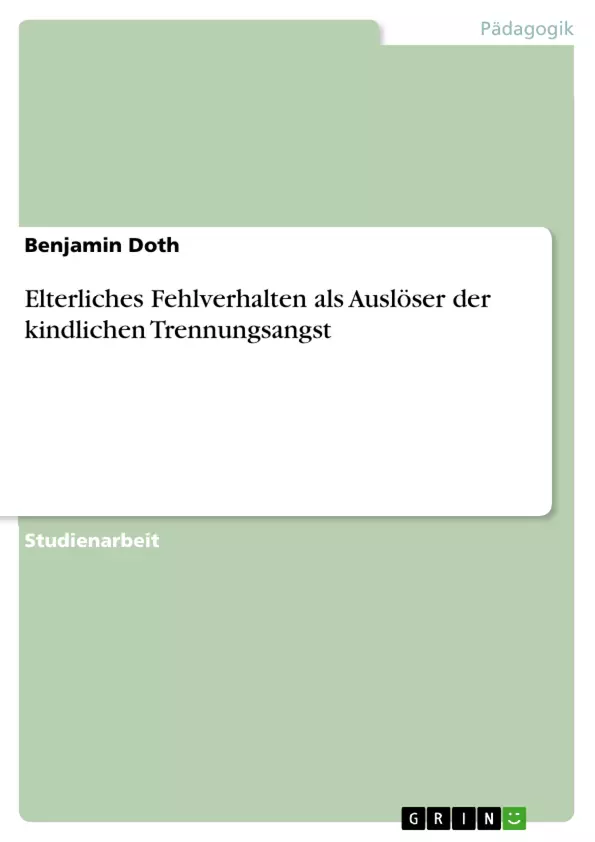„“Weil sie manchmal Sachen sagen, wozu sie imstande wären...uns zum Beispiel ins Internat zu schicken“ (Junge, 11 Jahre)“
In dieser Aussage eines 11-jährigen Jungen findet sich eine mögliche Ursache für die Trennungsangst. Betrachtet man den Satz genau, so könnte man folgende Aussage machen: Das Kind versteht sich als Objekt, das dem Handeln der Eltern schutzlos ausgeliefert ist. In diesem Fall bezieht sich das Handeln der Eltern auf die Androhung, die Kinder ins Internat zu schicken. Aus welcher Motivation heraus die Eltern diese Androhung aussprechen, sei für den Moment dahingestellt. Das Kind jedoch macht die Erfahrung, dass es jederzeit von seinen Eltern getrennt werden könnte. Eine mögliche Trennung wird also gezielt eingesetzt, um bei dem Kind eine Angst hervorzurufen. Die Angst, dass es bei unpassendem Verhalten von zu Hause weg muss.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, sich unter Einbeziehung der Autoren Federer Petermann und Zlotovicz mit den Entstehungsprozessen der Trennungsangst auseinanderzusetzen. Im Anschluss hieran sollen ursachenbezogene Interventionsmöglichkeiten aufgezeigt und kritisch überprüft werden. Der Verfasser dieser Arbeit stellt zudem folgende These auf:
„Die maßgebliche Ursache für die Entstehung der kindlichen Trennungsangst sind in erster Linie nicht Trennungserfahrungen, sondern Aussagen von nahestehenden Personen die eine Trennungsangst entweder forcieren oder ungewollt hervorrufen“.
Im Anschluss an diese Arbeit sollen in einem abschließenden Fazit die vorgeschlagenen Interventionsmöglichkeiten auf ihre Anwendbarkeit sowie die vom Verfasser dieser Arbeit aufgestellte These auf ihre Haltbarkeit hin überprüft werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Diagnosekriterien nach Petermann
- 2.1 Definition der Trennungsangst
- 2.2 Diagnosekriterien nach DSM-III-R
- 3. Auseinandersetzung mit den Entstehungsprozessen der Trennungsangst
- 3.1 Ätiologiemodell nach Federer
- 3.2 Ätiologiemodell nach Petermann: Lernprozesse als Ursache sozialer Angst
- 3.3 Ätiologiemodell nach Zlotovicz: Elterliches Verhalten als Ursache kindlicher Trennungsangst
- 4. Therapie- und Interventionsmöglichkeiten
- 4.1 Kompakte Trainings nach Petermann
- 4.1.1 Einzelsitzungen nach Petermann
- 4.1.2 Gruppensitzungen nach Petermann
- 4.1.3 Mitarbeit der Eltern
- 5. Fazit
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehungsprozesse kindlicher Trennungsangst unter Einbeziehung verschiedener Ätiologiemodelle. Das Hauptziel ist es, die Rolle elterlichen Verhaltens als Auslöser zu beleuchten und daraus resultierende Interventionsmöglichkeiten aufzuzeigen und kritisch zu bewerten. Die These der Arbeit lautet, dass nicht Trennungserfahrungen selbst, sondern Äußerungen nahestehender Personen die Trennungsangst maßgeblich beeinflussen.
- Definition und Diagnosekriterien der Trennungsangst
- Analyse verschiedener Ätiologiemodelle (Federer, Petermann, Zlotovicz)
- Bewertung des Einflusses elterlichen Verhaltens auf die Entstehung von Trennungsangst
- Ursachenbezogene Interventions- und Therapieansätze
- Kritische Überprüfung der aufgestellten These und der Anwendbarkeit der Interventionsmöglichkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung präsentiert einen Fallbeispiel eines elfjährigen Jungen, dessen Äußerung über die mögliche Internatsunterbringung als Metapher für die Auslöser von Trennungsangst dient. Sie führt die These ein, dass nicht Trennungserfahrungen an sich, sondern Äußerungen nahestehender Personen die Trennungsangst maßgeblich beeinflussen. Die Arbeit kündigt die Auseinandersetzung mit den Entstehungsprozessen der Trennungsangst anhand der Modelle von Federer, Petermann und Zlotovicz an, sowie die Vorstellung und kritische Überprüfung ursachenbezogener Interventionsmöglichkeiten.
2. Diagnosekriterien nach Petermann: Dieses Kapitel definiert Trennungsangst als massive Angst vor Trennung von Bezugspersonen, andauernd über mindestens zwei Wochen. Es werden Kriterien des DSM-III-R vorgestellt, insbesondere die unrealistische Besorgnis über Schaden oder Trennung von Bezugspersonen sowie wiederkehrende Albträume über Trennung. Dies legt den diagnostischen Rahmen für das Verständnis der folgenden Kapitel fest.
3. Auseinandersetzung mit den Entstehungsprozessen der Trennungsangst: Dieses Kapitel präsentiert und analysiert drei verschiedene Ätiologiemodelle zur Entstehung von Trennungsangst. Es werden die Studien von Federer, Petermann und Zlotovicz vorgestellt. Federer untersucht Zusammenhänge zwischen Agoraphobie und Trennungsangst, während Petermann Lernprozesse und Zlotovicz elterliches Verhalten als Ursachen betont. Die kritische Auseinandersetzung mit diesen Modellen legt die Grundlage für die im folgenden Kapitel behandelten Interventionsmöglichkeiten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Entstehungsprozesse kindlicher Trennungsangst
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entstehungsprozesse kindlicher Trennungsangst. Im Fokus steht die Rolle des elterlichen Verhaltens als Auslöser und die daraus resultierenden Interventionsmöglichkeiten. Die zentrale These lautet, dass nicht die Trennungserfahrungen selbst, sondern die Äußerungen nahestehender Personen die Trennungsangst maßgeblich beeinflussen.
Welche Diagnosekriterien werden behandelt?
Die Arbeit verwendet die Diagnosekriterien nach Petermann und bezieht sich auf das DSM-III-R. Es wird Trennungsangst als massive Angst vor Trennung von Bezugspersonen definiert, die mindestens zwei Wochen andauert und mit unrealistischen Besorgnissen und wiederkehrenden Albträumen über Trennung einhergeht.
Welche Ätiologiemodelle werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Ätiologiemodelle von Federer, Petermann und Zlotovicz. Federer untersucht den Zusammenhang zwischen Agoraphobie und Trennungsangst, Petermann betont Lernprozesse, und Zlotovicz fokussiert auf elterliches Verhalten als Ursache.
Welche Interventions- und Therapieansätze werden vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt die kompakten Trainings nach Petermann, darunter Einzelsitzungen, Gruppensitzungen und die Mitarbeit der Eltern. Diese Ansätze werden im Kontext der analysierten Ätiologiemodelle kritisch bewertet und auf ihre Anwendbarkeit geprüft.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung mit einem Fallbeispiel, ein Kapitel zu den Diagnosekriterien, ein Kapitel zur Analyse der Ätiologiemodelle, ein Kapitel zu den Interventionsmöglichkeiten, ein Fazit und ein Literaturverzeichnis. Ein Inhaltsverzeichnis bietet eine detaillierte Übersicht.
Welche Rolle spielt elterliches Verhalten laut dieser Arbeit?
Laut der Arbeit spielt elterliches Verhalten eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Trennungsangst. Die These besagt, dass nicht die Trennungserfahrungen selbst, sondern die Äußerungen der Bezugspersonen die Angst maßgeblich beeinflussen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zur Wirksamkeit der vorgestellten Interventionsmöglichkeiten und prüft kritisch die aufgestellte These. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und bewertet die Anwendbarkeit der Therapieansätze.
- Arbeit zitieren
- Benjamin Doth (Autor:in), 2008, Elterliches Fehlverhalten als Auslöser der kindlichen Trennungsangst, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177290