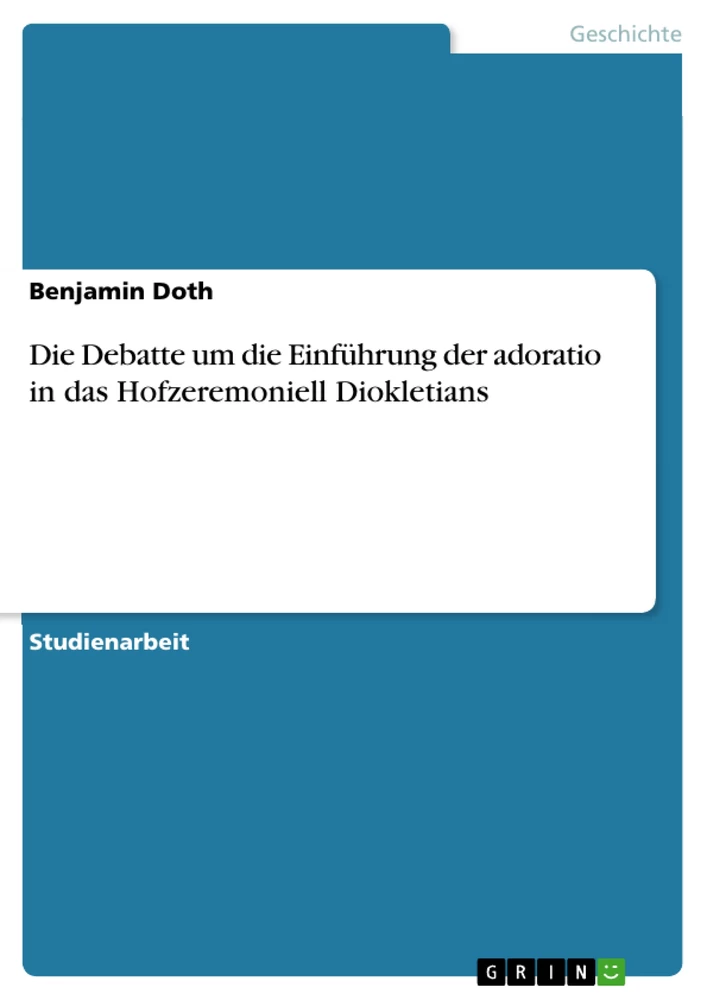„woraus ich, so weit meine Einsicht reicht, die Überzeugung schöpfe, dass immer die Niedrigsten, besonders wenn sie eine hohe Stufe der Macht erstiegen haben, in Stolz und Ehrfurcht alles Maß überschreiten.“
AURELIUS VICTOR, De Caesaribus, XXXIX, 5.
Das obige Zitat, dass uns von Aurelius Victor überliefert ist, bezieht sich auf die Regierungszeit Diokletians. Welches Ereignis könnte ihn zu dieser Aussage gebracht haben?
Gemäß Aurelius Victor – und anderen Zeitzeugen, auf die später noch eingegangen werden soll – war Diokletian der erste Kaiser „seit Caligula und Domitianus [...] der sich öffentlich „Herr“ nennen und wie eine Gottheit verehren und anreden ließ“.
Diesen Vorgang bezeichnet man als Proskynese. Für die Forschung gilt dieser Vorgang jedoch nicht als gesichert. Ein Teil der Forschung (namentlich A. Alföldi) sieht den Ursprung der Proskynese bereits früher. In „Die monarchische Repräsentation im römischen Kaiserreiche“ legt Andreas Alföldi Belege für seine These umfassend und schlüssig dar. Andere Vertreter der Forschung (namentlich H. Stern und W. T. Avery ) sehen in der Argumentation Alföldis jedoch Mängel; sie glauben diese durch entsprechende Gegenbeispiele entkräftet zu haben.
Diese Arbeit soll anhand ausgewählter Quellen versuchen die Argumentationsstruktur der oben genannten Forscher nachzuvollziehen und ggf. zu ergänzen.
Folgende These stellt der Verfasser dieser Arbeit außerdem auf:
„Diokletian war der erste Kaiser nach Caligula und Dominitian der die Proskynese offiziell (ein-)forderte (request ). Der Vorgang der Proskynese – auf freiwilliger Basis –
fand jedoch fand schon vor Diokletian statt. Insofern kann nicht gesagt werden, dass Diokletian der erste Kaiser war, der sich hat adorieren lassen“.
Am Schluss dieser Arbeit soll ein Fazit stehen, in dem die Haltbarkeit der hier augestellten These sowie der ausgewählten Forschungspositionen überprüft werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Quellenlage
- Diokletianische Beispiele
- Interpretation von De Caesaribus, 39, 4 – 5
- Interpretation von Res Gestae, 15. 5, 18
- Vordiokletianische Beispiele
- Interpretation von Histoire Romaine, 58. 11, 2
- Interpretation von Regnum post Marcum, 3. 11, 8
- Diokletianische Beispiele
- Darstellung der Position Andreas Alföldis
- Darstellung der Position H. Sterns
- Darstellung der Position W. T. Averys
- Schlussbemerkung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Debatte um die Einführung der Proskynese im Hofzeremoniell Diokletians. Sie analysiert die Quellenlage und setzt sich kritisch mit den Argumenten von Andreas Alföldi, H. Stern und W. T. Avery auseinander, die unterschiedliche Positionen zur Einführung der Proskynese vertreten.
- Die Frage nach der Einführung der Proskynese durch Diokletian
- Die Analyse der Quellenlage, insbesondere der Schriften von Aurelius Victor, Ammianus Marcellinus und Cassius Dio
- Die Gegenüberstellung der Argumentationen von Alföldi, Stern und Avery
- Die Rolle der Proskynese im Kontext der spätantiken Herrscherideologie
- Die Frage nach der Freiwilligkeit oder der offiziellen Einführung der Proskynese
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die These der Arbeit dar. Sie führt in die Thematik der Proskynese und deren Bedeutung im Kontext der römischen Geschichte ein.
- Quellenlage: Dieses Kapitel analysiert die wichtigsten Quellen zur Einführung der Proskynese. Es geht auf die Schriften von Aurelius Victor, Ammianus Marcellinus und Cassius Dio ein und interpretiert die relevanten Passagen im Kontext der jeweiligen Autoren und ihrer Zeit.
- Darstellung der Position Andreas Alföldis: Dieser Abschnitt stellt Alföldis Argumentation zur Einführung der Proskynese dar, die er in seinem Werk "Die monarchische Repräsentation im römischen Kaiserreiche" umfassend darlegte. Es werden seine zentralen Argumente und seine Interpretation der Quellen zusammengefasst.
- Darstellung der Position H. Sterns: Dieser Abschnitt beleuchtet die Position von H. Stern, der Alföldis Argumentation kritisch hinterfragt und mit Gegenargumenten konfrontiert. Es werden die wichtigsten Punkte seiner Kritik und seine Interpretation der Quellen dargestellt.
- Darstellung der Position W. T. Averys: Dieser Abschnitt analysiert Averys Position zur Einführung der Proskynese. Es wird seine Argumentation, seine Kritik an Alföldis Position und seine eigene Interpretation der Quellen dargestellt.
Schlüsselwörter
Proskynese, Diokletian, Hofzeremoniell, Herrscherideologie, Spätantike, Quellenkritik, Andreas Alföldi, H. Stern, W. T. Avery, Aurelius Victor, Ammianus Marcellinus, Cassius Dio, Salutatio, Adoratio.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „Proskynese“ oder „Adoratio“?
Es handelt sich um ein rituelles Grußzeremoniell, bei dem man sich vor dem Herrscher niederwirft oder ihn wie eine Gottheit verehrt.
War Diokletian der erste Kaiser, der die Proskynese einführte?
Die Forschung ist uneins. Diokletian forderte sie offiziell ein, jedoch gab es laut einigen Forschern (wie Alföldi) bereits vordiokletianische Beispiele auf freiwilliger Basis.
Welche Quellen berichten über Diokletians Hofzeremoniell?
Wichtige Quellen sind Aurelius Victor (De Caesaribus), Ammianus Marcellinus (Res Gestae) und Cassius Dio.
Welche Position vertritt Andreas Alföldi?
Alföldi sieht den Ursprung der monarchischen Repräsentation und der Proskynese bereits vor Diokletian und belegt dies umfassend in seinen Werken.
Wie wird Diokletian von Aurelius Victor charakterisiert?
Victor kritisiert Diokletian dafür, dass er sich als erster Kaiser seit Domitian öffentlich „Herr“ nennen und göttlich verehren ließ, was er als Stolz jenseits allen Maßes ansah.
- Quote paper
- Benjamin Doth (Author), 2008, Die Debatte um die Einführung der adoratio in das Hofzeremoniell Diokletians, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177292