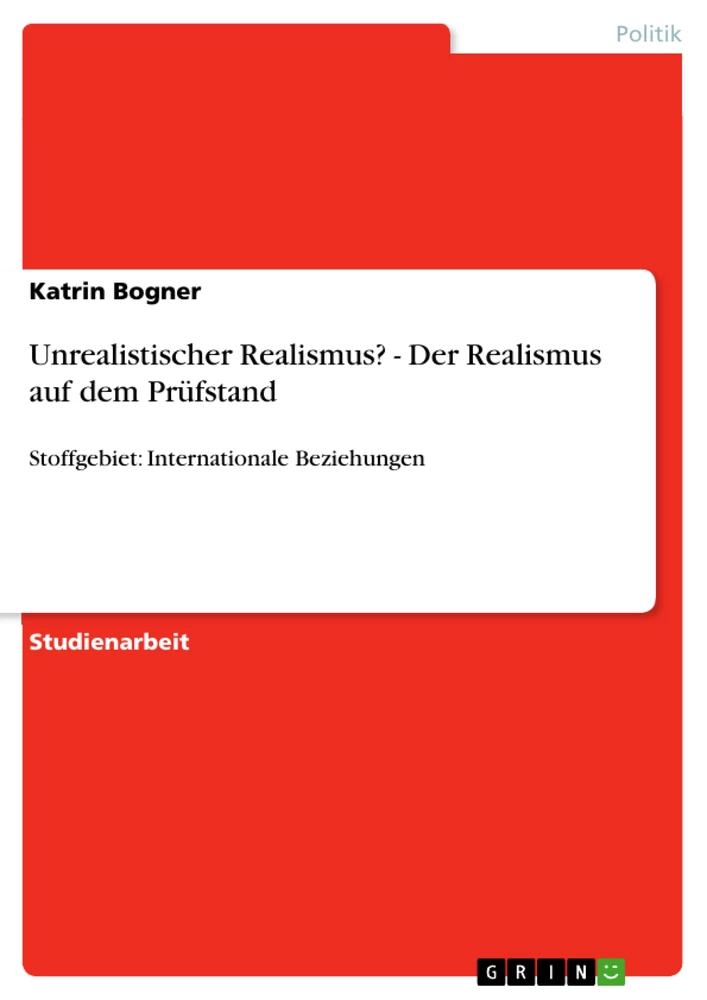Ziel vorliegender Arbeit war zu zeigen, wie der Institutionalismus, Konstruktivismus, Liberalismus und Feminismus die Schwächen des Realismus aufarbeiten. Dafür wurden zunächst die Hauptannahmen des klassischen Realismus und Neorealismus dargestellt. Diese sind, dass einheitliche, rationale Staaten die Hauptakteure in einer anarchischen Welt sind und nach Macht- bzw. Sicherheitsmaximierung streben. In einem Selbsthilfesystem sind Staaten auf sich selbst angewiesen, was Kooperation erschwert. Diese Annahmen wurden schließlich in Position zu den anderen Großtheorien gesetzt. Ergebnis war, dass der Institutionalismus im Gegensatz zum Realismus die Rolle internationaler Institutionen bei der Überwindung von Kooperationshindernissen hervorhebt. Der Konstruktivismus bestreitet, dass aus Anarchie logisch oder kausal Selbsthilfe folgt und betont stattdessen die Identitäts- und Interessensbildung von Staaten. Der Liberalismus zeigt die Wichtigkeit innenpolitischer Entscheidungsprozesse, besonders bei Demokratien, auf, die Auswirkungen auf außenpolitische Handlungen haben. Schließlich wurde noch eine feministische Kritik am Realismus dargestellt. Der Feminismus fordert mehr weibliche Ansichten in den Internationalen Beziehungen.
Abstract
The target of this work, entitled „Unrealistic Realism?-Realism being put to test”, was to reveal how Institutionalism, Constructivism, Liberalism and Feminism work off the realistic weak points. Therefore were shown the core assumptions of classical Realism as well as Neorealism, which are that unitary, rational nation states are the key actors, that seek to maximize power and security in an anarchic order. States live in a selfhelpsystem where cooperation is hard to achieve. These core assumptions then were put into position to Institutionalism, Constructivism and Liberalism. The result was that in opposition to Realism Institutionalism emphasizes the role of international institutions by breaking through the obstacles of cooperation. Constructivism disclaims that self-help logically or causally follows from anarchy. Instead identity and interest formation of states is important. Liberalism shows the importance of domestic decision-making processes, especially within democracies, which have impacts on foreign policy actions. Finally, a feminist perspective requires more female insights into International Relations.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Der Realismus
- a) Der klassische Realismus
- b) Der Neorealismus
- III. Die Schwächen des Realismus
- a) Realismus und Institutionalismus
- b) Realismus und Konstruktivismus
- c) Realismus und Liberalismus
- d) Realismus und Feminismus
- IV. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die Schwachstellen des Realismus in den internationalen Beziehungen aufzuzeigen. Die Arbeit untersucht, wie der Institutionalismus, Konstruktivismus, Liberalismus und Feminismus auf die Schwächen des Realismus reagieren. Die Arbeit behandelt die Grundannahmen des klassischen Realismus und des Neorealismus und analysiert die Kritikpunkte der anderen Theorien. Die Arbeit fokussiert auf die Rolle internationaler Institutionen, die Folgen der Anarchie, innenpolitische Entscheidungsprozesse und die Dominanz der Männlichkeit im Realismus.
- Die Schwächen des Realismus in den internationalen Beziehungen
- Die Rolle von Institutionen, Anarchie, und innenpolitischen Faktoren in der internationalen Politik
- Die Perspektive des Feminismus auf den Realismus
- Der klassische Realismus und der Neorealismus
- Die Kritik an den Grundannahmen des Realismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema „Unrealistischer Realismus? - Der Realismus auf dem Prüfstand“ ein und stellt den Fokus der Arbeit dar. Kapitel II beschreibt den Realismus, wobei es sich zunächst mit dem klassischen Realismus und seinen wichtigsten Vertretern, insbesondere Hans J. Morgenthau, befasst. Es werden die sechs Prinzipien des politischen Realismus von Morgenthau erläutert, die das Machtkonzept und die Bedeutung der nationalen Sicherheit in einem anarchischen System hervorheben. Kapitel II schließt mit einer Darstellung des Neorealismus ab.
Kapitel III widmet sich den Schwächen des Realismus. Es zeigt, wie der Institutionalismus, der Konstruktivismus und der Liberalismus auf die Schwächen des Realismus reagieren. Der Institutionalismus betont die Rolle internationaler Institutionen, die im Realismus vernachlässigt werden. Der Konstruktivismus stellt die Folgen der Anarchie in Frage, die im Neorealismus eine zentrale Rolle spielt. Der Liberalismus betrachtet innenpolitische Prozesse, die im Realismus der Außenpolitik untergeordnet werden. Abschließend werden kritische Perspektiven des Feminismus auf den Realismus beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Realismus, klassische Realismus, Neorealismus, Institutionalismus, Konstruktivismus, Liberalismus, Feminismus, Internationale Beziehungen, Anarchie, Macht, Sicherheit, Institutionen, innenpolitische Prozesse, Geschlechterverhältnisse.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Kernannahmen des Realismus in den Internationalen Beziehungen?
Der Realismus geht davon aus, dass rationale Staaten die Hauptakteure in einer anarchischen Welt sind und nach Macht- sowie Sicherheitsmaximierung streben.
Wie kritisiert der Konstruktivismus den Realismus?
Der Konstruktivismus bestreitet, dass Selbsthilfe eine zwingende Folge von Anarchie ist. Er betont stattdessen, dass Identitäten und Interessen von Staaten sozial konstruiert werden.
Welche Rolle spielen internationale Institutionen laut Institutionalismus?
Im Gegensatz zum Realismus hebt der Institutionalismus hervor, dass internationale Institutionen dabei helfen können, Kooperationshindernisse in einer anarchischen Welt zu überwinden.
Was ist der Fokus des Liberalismus in der Außenpolitik?
Der Liberalismus betont die Wichtigkeit innenpolitischer Entscheidungsprozesse, insbesondere in Demokratien, und deren direkten Einfluss auf das außenpolitische Handeln.
Welchen Kritikpunkt bringt der Feminismus vor?
Der Feminismus kritisiert die männliche Dominanz in der Theoriebildung des Realismus und fordert die Einbeziehung weiblicher Perspektiven in die Internationalen Beziehungen.
- Arbeit zitieren
- Katrin Bogner (Autor:in), 2005, Unrealistischer Realismus? - Der Realismus auf dem Prüfstand, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177366