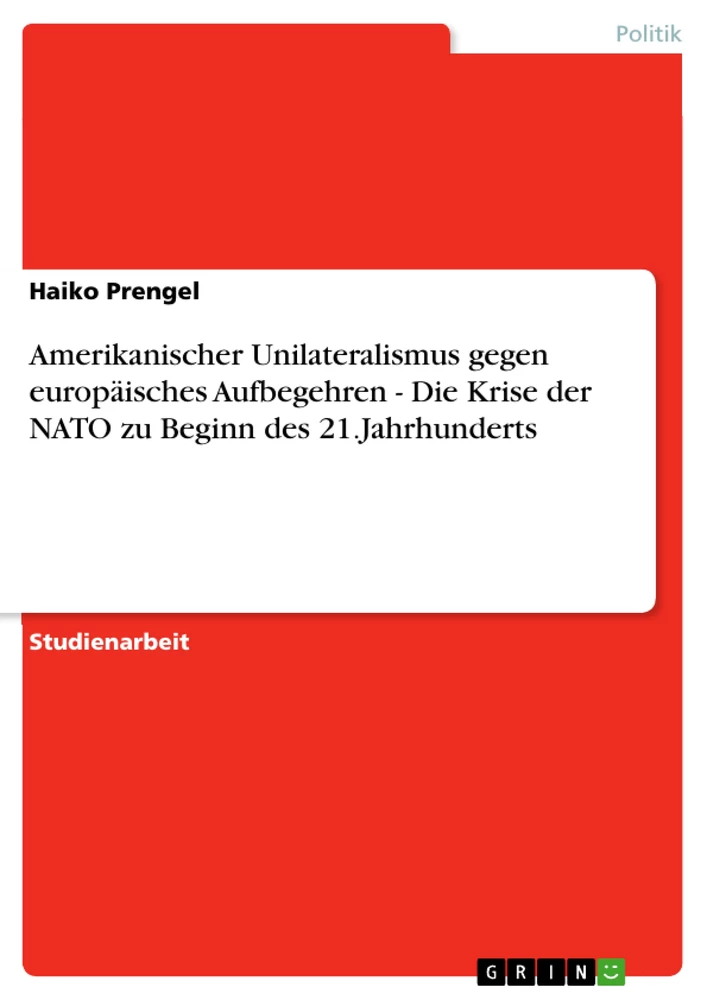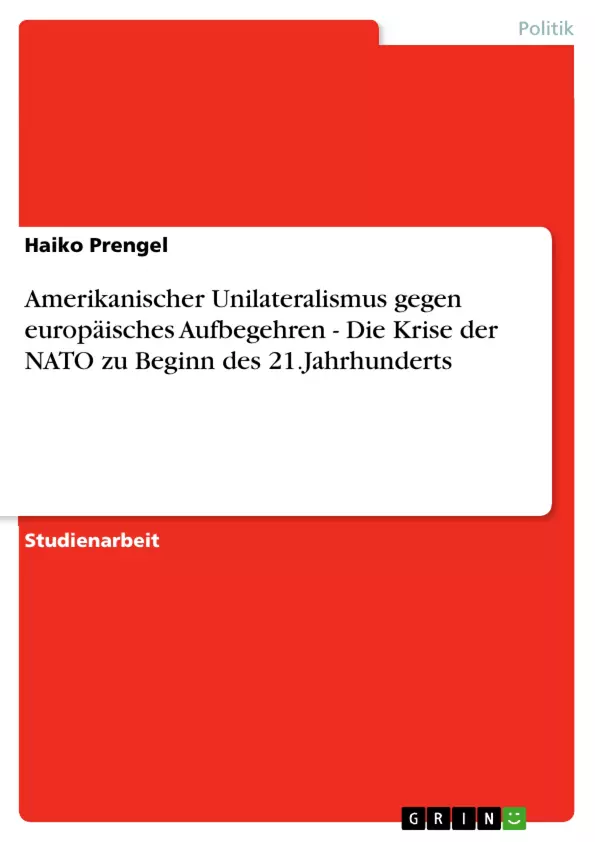Der im März 2003 begonnene Feldzug gegen Saddam Hussein und sein Regime im Irak ist Höhepunkt und Eskalation eines monatelangen politischen Ringens um eine friedliche Lösung des Konflikts. Diplomatie und Dialog in den internationalen Organisationen UN und NATO sind gescheitert. Der Angriffskrieg der USA mit ihren Verbündeten ohne legitimierendes Mandat der Vereinten Nationen ist eine Missachtung der UN-Charta und damit völkerrechtswidrig. Eine nachhaltige Schädigung und Demontage der Weltorganisation ist zu erwarten. Bereits im Kosovo-Krieg 1999 war gegen internationales Recht verstoßen worden; damals intervenierte die NATO unter Führung der USA ebenfalls ohne UN-Mandat und rang das jugoslawische Regime unter Milosevic nieder.
Im Kosovo wie heute im Irak wurde internationales Recht vor dem Hintergrund nationaler Interessen und Überzeugungen gebrochen. Tatsächlich spiegeln die Machtverhältnisse im UN-Sicherheitsrat die politischen Konstellationen der 1940er Jahre wieder. Ständig - gerade während des Kalten Krieges - mussten die westlichen Staaten mit einem russischen und/oder chinesischen Veto aus machtpolitischen und Prestigegründen rechnen. Somit konnten - aus westlicher Sicht - selbst zweifelsfrei notwendige und moralisch ‚edle′ Interventionen zur Vermeidung von Völkermord wie im Kosovo im UN-Sicherheitsrat durch ein Veto blockiert werden. Dissens und Blockade sowie die Spaltung in zwei politische Lager haben im UN-Sicherheitsrat also durchaus Tradition. Der aktuelle Irak-Konflikt stellt in vielerlei Hinsicht jedoch ein Novum dar: Zum ersten Mal in der Geschichte geht der Riss durch das Lager der westlichen Staaten selbst, und dies gleich auf mehreren Ebenen, nämlich neben dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auch noch in der NATO und der Europäischen Union. Auf der einen Seite stehen im konkreten Fall des Irak-Konflikts, vereinfacht ausgedrückt, die "Kriegsbefürworter" USA, Großbritannien mit einigen Verbündeten, auf der anderen Seite die "Kriegsgegner" Frankreich, Deutschland mit ihren Verbündeten. Insbesondere der markante Riss in der NATO ist einmalig in der 53jährigen Geschichte des Bündnisses. Auslöser war das Veto im Februar 2003 von Belgien, Frankreich und Deutschland gegen eine von der Türkei geforderte Beratung und Planung hinsichtlich ihres Schutzes durch die NATO (Artikel 4 des Washingtoner Vertrags) vor einem potenziellen irakischen Raketenangriffs in Folge eines US-Angriffs gegen Saddam Hussein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Irak-Konflikt als Sprengsatz in UNO, NATO und EU
- Strategiewechsel und weltpolitische Zäsur in Folge 11.September 2001
- Hauptteil: Regionale Integration in der NATO
- Transaktionalismus: Sicherheits- statt Wirtschaftsgemeinschaft
- Wunsch nach Frieden als Initiator regionaler Integration
- Sense of Community und Way of Life - Die NATO als Wertegemeinschaft
- Intergouvernementalismus - Primat der Nationalstaaten statt Wertekompatibilität
- Interessenvertretung in der NATO
- Interessen
- Amerikanischer Strategiewandel und europäisches Aufbegehren
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Krise der NATO zu Beginn des 21. Jahrhunderts im Kontext des amerikanischen Unilateralismus und des europäischen Aufbegehrens. Sie analysiert die Ursachen für die Spannungen innerhalb des Bündnisses und beleuchtet die Rolle des Irak-Konflikts als Katalysator für diese Krise.
- Regionale Integrationstheorien als Erklärungshilfe
- Der Irak-Konflikt als Sprengsatz in UNO, NATO und EU
- Amerikanischer Strategiewandel nach dem 11. September 2001
- Europäisches Aufbegehren gegen den amerikanischen Unilateralismus
- Die NATO als Sicherheitsgemeinschaft im Wandel
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung präsentiert den Irak-Konflikt als Höhepunkt und Eskalation eines monatelangen Ringens um eine friedliche Lösung. Sie kritisiert den Angriffskrieg der USA als völkerrechtswidrig und zeigt die Auswirkungen auf die Vereinten Nationen auf. Der Text beschreibt die historische Perspektive der Machtverhältnisse im UN-Sicherheitsrat und die Tradition von Dissens und Blockade. Schließlich wird der Irak-Konflikt als ein Novum dargestellt, das einen Riss durch das Lager der westlichen Staaten selbst zieht.
Hauptteil: Regionale Integration in der NATO
Der Hauptteil beschäftigt sich mit der NATO als regionaler Integrationseinheit. Er betrachtet die transnationale und intergouvernementale Perspektive der Integration und analysiert die Rolle der NATO als Sicherheitsgemeinschaft. Der Text beleuchtet die Bedeutung von Frieden, Wertegemeinschaft und Interessenvertretung innerhalb des Bündnisses.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Regionale Integration, NATO, Unilateralismus, Irak-Konflikt, 11. September 2001, Sicherheitsgemeinschaft, Wertegemeinschaft, Interessenvertretung, Transaktionalismus, Intergouvernementalismus.
Häufig gestellte Fragen
Was löste die Krise der NATO im Jahr 2003 aus?
Auslöser war der Irak-Konflikt und das Veto von Belgien, Frankreich und Deutschland gegen NATO-Planungen zum Schutz der Türkei, was zu einem tiefen Riss innerhalb des westlichen Bündnisses führte.
Warum wird der US-Angriff auf den Irak als völkerrechtswidrig bezeichnet?
Der Angriff erfolgte ohne legitimierendes Mandat der Vereinten Nationen und verstieß damit gegen die UN-Charta.
Wie veränderte der 11. September 2001 die amerikanische Strategie?
Er führte zu einer weltpolitischen Zäsur und einem Strategiewechsel hin zu Unilateralismus und Präventivschlägen, was die traditionellen multilateralen Strukturen der NATO und UN belastete.
Was versteht man unter der NATO als „Wertegemeinschaft“?
Es beschreibt das Konzept, dass die NATO-Mitglieder durch gemeinsame demokratische Werte und eine kollektive Identität ("Sense of Community") verbunden sind, was über eine reine Sicherheitsallianz hinausgeht.
Was ist der Unterschied zwischen Transaktionalismus und Intergouvernementalismus?
Transaktionalismus betont die Integration durch Gemeinschaftsbildung, während Intergouvernementalismus den Primat der nationalen Interessen der Einzelstaaten in den Vordergrund stellt.
Warum war die Spaltung der westlichen Staaten im Irak-Konflikt ein Novum?
Bisher verliefen Risse im UN-Sicherheitsrat meist zwischen West und Ost; 2003 verlief der Riss erstmals mitten durch das westliche Lager (USA/UK vs. Frankreich/Deutschland).
- Quote paper
- Magister Artium Haiko Prengel (Author), 2002, Amerikanischer Unilateralismus gegen europäisches Aufbegehren - Die Krise der NATO zu Beginn des 21.Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17737