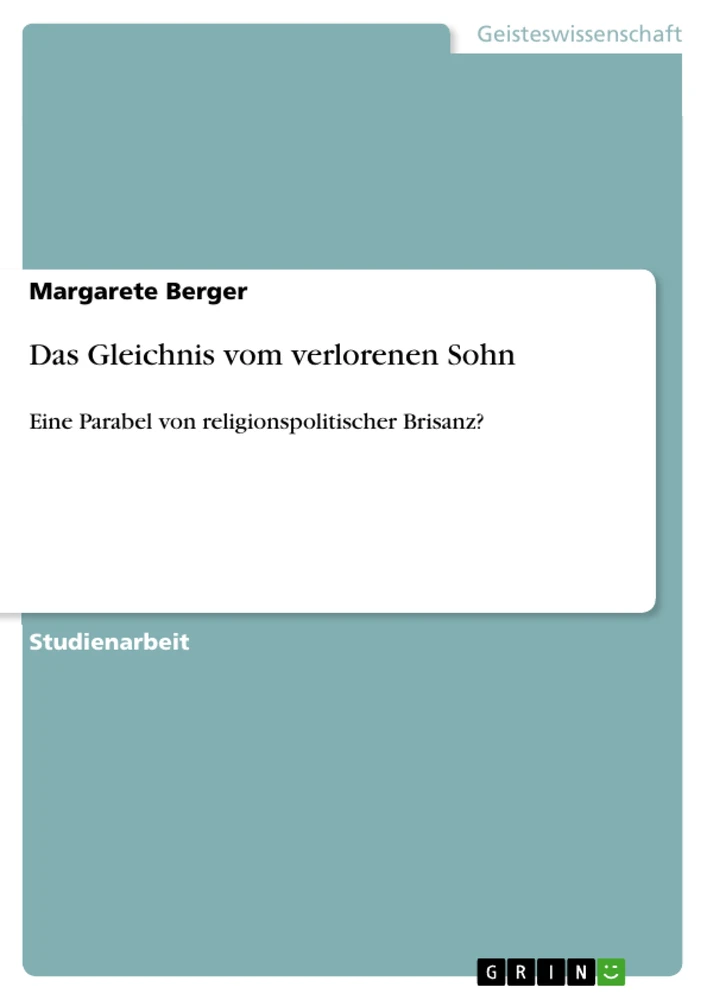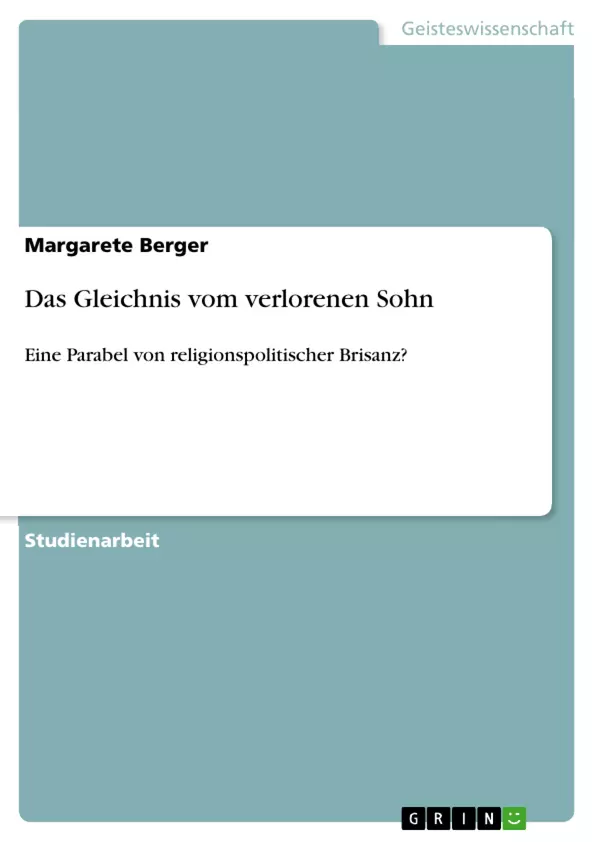Nach Ernst Troeltsch vollzog sich in Deutschland ein Prozess im Zeitraum von fünfzig Jahren, bis es zu einer offenen Debatte über die Problematik historisch-kritischer Hermeneutik kam. Anfang der siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts kamen zunächst Persönlichkeiten wie Ferdinand Hahn, Martin Hengel und Peter Stuhlmacher kritisch zu Wort. Im Laufe der Debatte stellten sich vor allem folgende Anfragen an die Exegese: Oft erachtete man die dis-tanzierte Herangehensweise an Bibeltexte als „atomistisch und zersetzend“ . Gerade im pasto-ralen Kontext führte dies zu Unsicherheiten im Umgang mit biblischer Literatur. Das Ziel, dem Leser durch die biblische Lektüre die Reich-Gottes-Botschaft zu vermitteln, schien das Gegenteil zu erreichen, da man mit der sehr wissenschaftlich und akademischen kritisch-historischen Methode wenig in einer christlichen Gemeinschaft erreichen konnte. Der lebens-praktische Wert schien irrelevant zu werden.
In heutiger Situation ist dennoch eine Art Apologie der historisch-kritischen Methode zu be-obachten, die sich auf folgende Argumente stützt: Sie bietet Raum für eine pluralistische Ar-gumentation biblischer Texte, kontrolliert durch historische Belege und vermeidet eine zu individualistische Auslegung durch Abwägung von Argumenten und Gegenargumenten.
Auch diese Hausarbeit bedient sich historisch-kritischer Methoden zur Erschließung einer lukanischen Parabel, die jedermann bekannt sein sollte: Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Dabei wird eingrenzend der zweite Teil des Gleichnisses untersucht. Hier gilt es, nach einer ausführlichen Darstellung des textkritischen Apparates die Verfassung einer eigenen Überset-zung zu versuchen, sowie unter synchronen und diachronen Untersuchungen die Eigenarten des Textes herauszuarbeiten.
Beim ersten Lesen von Lk 15,25-32 stellen sich bereits mehrere Fragen: Unterstellt der ältere Sohn seinem Bruder, dass dieser sein Erbe mit Dirnen durchgebracht hat oder woher wusste er dies (Vers 30)? Er ist zornig, obwohl er nichts von der Bekehrungsabsicht des Jüngeren weiß. Weiter ist unklar, warum der Vater zum Älteren seiner Söhne sagt: „Alles meinige ist dein.“, doch dieser ihn um ein Böcklein bitten muss, bevor er es bekommt. Drittens ist unschlüssig, woher der Vater weiß, dass sein älterer Sohn draußen steht, obwohl man nichts davon erfährt, dass der Sklave ihm Bescheid gesagt hat. Diese Ansätze führen womöglich schon zu diachroner Untersuchung und sollen im Laufe der Arbeit geklärt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Der textkritische Befund
- Textkritischer Apparat
- Diskussion der verschiedenen Übersetzungen
- Eigene Übersetzung
- Einleitung
- Synchrone Untersuchung des Textes
- Kontextabgrenzung und Einordnung
- Segmentierung und Analyse der Story
- Rekonstruktion der Ereignisfolge
- Aktantengerüst
- Sprachliche Analyse
- Wortschatz
- Wortarten und Wortformen
- Syntaktische Analyse
- Verknüpfung von Wörtern und Sätzen
- Stilmerkmale
- Semantische Analyse
- Pragmatische Analyse
- Standort des Autors
- Leserprofil
- Intention
- Diachrone Untersuchung des Textes
- Literarkritik
- Traditionskritik
- Synoptischer Vergleich
- Formale Abhängigkeiten
- Redaktionskritik
- Literarische Abhängigkeiten
- Alttestamentliche Zitate
- Fazit
- Form- und Gattungskritik
- Motivkritik
- Sitz im Leben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der historisch-kritischen Analyse des Gleichnisses vom verlorenen Sohn im Lukasevangelium. Sie untersucht den zweiten Teil des Gleichnisses und zielt darauf ab, die Eigenarten des Textes durch synchrone und diachrone Untersuchungen aufzudecken. Dazu gehört die Rekonstruktion des textkritischen Apparates, die Erstellung einer eigenen Übersetzung und die Analyse der literarischen und traditionskritischen Aspekte des Textes.
- Textkritische Analyse des Gleichnisses vom verlorenen Sohn
- Synchrone Untersuchung der sprachlichen und literarischen Aspekte
- Diachrone Untersuchung der literarischen und traditionsgeschichtlichen Zusammenhänge
- Erstellung einer eigenen Übersetzung des Textes
- Deutung der Eigenarten und Besonderheiten des Textes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer detaillierten Darstellung des textkritischen Befundes für den zweiten Teil des Gleichnisses vom verlorenen Sohn in Lk 15,25-32. Anschließend wird eine eigene Übersetzung des Textes vorgestellt und begründet. Die synchrone Analyse des Textes umfasst die Kontextabgrenzung, die Segmentierung und Analyse der Story, die sprachliche und syntaktische Analyse sowie die semantische und pragmatische Analyse. Schließlich befasst sich die diachrone Untersuchung des Textes mit der Literarkritik, der Traditionskritik und der Redaktionskritik. Die Arbeit schließt mit einem Fazit, in dem die Ergebnisse der Analyse zusammengefasst und die Bedeutung des Textes im Kontext der biblischen Literatur diskutiert werden.
Schlüsselwörter
Historisch-kritische Methode, Gleichnis vom verlorenen Sohn, Lukasevangelium, Textkritik, Übersetzung, Synchrone Analyse, Diachrone Analyse, Literarkritik, Traditionskritik, Redaktionskritik, Bibelinterpretation, Religionsgeschichte, Zeitgeschichte.
Häufig gestellte Fragen zum Gleichnis vom verlorenen Sohn
Welcher Teil des Gleichnisses wird in dieser Arbeit untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich speziell auf den zweiten Teil des lukanischen Gleichnisses (Lk 15,25-32), in dem der ältere Sohn im Mittelpunkt steht.
Was ist die historisch-kritische Methode?
Es ist eine wissenschaftliche Methode zur Auslegung biblischer Texte, die historische Belege nutzt und Textkritik, Literarkritik sowie Redaktionskritik umfasst.
Warum ist die Reaktion des älteren Sohnes problematisch?
Er reagiert zornig auf die Rückkehr seines Bruders, obwohl er dessen Bekehrungsabsicht nicht kennt, und wirft ihm vor, das Erbe mit Dirnen verschwendet zu haben.
Was bedeutet synchrone und diachrone Untersuchung?
Die synchrone Analyse betrachtet den Text in seiner jetzigen Gestalt (Sprache, Struktur), während die diachrone Analyse die Entstehungsgeschichte und Vorlagen untersucht.
Was ist die Intention der Reich-Gottes-Botschaft im Gleichnis?
Das Gleichnis soll Gottes bedingungslose Gnade und die Freude über die Umkehr eines Sünders vermitteln, was im Kontrast zur Haltung des älteren Sohnes steht.
- Arbeit zitieren
- Margarete Berger (Autor:in), 2010, Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177423