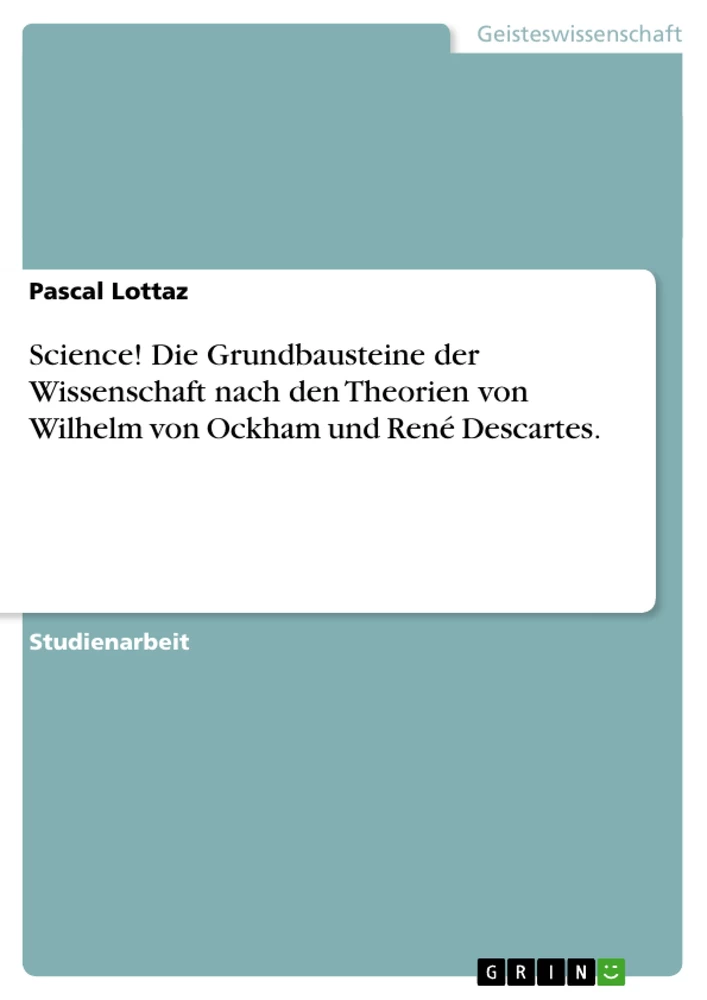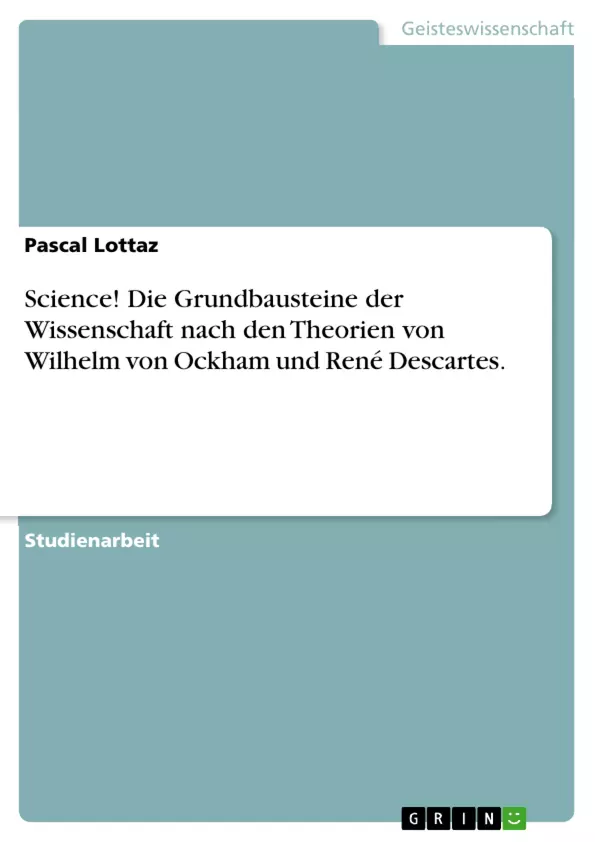Die hier vorliegende Arbeit ist eine Untersuchung über die Konzeption der Wissenschaft zweier faszinierender Männer, Wilhelm von Ockham und René Descartes. Beide waren Vordenker ihres Zeitalters, Ockham des Mittelalters und Descartes der Neuzeit, die mit ihren Werken den Fortlauf der Wissenschaft nachhaltig beeinflusst haben.
Um aus den folgenden, wenigen Seiten eine fruchtbare Arbeit zu fertigen, wird sich meine Untersuchung strikt auf einen bestimmten Ausschnitt der Wissenschaftstheorien der beiden Philosophen beschränken. Das heisst, ich werde versuchen zu ergründen, was die Konzepte von beiden Autoren zu drei notwendigen Bestandteilen einer jeden Theorie der Wissenschaft sind: das Subjekt der Wissenschaft, das Objekt der Wissenschaft und die Art und Weise wie neues Wissen prinzipiell erlangt wird.2
Die ersten beiden Teile sind also eine Auseinandersetzung mit den zwei grundsätzlichen Entitäten der Wissenschaft und der letzte Teil ist eine Beschäftigung mit einem Ausschnitt aus der Theorie zu den Methoden von Ockham und Descartes. Durch dieseAuseinandersetzung soll es möglich sein, die wichtigsten Thesen der beiden Philosophen zu diesem Thema zu verstehen, ihre Gemeinsamkeiten zu erkennen und ihre Unterschiede deutlich zu sehen.
Was diese Arbeit aber nicht bietet, ist eine systematische Einführung zu den Theorien von Descartes und Ockham. Ihre Theorien werde ich lediglich fortlaufend erklären und analysieren, um sie zueinander in Kontrast setzen zu können. Die Arbeit wird sich in erster Linie aber immer um den Begriff der Wissenschaft bei den beiden Philosophen drehen und nicht um ihr Schaffen im Generellen.
1. Inhaltsverzeichnis:
2. Einleitung
3. Das Subjekt der Wissenschaft
Descartes’ Subjekt: das „Ich“
Ockhams Subjekt: der Intellekt
Der Unterschied der Subjektbegriffe
4. Das Objekt der Wissenschaft
Die Propositionen Ockhams
Der Akt des Wissens
Die Ideen Descartes’
Das Wesen der Wissenschaft:
5. Grundzüge der Methoden
6. Fazit
7. Literaturverzeichnis
2. Einleitung
Die grundlegenden Prinzipien unserer Wissenschaften, denen wir Glauben und Vertrauen schenken, zu legen, darin besteht der Sinn und Zweck der philosophischen Auseinandersetzung mit Wissen und Erkenntnis. Erkenntnistheorie im Generellen, oder Wissenschaftstheorie im Konkreten wird dieser Zweige der Philosophie genannt. Dabei geht es der Wissenschaftstheorie darum, die Leitplanken zu legen, nach denen Wissenschaft betrieben werden kann. Das ist nicht definitorisch, als Vorschrift zu verstehen, sondern es geht dabei um die prinzipielle Natur der Erkenntnis. Die Wissenschaftstheorie dreht sich darum, das Wesen der Wissenschaft, was sie ist, was sie vermag, wo ihre Grenzen liegen, zu ergründen und zu erklären.
Es gibt unzählige Autoren, die sich im Verlaufe der Geschichte mit der Wissenschaft an sich als Untersuchungsobjekt auseinandergesetzt haben. Von Sokrates bis Einstein, bemühten sich grosse Köpfe das Wesen dieser Materie genauer zu ergründen und es waren lange nicht nur klassische Philosophen die sich mit ihren Problemen beschäftigten, sondern auch praktische Wissenschaftler, die sich über ihre eigenen Methoden zwangsläufig Gedanken machen mussten.1
Die hier vorliegende Arbeit ist eine Untersuchung über die Konzeption der Wissenschaft zweier faszinierender Männer, Wilhelm von Ockham und René Descartes. Beide waren Vordenker ihres Zeitalters, Ockham des Mittelalters und Descartes der Neuzeit, die mit ihren Werken den Fortlauf der Wissenschaft nachhaltig beeinflusst haben.
Um aus den folgenden, wenigen Seiten eine fruchtbare Arbeit zu fertigen, wird sich meine Untersuchung strikt auf einen bestimmten Ausschnitt der Wissenschaftstheorien der beiden Philosophen beschränken. Das heisst, ich werde versuchen zu ergründen, was die Konzepte von beiden Autoren zu drei notwendigen Bestandteilen einer jeden Theorie der Wissenschaft sind: das Subjekt der Wissenschaft, das Objekt der Wissenschaft und die Art und Weise wie neues Wissen prinzipiell erlangt wird.2
Die ersten beiden Teile sind also eine Auseinandersetzung mit den zwei grundsätzlichen Entitäten der Wissenschaft und der letzte Teil ist eine Beschäftigung mit einem Ausschnitt aus der Theorie zu den Methoden von Ockham und Descartes. Durch diese Auseinandersetzung soll es möglich sein, die wichtigsten Thesen der beiden Philosophen zu diesem Thema zu verstehen, ihre Gemeinsamkeiten zu erkennen und ihre Unterschiede deutlich zu sehen.
Was diese Arbeit aber nicht bietet, ist eine systematische Einführung zu den Theorien von Descartes und Ockham. Ihre Theorien werde ich lediglich fortlaufend erklären und analysieren, um sie zueinander in Kontrast setzen zu können. Die Arbeit wird sich in erster Linie aber immer um den Begriff der Wissenschaft bei den beiden Philosophen drehen und nicht um ihr Schaffen im Generellen.
3. Das Subjekt der Wissenschaft - Das „Ich“ vs. Der Intellekt -
Bei der Untersuchung des Subjektes der Wissenschaft, wollen wir uns daran setzten zu entdecken, wen oder was Descartes und Ockham als den Untersuchenden betrachteten. Anders gesagt, es geht darum zu sehen, was die beiden Philosophen als Voraussetzungen an den Betrachter stellten.
Natürlich, so mag der Einwand klingen, ist der Betreiber der Wissenschaft der Wissenschaftler selbst, das muss sogar für Descartes und Ockham der Fall sein. Dem ist auch so, keiner der beiden hätte etwas anderes behauptet. Wo liegt nun aber der Witz dieser Analyse? Nun, ganz einfach, der liegt in der Definition, was denn dieser Untersuchende ist und was seine Teile sind.
Descartes ’ Subjekt: das „ Ich “
Beginnen wir mit dem skeptischeren der beiden Denker, mit dem, der seine Fundamente bis aufs letzte, unanzweifelbare zurückgehakt hat, um von da aus seine ganze Welt neu aufzubauen, mit Descartes also.
Dieser verwirft nämlich alles, was ihm nicht als absolut sicher und unanzweifelbar erscheint. Dazu zählt er vor allem die körperliche Welt, respektive die Aussenwelt, womit alles gemeint ist, was sich nicht in unserem Intellekt befindet. Diese extramentale Welt weist er als Ursprung sicheren Wissens zurück, weil wir uns schlicht nicht sicher sein können, ob extramentale Dinge wirklich existieren. Es könnte ja sein, dass ein böser Gott uns die Welt um uns lediglich vorgaukelt, einem Traum gleich oder aber, dass ich als Mensch lediglich an einen Computer angeschlossen bin, der mit Drähten meinem Gehirn eine Matrix vorspielt,3 die mir als echte Welt erscheint. Das Einzige was Descartes als sicher und unanzweifelbar akzeptiert, ist das denkende Selbst, das „Ich“ das denkt. Denn es ist unter keinen vorstellbaren Umständen möglich zu denken, dass man denkt, aber sich doch dabei zu täuschen und gar nicht wirklich zu denken, denn dann wäre kein denkendes Wesen da, welches diesen Gedanken wälzen könnte. Also ist dies ganz sicher, wenn ich denke, dann existiere ich auch!4 Dies ist das Wissenschaft betreibende Subjekt Descartes, von dem er aber noch wesentlich mehr abverlangt als lediglich zu erkennen, dass es existiert, um Wissenschaft betreiben zu können. Auch alle anderen Einsichten, zu denen es gelangt müssen nämlich so sicher sein, wie die erste, unanzweifelbare. Dazu gehört die Einsicht, dass das „Ich“, damit es überhaupt Denken kann, sich zumindest in einer Zeit befinden muss, damit dieser Gedanke sich manifestieren kann. Wenn dem so ist, dann muss das „Ich“ daraus schliessen, dass es einmal angefangen hat zu denken und dementsprechend auch wieder damit aufhören wird. Es folgt also dies: Das „Ich“ ist nicht nur ein denkendes sondern auch ein finites Wesen. Darüber hinaus ist klar, dass obwohl ich meinen extramentalen Eindrücken nicht trauen kann, ich doch mindestens solche Eindrücke über das Extramentale habe. Ich bin also dazu gezwungen von der Existenz der Eindrücke des Extramentalen auszugehen, denn hätte ich noch nicht mal die Eindrücke davon, so würde ich sie mir gar nicht überlegen.5 Also, egal ob diese Eindrücke
Phantasien, Illusionen oder tatsächlich existierende Dinge in einer Aussenwelt sind, die Eindrücke, die sie in mir hervorrufen sind wirkliche Eindrücke in mir.6 Somit wären wir also bei der Einsicht, dass das Subjekt der Wissenschaft, das „Ich“ ist, das eine denkende, temporal finite Entität ist, mit in der mentalen Innenwelt tatsächlich existierenden Eindrücken.7 Dass dieses „Ich“ auch tatsächlich das Wissenschaft betreibende Subjekt ist, führt Descartes uns in seiner dritten Regel aus. Dort sagt er nämlich: „(...) wenn gleich wir alle von anderen gefundenen Beweise im Gedächtnis behielten, wozu nicht auch unser Geist imstande wäre, Probleme aller Art selbst aufzulösen; (...) alsdann nämlich hätten wir offenbar nicht Wissenschaft, sondern Geschichte gelernt.“8 Diese unverzichtbare Wichtigkeit des denkenden „Ichs“, das in diesem Satz der „Geist“ genannt wird, zeigt uns, dass für Descartes das denkende „Ich“ die Essenz des Wissenschaft betreibenden Subjektes ist.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
So weit so gut, damit hätten wir in Descartes Ontologie das „Ich“ gefunden und als kleinste, von der wissenschaftlichen Beobachtung unabtrennbaren Bedingung für eben diese ausgemacht.
Ockhams Subjekt: der Intellekt
Tun wir nun dasselbe bei Ockham, denn auch er hat eine klare Auffassung darüber, was und wie das erkennende „Ich“ funktioniert. Er geht zwar nicht soweit zurück wie Descartes, doch machte er einige sehr präzise Aussagen über das denkende Wesen in seinem Prolog zum Physikkommentar. Er definiert dieses Wesen nämlich als den Intellekt.9 Respektive hält er fest, dass es nur der Intellekt sei, der uns Zugang verschaffe zu irgendeiner Art von Wissen über die Aussenwelt. Damit ist es dieser Intellekt, der das Subjekt der Wissenschaft bei Ockham ist10. Wie funktioniert nun dieser Intellekt?
Nun, erst einmal teilt er sich auf in zwei Akte, einen erfassenden und einen urteilenden Akt.11 Der erfassende Akt beschäftigt sich mit der „Erfassung“ von Objekten. Das heisst dieser Akt nimmt Propositionen, welche verknüpft oder unverknüpft sein können, auf und leitet sie „tiefer“ in den Apparatus des Intellekts, wo sie vom urteilenden Akt anerkannt oder abgelehnt werden. Der erste Akt, der Erfassende, ist epistemologisch primär (also dem zweiten vorausgeschaltet). Das soll heissen, dass der zweite notwendigerweise vom ersten abhängt. Denn funktioniert das Erfassen der Aussenwelt nicht (wofür der erfassende Akt ja da ist), so gibt es kein Urteilen über das Erfasste, also keinen urteilenden Akt.12 Nicht jedes Erfasste aber erfährt auch eine Beurteilung durch den urteilenden Akt. Diese nicht beurteilten Dinge nennt Ockham „Unverknüpftes.“ Beurteilte Dinge wiederum nennt er (nach dem sie also bereites durch den zweiten Akt beurteilt wurden), Verknüpftes. Das Unverknüpfte kann aber trotzdem, obwohl es nicht beurteilt wurde einen wichtigen Teil unserer Erkenntnis ausmachen, da es nämlich Unverknüpftes gibt, das mit Evidenz erkannt wird. Das heisst es wird auch so Teil unseres epistemischen Grundbaus, nämlich dann, wenn es ohne dass ein Urteil darüber zu fällen nötig wäre, evident, also mit absoluter, aus sich selbst hervorgehender Sicherheit erkannt werden kann13. Alles Andere, das wir erkennen wollen, muss zuerst vom urteilenden Akt entweder noch Zustimmung oder Ablehnung erfahren. Es ist also die Aufgabe des urteilenden Aktes „Ja, richtig“ oder „Nein, falsch“ zu einem gegebenen Objekt zu sagen. Hat der urteilende Akt seine Arbeit getan, so haben wir neue Erkenntnis, nämlich, ob wir das betrachtete Objekt annehmen, oder ablehnen, gewonnen.14 Um dieses erkennende Subjekt, den Intellekt, etwas einfacher verständlich zu machen, stelle man ihn sich schematisch wie eine Maschine vor, so wie die nebenstehende Abbildung.
Mit dieser Beschreibung des Intellekts befinden wir uns bereits in der Frage danach, wie Erkenntnis gewonnen wird und nicht mehr ausschliesslich dabei, wer sie gewinnt. Diese beiden Dinge sind bei Ockham aber eng miteinander verknüpft, weil der Intellekt das was und das wie ist und müssen daher auch gemeinsam betrachtet werden. Auf die Frage nach dem wie werden wir aber im 5. Kapitel noch näher eingehen.
[...]
1 Vgl. NATROP, P., Descartes ’ Erkenntnistheorie, Marburg 1882, S. 12.
2 Diese Untersuchung ist also von Anfang bis Ende vergleichend strukturiert. Das heisst, die Theorien der beiden Philosophen werden nicht beide separiert vorgestellt und erst in einem letzten Kapitel einander gegenübergestellt, sondern fortlaufend erklärt und mit dem jeweils Anderen verglichen.
3 Das Gedankenexperiment aus dem Film „Die Matrix“. Siehe dazu: WACHOWSKI, A & L., The Matrix, 1999.
4 Vgl. DESCARTES, R., Abhandlung über die Methode, übers. und hrsg. von A. BUCHENAU, Leipzig, 1922. Vierter Teil, 3.
5 Vgl. SCHOLUS, P.A., Descartes and the possibility of science, New York 2000, S. 15.
6 Vgl. DESCARTES, R., Abhandlung über die Mehtode, ed. cit., Vierter Teil, 7.
7 Vgl. SCHOLUS, P.A., op. cit., S. 16.
8 DESCARTES, R., Regeln zur Leitung des Geistes, übers. und hrsg. von A. BUCHENAU, Leipzig, 1922. Regel Ⅲ, 2.
9 Vgl. VON OCKHAM, W., Physikkommentar, Prolog, übers. und hrsg. von R. IMBACH, durchgesehene Ausg., Stuttgart, 1986. Absatz 20.
10 Vgl. PERINI-SANTOS, E., La th é orie ockhamienne de la connaissance é vidente, Paris 2006, S. 156.
11 Vgl. VON OCKHAM, W., Sentenzenkommentar, Prolog, übers. und hrsg. von R. IMBACH, durchgesehene Ausg., Stuttgart, 1986. Frage 1, Artikel 1, Absatz 2 u. 3
12 ibid., Absatz 7.
13 Nähere Erklärungen zur Evidenz folgen im 5. Kapitel.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck dieser Arbeit über Ockham und Descartes?
Der Zweck ist, die grundlegenden Prinzipien der Wissenschaften, die wir glauben und denen wir vertrauen, zu legen. Dies geschieht durch die philosophische Auseinandersetzung mit Wissen und Erkenntnis, insbesondere durch die Wissenschaftstheorie, die Leitplanken für die Wissenschaft legt und das Wesen der Wissenschaft ergründet.
Worauf konzentriert sich diese Arbeit über Ockham und Descartes?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Konzeption der Wissenschaft bei Wilhelm von Ockham und René Descartes. Sie untersucht, wie beide Autoren das Subjekt der Wissenschaft, das Objekt der Wissenschaft und die Art und Weise, wie neues Wissen erlangt wird, konzipieren.
Was wird unter dem "Subjekt der Wissenschaft" in dieser Arbeit verstanden?
Das Subjekt der Wissenschaft bezieht sich auf denjenigen oder das, was als der Untersuchende betrachtet wird. Es geht darum, welche Voraussetzungen Descartes und Ockham an den Betrachter stellen, d.h. wer oder was die Wissenschaft betreibt.
Wie definiert Descartes das "Subjekt der Wissenschaft"?
Descartes definiert das Subjekt der Wissenschaft als das denkende Selbst, das "Ich". Dieses "Ich" ist eine denkende, temporal finite Entität mit tatsächlich existierenden Eindrücken in der mentalen Innenwelt. Es muss selbst Probleme lösen können und nicht nur Wissen auswendig lernen.
Wie definiert Ockham das "Subjekt der Wissenschaft"?
Ockham definiert das Subjekt der Wissenschaft als den Intellekt. Er hält fest, dass nur der Intellekt uns Zugang zu Wissen über die Aussenwelt verschafft. Dieser Intellekt teilt sich in einen erfassenden und einen urteilenden Akt auf.
Was sind die zwei Akte des Intellekts nach Ockham?
Der Intellekt teilt sich auf in einen erfassenden und einen urteilenden Akt. Der erfassende Akt nimmt Propositionen auf und leitet sie weiter, während der urteilende Akt diese Propositionen entweder annimmt oder ablehnt.
Was bedeutet "Unverknüpftes" im Kontext von Ockhams Intellekt?
"Unverknüpftes" bezieht sich auf Dinge, die vom erfassenden Akt aufgenommen, aber nicht vom urteilenden Akt beurteilt wurden. Es kann trotzdem einen wichtigen Teil unserer Erkenntnis ausmachen, wenn es mit Evidenz erkannt wird.
Bietet diese Arbeit eine systematische Einführung in die Theorien von Descartes und Ockham?
Nein, die Arbeit bietet keine systematische Einführung. Die Theorien werden lediglich fortlaufend erklärt und analysiert, um sie zueinander in Kontrast zu setzen. Der Fokus liegt immer auf dem Begriff der Wissenschaft bei den beiden Philosophen.
- Arbeit zitieren
- Pascal Lottaz (Autor:in), 2009, Science! Die Grundbausteine der Wissenschaft nach den Theorien von Wilhelm von Ockham und René Descartes., München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177448