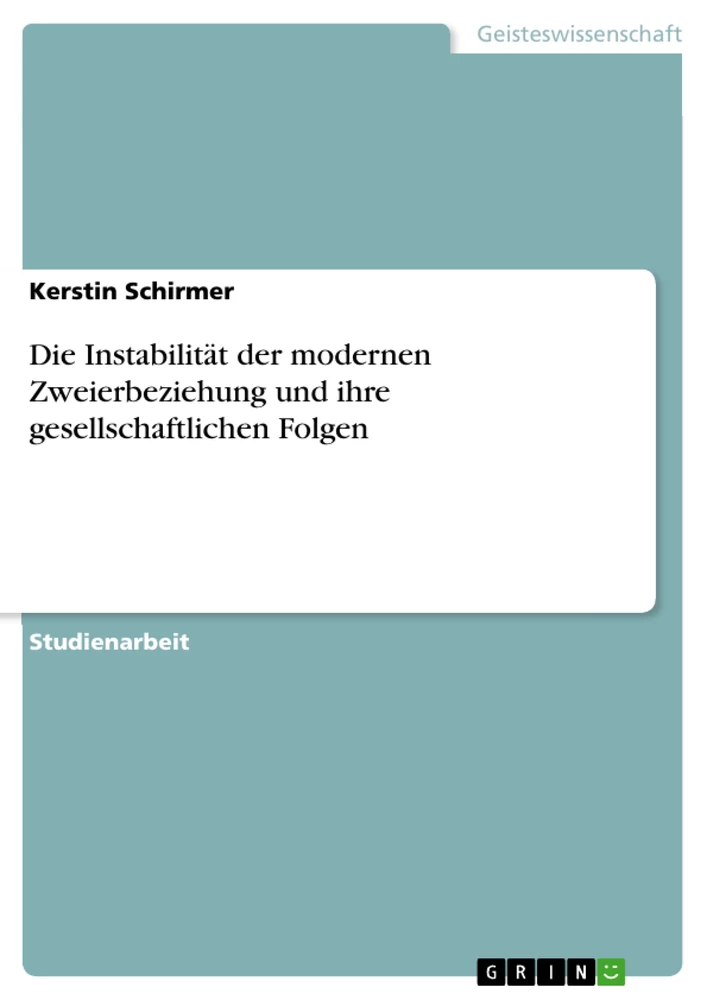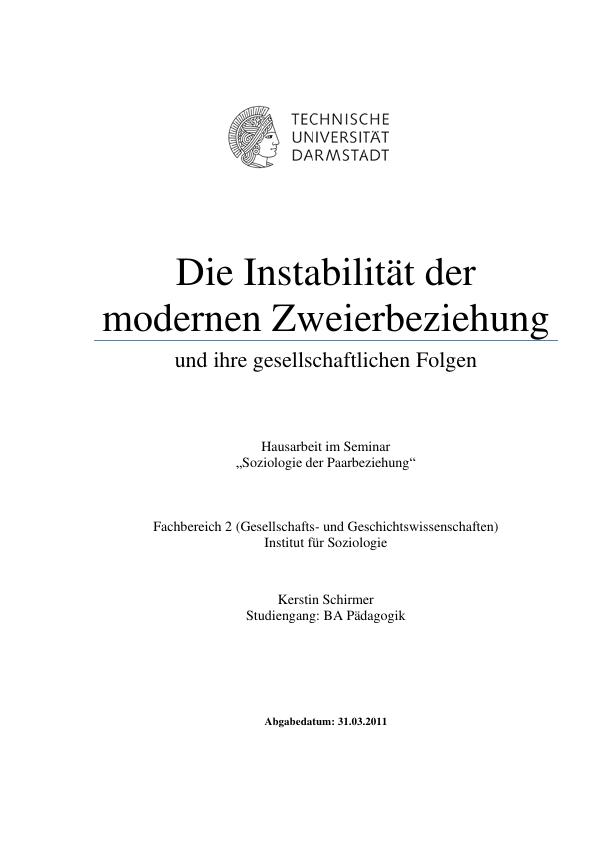„Die Institution der Scheidung ist wahrscheinlich genauso alt wie die Ehe selbst.“ (Hill/Kopp 2006, S. 268-269) Mit diesem Satz möchten Hill und Kopp verdeutlichen, dass es Ehescheidungen in allen Epochen und in fast allen Kulturkreisen gegeben hat. Jedoch waren sie stets die Ausnahme. Heute ist Scheidung allerdings zu einem Massenphänomen geworden. Seitdem im Jahre 1888 die Scheidungszahlen erstmals dokumentiert wurden, kann man einen fast konstanten Anstieg dieser erkennen (vgl. Hill/Kopp 2006, S. 269). Die Zahl der Ehescheidungen erfasst jedoch nur einen kleinen Teil der Beziehungsdynamik. „Die Trennungs-rate von nichtehelichen Lebensgemeinschaften innerhalb der ersten 6 Jahre ist etwa dreimal so hoch wie die Trennungsrate von Ehen.“ (Peuckert 2008, S. 172) Aus diesem Grund wurde in den letzten Jahren vermehrt von der Instabilität der modernen Zweierbeziehung gesprochen (vgl. Peuckert 2008; Lois 2009; Schmidt 2006). Die vorliegende Arbeit möchte die These der Instabilität der Zweierbeziehung näher darstellen und diese auf ihre gesellschaftlichen Auswirkungen hin untersuchen. Die zentrale Fragestellung der Arbeit lautet dabei: Welche gesellschaftlichen Veränderungen lassen sich durch die hohen Scheidungs- und Trennungsraten verzeichnen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Merkmale der modernen Zweierbeziehung
- Die These der Instabilität der modernen Zweierbeziehung
- Theoretische Erklärungsansätze
- Der familienökonomische Ansatz von Becker
- Das austauschtheoretische Modell zur Ehestabilität von Lewis und Spanier
- Die Individualisierungsthese von Beck
- Weitere Ursachen
- Wandel der Beziehungsideale
- Die Eigendynamik der Scheidungsentwicklung
- Gesellschaftliche Folgen
- Pluralisierung der Lebensformen
- Wandel der Kindschaftsverhältnisse
- Zunahme von Ein-Eltern-Familien
- Anstieg von Fortsetzungsehen und Stieffamilien
- Ökonomische Folgen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die These der Instabilität der modernen Zweierbeziehung und deren gesellschaftlichen Folgen. Sie setzt sich mit der zunehmenden Scheidungs- und Trennungsrate auseinander und beleuchtet die Frage, welche gesellschaftlichen Veränderungen durch diese Entwicklungen ausgelöst werden.
- Merkmale der modernen Zweierbeziehung
- Empirische Ergebnisse zu Scheidungs- und Trennungsraten
- Theoretische Erklärungsansätze für die Instabilität von Zweierbeziehungen
- Weitere Ursachen für die Instabilität von Zweierbeziehungen
- Gesellschaftliche Folgen der hohen Scheidungs- und Trennungsraten
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beleuchtet die zentralen Merkmale der modernen Zweierbeziehung, wobei der Fokus auf den Begriff der Zweierbeziehung nach Lenz (2009) liegt. Die Prozesshaftigkeit, die Konstruktion von Wirklichkeit und die emotionale Verbundenheit werden als wichtige Charakteristika dieser Beziehungstypen herausgestellt. Weiterhin wird auf die gesellschaftlichen Normen und Regeln eingegangen, die mit Zweierbeziehungen verbunden sind.
Kapitel 3 stellt die These der Instabilität der modernen Zweierbeziehung dar und stützt diese auf die Entwicklung der Scheidungszahlen in Deutschland. Die Entwicklung der Ehescheidungsziffer wird anhand statistischer Daten beleuchtet, wobei der Anstieg dieser Ziffer im Fokus steht. Die Arbeit geht auf die Besonderheiten der Entwicklung in den neuen Bundesländern ein und stellt die Unterschiede zum früheren Bundesgebiet dar.
Kapitel 4 präsentiert drei soziologische Erklärungsansätze, die versuchen, die Instabilität der modernen Zweierbeziehung zu erklären. Der familienökonomische Ansatz von Becker, das austauschtheoretische Modell von Lewis und Spanier sowie die Individualisierungsthese von Beck werden vorgestellt und ihre jeweiligen Perspektiven auf die Ehestabilität beleuchtet.
Kapitel 5 beschäftigt sich mit weiteren Ursachen für die Instabilität von Zweierbeziehungen, die über die in Kapitel 4 dargestellten Erklärungsansätze hinausgehen. Dabei werden Themen wie der Wandel der Beziehungsideale und die Eigendynamik der Scheidungsentwicklung behandelt.
Kapitel 6 befasst sich mit den gesellschaftlichen Folgen der hohen Scheidungs- und Trennungsraten. Die Pluralisierung der Lebensformen, der Wandel der Kindschaftsverhältnisse und die ökonomischen Folgen werden als wichtige Auswirkungen dieser Entwicklung dargestellt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themen dieser Arbeit sind: Zweierbeziehung, Instabilität, Scheidung, Trennung, gesellschaftliche Folgen, Familienökonomie, Austauschtheorie, Individualisierungsthese, Wandel der Beziehungsideale, Pluralisierung der Lebensformen, Kindschaftsverhältnisse, ökonomische Folgen.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet die „Instabilität der modernen Zweierbeziehung“?
Dies beschreibt das Phänomen, dass Ehen und Lebensgemeinschaften heute häufiger und schneller aufgelöst werden als in früheren Epochen, was sich in steigenden Scheidungs- und Trennungsraten zeigt.
Welche soziologischen Erklärungen gibt es für hohe Scheidungsraten?
Wichtige Ansätze sind Beckers familienökonomischer Ansatz, das austauschtheoretische Modell von Lewis & Spanier sowie die Individualisierungsthese von Ulrich Beck.
Was sind die gesellschaftlichen Folgen dieser Instabilität?
Es kommt zu einer Pluralisierung der Lebensformen, einer Zunahme von Ein-Eltern-Familien, Stieffamilien (Patchwork) und veränderten ökonomischen Bedingungen für die Betroffenen.
Wie hoch ist die Trennungsrate bei nichtehelichen Gemeinschaften?
Untersuchungen zeigen, dass die Trennungsrate bei nichtehelichen Lebensgemeinschaften in den ersten sechs Jahren etwa dreimal so hoch ist wie bei Ehen.
Welche Rolle spielt der Wandel der Beziehungsideale?
Heute stehen emotionale Erfüllung und individuelle Selbstverwirklichung im Vordergrund. Wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, wird die Beziehung schneller infrage gestellt als früher.
- Arbeit zitieren
- Kerstin Schirmer (Autor:in), 2011, Die Instabilität der modernen Zweierbeziehung und ihre gesellschaftlichen Folgen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177482