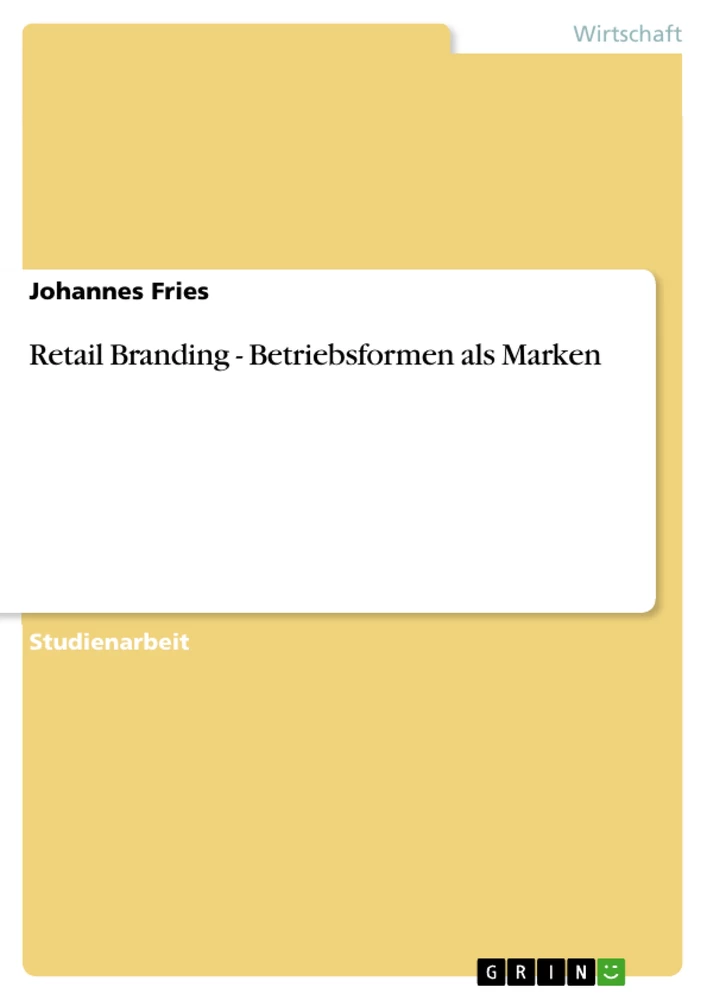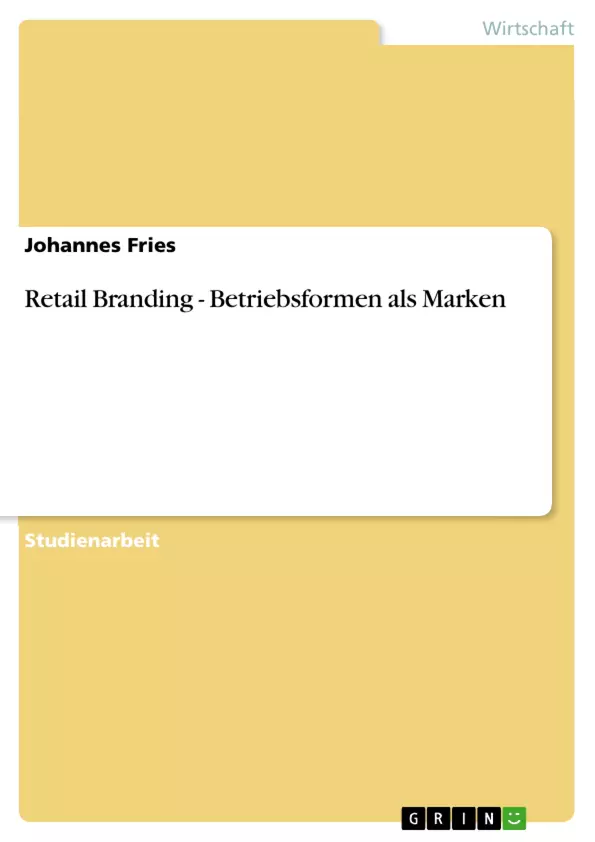1 Einleitung
Sie wurden als „die zentrale und oft (…) erste echte Marke im Handel“ bezeichnet und prägten die Handelslandschaft des deutschen Lebensmitteleinzelhandels bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts: „Tante Emma“ – Läden.nDiese traditionellen und populären Einkaufsstätten waren durch ihre Inhaber bzw. Inhaberinnen und deren Persönlichkeit gekennzeichnet, was wiederum zur erheblichen Profilierung, einem engen Kundenkontakt und somit auch zur Einmaligkeit der kleinen Einzelhandelsgeschäfte beitrug . Verdrängt wurden sie von dem Prinzip der Selbstbedienung und der aufkommenden Konkurrenz aus Discountern und Supermärkten. Diese Entwicklung führte dazu, dass der Handel den direkten sowie persönlichen Kontakt zum Konsumenten und die Einkaufsstätten somit ihre Unverwechselbarkeit verloren haben – die Handelsunternehmen wurden zu „Brand-Retailer oder anders ausgedrückt, eine Distributionsstelle für Markenartikel“ mit austauschbaren Sortimenten und einer unbedeutenden Rolle innerhalb der Wertschöpfungskette.bDie Geschäftstättewahl erfolgte nunmehr auf Basis rationaler Determinanten, wie beispielsweise dem Preis.
Um einer solchen Entwicklung und dem stärker werdenden Wettbewerb sowie Preiskampf entgegenzutreten, versuchen die Handelsunternehmen die unbedeutende Rolle innerhalb der Wertschöpfungskette abzulegen: Durch einen vermehrten Strategie- bzw. Fokuswechsel von der Beschaffungs- zur Absatzseite und einer adäquate Profilierung des Unternehmens bzw. der Einkaufsstätte als Marke,
wollen die Handelsunternehmen die Marketingführerschaft innerhalb der Wertschöpfungskette wieder erlangen.
Vor dem Hintergrund dieser beschriebenen Ausgangslage soll im Folgenden untersucht werden, wie sich Handelsunternehmen als Marke profilieren und positionieren können. Unter diesem Gesichtspunkt, dem Retail Branding, werden zu Beginn der Arbeit die notwendigen Grundlagen geschaffen und essentielle Begriffe des Handels sowie Markenmanagements definiert und erläutert. Der Fokus dieser Arbeit liegt sodann auf der Darstellung des Konzeptes des Retail Branding sowie der Analyse der marketingspezifischen Instrumente. Abschließend werden die wichtigsten und entscheidenden Ergebnisse im Fazit nochmals aufgeführt und festgehalten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen des Handels
- Begriff des Handels
- Begriff der Betriebsform und des Betriebstyps
- Grundlagen des Markenmanagements
- Begriff der Marke
- Begriff des Markenmanagements
- Konzept des Retail Branding
- Begriff der Retail Brand und Retail Branding
- Chancen und Risiken des Retail Branding
- Operative Planung des Retail Branding – der Retailing – Mix
- Sortimentspolitik
- Preispolitik
- Kommunikationspolitik
- Servicepolitik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht, wie sich Handelsunternehmen als Marke profilieren und positionieren können. Sie beleuchtet die Entwicklung vom traditionellen Einzelhandel hin zum modernen „Brand-Retailer“ und analysiert die Strategien, mit denen Unternehmen im zunehmenden Wettbewerb ihre Rolle in der Wertschöpfungskette stärken können.
- Entwicklung des Handels und der Rolle von Marken
- Konzept des Retail Branding und dessen Bedeutung
- Marketinginstrumente im Retail Branding (Retailing-Mix)
- Chancen und Risiken des Retail Branding
- Strategien zur Markenprofilierung im Handel
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Wandel im deutschen Lebensmitteleinzelhandel vom traditionellen „Tante-Emma-Laden“ hin zu großen, anonymen Handelsketten. Sie hebt die zunehmende Austauschbarkeit von Sortimenten und den Verlust des direkten Kundenkontakts hervor und führt als Gegenstrategie das Retail Branding ein, das Handelsunternehmen erlaubt, sich als Marke zu positionieren und die Marketingführerschaft zurückzugewinnen. Die Arbeit untersucht daher, wie Handelsunternehmen ihre Markenprofilierung und -positionierung erfolgreich gestalten können.
Grundlagen des Handels: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Handels und unterscheidet zwischen Betriebsform und Betriebstyp. Es legt die theoretischen Grundlagen für das Verständnis der Strukturen und Funktionsweisen im Einzelhandel, die für die spätere Betrachtung des Retail Branding unerlässlich sind. Die Unterscheidung zwischen Betriebsform und Betriebstyp bildet die Basis für die Analyse der verschiedenen Möglichkeiten der Markenprofilierung im Handel. Die klare Definition dieser Begriffe ist essentiell für die spätere Anwendung im Kontext des Retail Branding.
Grundlagen des Markenmanagements: Dieses Kapitel erläutert die Konzepte von Marke und Markenmanagement. Es liefert das notwendige theoretische Rüstzeug, um das Konzept des Retail Branding im Kontext des allgemeinen Markenmanagements zu verstehen. Die Definition von Marke und die Beschreibung verschiedener Markenmanagement-Ansätze bilden die Grundlage für die spätere Analyse der spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten des Retail Branding. Der Fokus liegt auf den theoretischen Grundlagen, die für die Anwendung auf den Einzelhandel unerlässlich sind.
Konzept des Retail Branding: Dieses Kapitel definiert den Begriff Retail Branding und analysiert die damit verbundenen Chancen und Risiken. Es beleuchtet den Retailing-Mix als operatives Instrument zur Umsetzung von Retail Branding Strategien. Die detaillierte Betrachtung der Sortiments-, Preis-, Kommunikations- und Servicepolitik gibt einen umfassenden Einblick in die operativen Aspekte des Retail Branding. Die Analyse von Chancen und Risiken stellt die strategische Bedeutung dieses Konzepts heraus und bietet eine ganzheitliche Betrachtung der Herausforderungen und Möglichkeiten im Einzelhandel.
Schlüsselwörter
Retail Branding, Markenmanagement, Handelsmarken, Betriebsformen, Wettbewerbsvorteil, Marketingstrategie, Retailing-Mix, Kundenbindung, Wertschöpfungskette, Markenpositionierung, Einzelhandel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Retail Branding
Was ist der Inhalt der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht, wie sich Handelsunternehmen als Marke profilieren und positionieren können. Sie beleuchtet die Entwicklung vom traditionellen Einzelhandel zum modernen „Brand-Retailer“ und analysiert Strategien zur Stärkung der Rolle von Unternehmen in der Wertschöpfungskette. Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zu den Grundlagen des Handels und Markenmanagements, ein detailliertes Kapitel zum Konzept des Retail Branding inklusive des Retailing-Mix (Sortiments-, Preis-, Kommunikations- und Servicepolitik), eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die zentralen Themen sind die Entwicklung des Handels und die Rolle von Marken, das Konzept des Retail Branding und seine Bedeutung, Marketinginstrumente im Retail Branding (Retailing-Mix), Chancen und Risiken des Retail Branding sowie Strategien zur Markenprofilierung im Handel. Die Arbeit definiert auch grundlegende Begriffe wie Handel, Betriebsform, Betriebstyp, Marke und Markenmanagement.
Was sind die Ziele der Seminararbeit?
Die Seminararbeit soll zeigen, wie Handelsunternehmen ihre Markenprofilierung und -positionierung erfolgreich gestalten können. Sie analysiert den Wandel im Einzelhandel und die Notwendigkeit des Retail Branding als Strategie zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit im zunehmenden Wettbewerb.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit ist gegliedert in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Grundlagen des Handels (inkl. Definition von Handel, Betriebsform und Betriebstyp), ein Kapitel zu den Grundlagen des Markenmanagements (inkl. Definition von Marke und Markenmanagement), ein Kapitel zum Konzept des Retail Branding (inkl. Retailing-Mix: Sortiments-, Preis-, Kommunikations- und Servicepolitik, Chancen und Risiken), und ein Fazit.
Was ist der Retailing-Mix?
Der Retailing-Mix umfasst die operativen Instrumente zur Umsetzung von Retail Branding Strategien. Er besteht aus der Sortimentspolitik, der Preispolitik, der Kommunikationspolitik und der Servicepolitik. Diese vier Bereiche sind entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung des Retail Branding.
Welche Chancen und Risiken bietet Retail Branding?
Die Seminararbeit analysiert sowohl die Chancen (z.B. Stärkung der Markenpositionierung, Erhöhung der Kundenbindung, Wettbewerbsvorteil) als auch die Risiken (z.B. hohe Investitionskosten, Gefahr von Markenimage-Schäden) des Retail Branding. Diese werden im Kapitel zum Konzept des Retail Branding detailliert erläutert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Seminararbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Retail Branding, Markenmanagement, Handelsmarken, Betriebsformen, Wettbewerbsvorteil, Marketingstrategie, Retailing-Mix, Kundenbindung, Wertschöpfungskette, Markenpositionierung, Einzelhandel.
Für wen ist diese Seminararbeit relevant?
Diese Seminararbeit ist relevant für alle, die sich mit dem Thema Markenmanagement im Einzelhandel, der Entwicklung des Handels und Strategien zur Wettbewerbsfähigkeit befassen. Sie richtet sich insbesondere an Studierende, Wissenschaftler und Praktiker im Bereich des Handels und Marketings.
Wie beschreibt die Seminararbeit den Wandel im Einzelhandel?
Die Seminararbeit beschreibt den Wandel vom traditionellen „Tante-Emma-Laden“ zu großen, anonymen Handelsketten und den damit verbundenen Herausforderungen wie der zunehmenden Austauschbarkeit von Sortimenten und dem Verlust des direkten Kundenkontakts. Retail Branding wird als Gegenstrategie präsentiert, um die Marketingführerschaft zurückzugewinnen.
- Quote paper
- Johannes Fries (Author), 2011, Retail Branding - Betriebsformen als Marken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177484