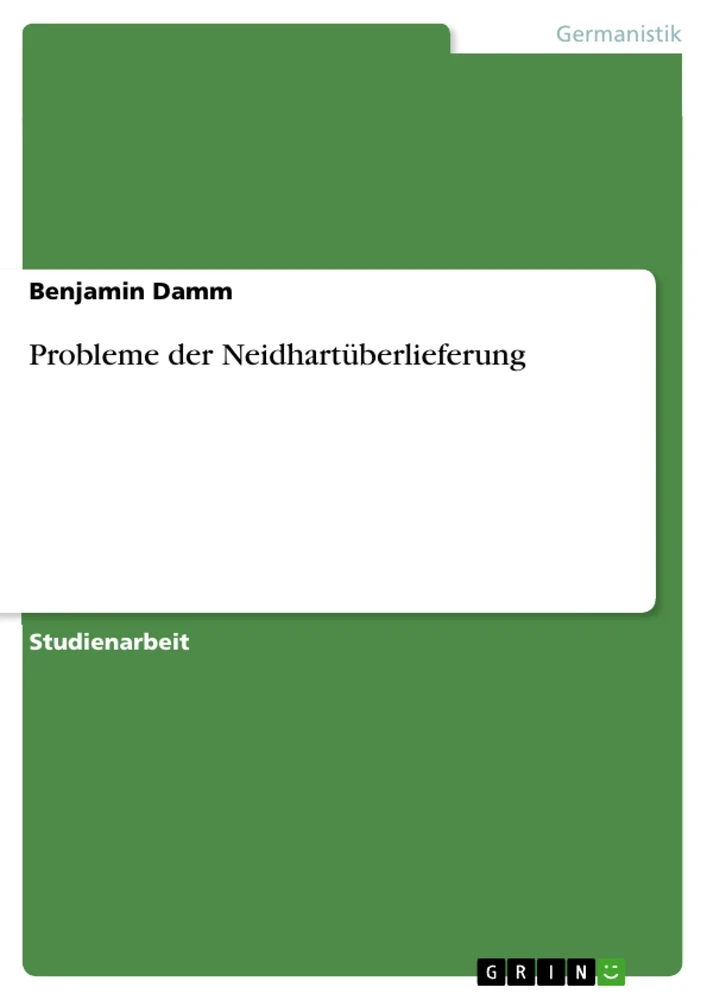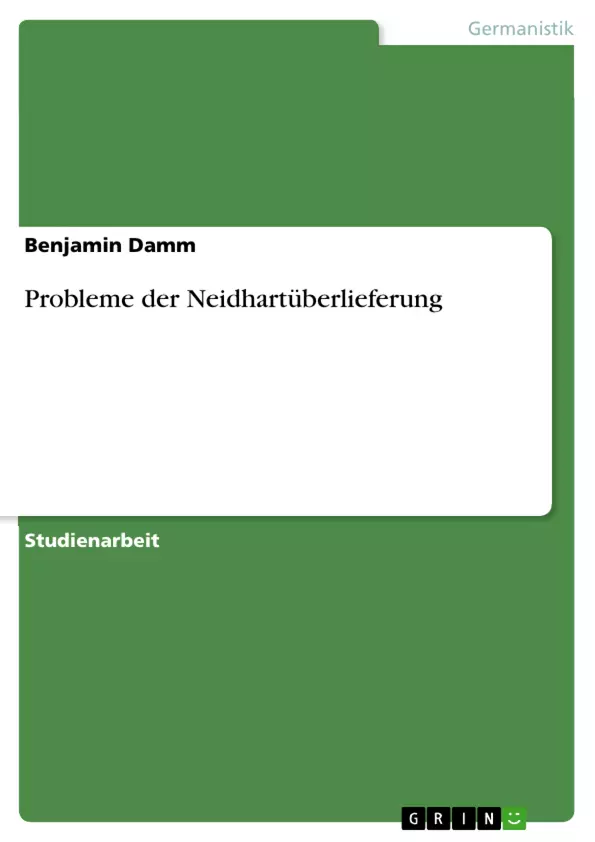Die Lieder Neidharts zählen zu der am reichsten überlieferten Lyrik des Mittelalters. Die Lieder sind in 25 Handschriften überliefert. Ihre Entstehung Handschriften erstreckt sich über einen Zeitraum vom 13. bis zum 16. Jahrhundert. Den Kern der Überlieferung bilden die Pergamenthandschriften aus dem Ende des 13. Jahrhunderts bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts, mit den Siglen R, A, B, C und die späteren Papierhandschriften c, d, f, w aus dem 15. Jahrhundert.
Um eine relativ nahe Autorfassung zu erhalten, betrachtet man zumeist die Riedegger Handschrift R als Grundlage einer Untersuchung. Denn man geht davon aus, dass der Autor Neidhart etwa um 1240 verstorben sei. Der Grundsatz einer stichhaltigen Untersuchung lautet hierbei, sich zeitlich einer möglichst autornahen Fassung der Lieder anzunähern. Denn eine Fassung die näher an den Lebensdaten des Autors liegt, ist aussagekräftiger als eine der späteren Fassungen, die möglicherweise nicht nur einem sprachlichen, sondern auch einem inhaltlichen Wandel unterlagen.
Dennoch bildet die Riedegger Handschrift R kein geschlossenes Œvre Neidharts, wie es zunächst erscheinen mag. Zahlreiche Lieder sind lückenhaft oder nur in anderen Handschriften überliefert. Es existiert vielmehr eine weit verzweigte Überlieferung, die sowohl als Gesamtwerk als auch in ihren einzelnen Texten inkongruent ist.
Weit über die Lebenszeit Neidharts hinaus lässt sich feststellen, dass dieser einen so hohen Bekanntheitsgrad genoss, dass es eine Menge von Nachahmern seines Stils gab. Die Rede ist in diesem Zusammenhang von den sogenannten Pseudoneidharten. Auf diese Weise entsteht ein Werk, das über den empirischen Autor hinausreicht.
Inhaltsverzeichnis
- Neidhart-Überlieferung
- Schwierigkeiten der Neidhart-Überlieferung
- Haupt, Wieẞner und die Lachmann-Methode
- New Philology
- Schweikle und das rezeptionstheoretische Autorenkonzept
- Die Überlieferungsproblematik am Beispiel des Winterliedes 28 (ATB)
- Das Winterlied 28 nach der Lachmann-Methode
- Das Winterlied 28 und die New Philology
- Das Winterlied 28 und das rezeptionshistorische Autorenkonzept
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Problematik der Überlieferung der Lieder Neidharts. Sie analysiert die Schwierigkeiten, die sich aus der komplexen und uneinheitlichen Überlieferung für die wissenschaftliche Untersuchung ergeben, und stellt verschiedene Ansätze der Neidhart-Forschung vor.
- Die vielfältigen und komplexen Aspekte der Neidhart-Überlieferung
- Die Herausforderungen, die sich aus der Problematik des Autors und der Rekonstruktion einer echten Textfassung ergeben
- Die verschiedenen Methoden der Neidhart-Forschung, insbesondere die Lachmann-Methode, die New Philology und das rezeptionstheoretische Autorenkonzept
- Die Anwendung der verschiedenen Methoden am Beispiel des Winterliedes 28
- Die Grenzen und Potenziale der einzelnen Forschungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die grundlegende Überlieferung der Lieder Neidharts. Es werden die wichtigsten Handschriften und deren Entstehungszeit vorgestellt. Das zweite Kapitel geht auf die Schwierigkeiten ein, die sich aus der komplexen und uneinheitlichen Überlieferung für die wissenschaftliche Untersuchung ergeben.
Das dritte Kapitel beleuchtet die Lachmann-Methode und die Arbeit von Moriz Haupt, der die erste kritische Ausgabe zu Neidharts Liedern anfertigte. Im vierten Kapitel wird die New Philology vorgestellt, ein Forschungsansatz, der die Überlieferungsproblematik in einem neuen Licht betrachtet. Das fünfte Kapitel behandelt das rezeptionstheoretische Autorenkonzept von Schweikle.
Das sechste Kapitel analysiert die Überlieferungsproblematik am Beispiel des Winterliedes 28 und zeigt die Anwendung der verschiedenen Methoden auf.
Schlüsselwörter
Neidhart-Überlieferung, Lachmann-Methode, New Philology, rezeptionstheoretisches Autorenkonzept, Winterlied 28, Handschriften, Autor, Rezeption, Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Neidhart-Überlieferung so komplex?
Die Lieder sind in 25 Handschriften über einen Zeitraum von 300 Jahren überliefert, was zu vielen Varianten und inhaltlichen Veränderungen führte.
Was besagt die Lachmann-Methode in der Neidhart-Forschung?
Diese Methode versucht, durch den Vergleich von Fehlern in Handschriften eine möglichst autornahe Urfassung des Textes zu rekonstruieren.
Was ist „New Philology“?
Im Gegensatz zur Rekonstruktion eines Urtextes betrachtet die New Philology jede einzelne Handschrift als eigenständiges, wertvolles Zeugnis ihrer jeweiligen Zeit.
Wer sind die „Pseudoneidharte“?
Aufgrund der hohen Popularität Neidharts gab es viele Nachahmer, die Lieder in seinem Stil verfassten, was die Unterscheidung von echten Werken erschwert.
Welche Bedeutung hat die Riedegger Handschrift R?
Sie gilt als eine der wichtigsten und zeitlich am nächsten am Autor liegenden Quellen, auch wenn sie Lücken aufweist und kein geschlossenes Gesamtwerk darstellt.
- Quote paper
- Benjamin Damm (Author), 2010, Probleme der Neidhartüberlieferung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177549