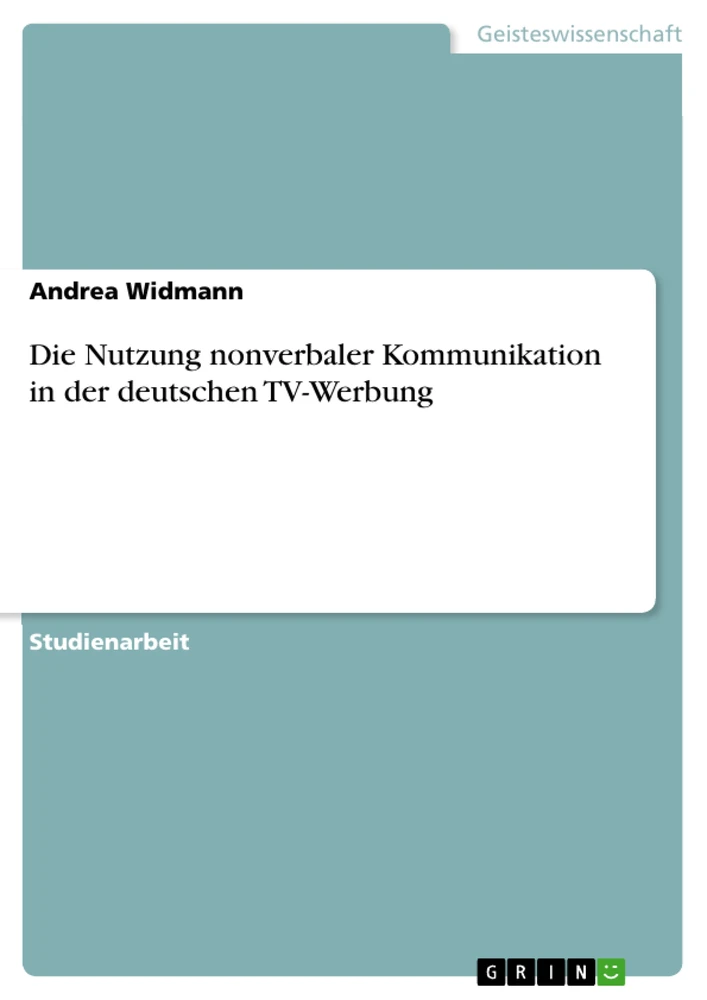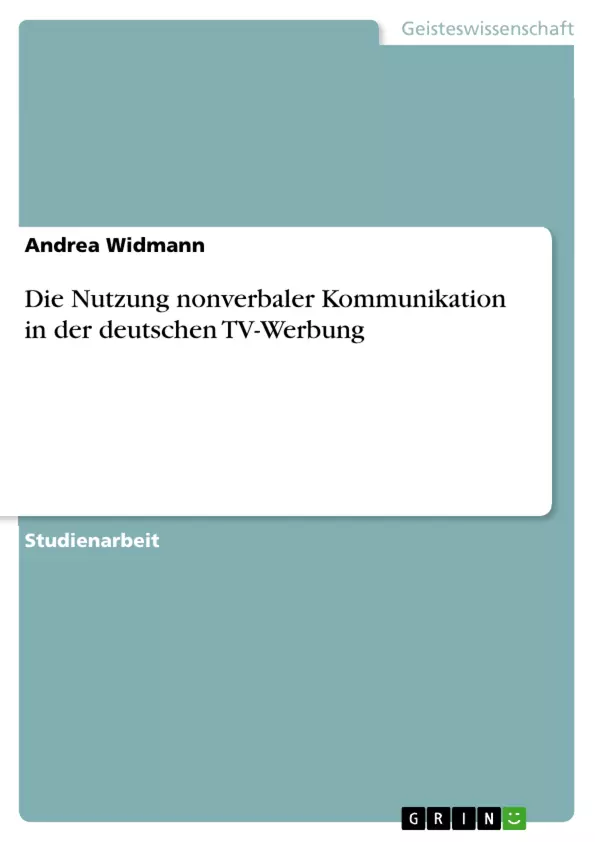Nonverbale Kommunikation dürfte den meisten Menschen bekannt sein und mit Beginn der Ausstrahlung1 der TV-Serie „Lie to me“ wurde das Thema publikumswirksam in die heimischen Wohnzimmer gebracht. Einschlägige Ratgeber beschäftigen sich mit der Körpersprache und bieten ihren Lesern Hilfe im beruflichen Alltag2 oder in verschiedenen Situationen3 an. Es ist selbstverständlich in der zwischenmenschlichen Kommunikation zu nonverbalen Signalen zu greifen, zumeist geschieht dies vollkommen unbewusst und manche davon sind nur mit großen Aufwand unterdrückbar. In der Kommunikation der TV-Werbung wird der körperliche Ausdruck gezielt eingesetzt, soll aber zugleich den Schein des Echten und Spontanen erwecken (Hickethier, 2007, S. 171).Da es sehr viel Werbung für die verschiedensten Zielgruppen, gibt, wird die Untersuchung auf die Werbung im Abendprogramm von ca. 19 Uhr bis 23 Uhr beschränkt. Vormittags und Nachmittags kann man davon ausgehen, dass unter anderem bzw. zwischen einschlägigen Kindersendungen überwiegend Kinder als Zielgruppe angesprochen werden und nach 23 Uhr, im Nachtprogramm, beginnt zunehmend sexuell orientierte Werbung einzufließen. In der Regel kann man davon ausgehen, dass die zu untersuchenden Werbeclips also die Kernzielgruppe der 14- bis 49-jährigen anvisiert (Karstens, Schütte, 2010, S. 23). Diese Hausarbeit soll untersuchen, ob bei menschlichen Akteuren innerhalb der TV-Werbung zu nonverbaler Kommunikation gegriffen wird und in welchem Umfang dies stattfindet. Deren Wirksamkeit ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. Dazu wird die nicht-hörbare und in der Mimik erkennbare nonverbale Kommunikation der Schauspieler in den Werbeclips mit der Methode des EmFACS (emotional Facial Action Coding System) erfasst und in einen vorbereiteten Fragebogen eingetragen. Die dadurch ermittelten Daten werden später, mit Hilfe eines Kodierbogens, in eine SPSS-Datei übertragen und danach weiterverarbeitet. Eine umfassendere Erfassung über diese Eingrenzung hinaus ist für den Rahmen einer Hausarbeit zu aufwändig und zu weitgreifend. Einführend erfolgt die Definition des Werbebegriffs, also was man sich unter Werbung vorstellen kann und welchen Regelungen die Werbung als solche unterworfen ist. Daraufhin befasst sich diese Hausarbeit mit dem Begriff der Kommunikation, was man darunter versteht und wie diese abläuft.
...
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und Vorgehensweise
- 2 Theorie und Forschungsstand
- 2.1 Werbung
- 2.2 Nonverbale Kommunikation
- 2.3 Forschungsstand
- 2.4 Fragestellung und Hypothesen
- 3 Konzeption und Methoden
- 3.1 Stichprobe, Datenerhebung und Operationalisierung
- 3.2 Objektivität, Reliabilität und Validität
- 4 Ergebnisse
- 5 Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Einsatz nonverbaler Kommunikation in der deutschen TV-Werbung. Ziel ist es, die Art und den Umfang nonverbaler Signale in Werbeclips zu analysieren und zu untersuchen, ob und inwiefern diese bei menschlichen Akteuren eingesetzt werden.
- Definition und Bedeutung von Werbung
- Theorie und Praxis der nonverbalen Kommunikation
- Forschungsstand zum Einsatz nonverbaler Kommunikation in der Werbung
- Analyse nonverbaler Kommunikation in TV-Werbespots mit Hilfe des EmFACS
- Interpretation und Diskussion der Ergebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor, beschreibt die Vorgehensweise und grenzt den Forschungsgegenstand ein. Kapitel 2 befasst sich mit der Theorie und dem Forschungsstand zu Werbung und nonverbaler Kommunikation. Es werden verschiedene Definitionen und Theorien vorgestellt, sowie relevante Forschungsarbeiten zum Thema nonverbaler Kommunikation in der Werbung zusammengefasst. Kapitel 3 erläutert die Konzeption und Methoden der Untersuchung. Dabei werden die Stichprobe, die Datenerhebung und die Operationalisierung der Variablen detailliert beschrieben. Zudem werden die Aspekte der Objektivität, Reliabilität und Validität der gewählten Methoden beleuchtet. Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung, welche mit Hilfe des EmFACS gewonnen wurden. Die Ergebnisse werden analysiert und interpretiert. Im Fazit werden die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und ein Ausblick auf mögliche Erweiterungen der Untersuchung gegeben.
Schlüsselwörter
Nonverbale Kommunikation, TV-Werbung, EmFACS, Körpersprache, Mimik, Werbebotschaft, Zielgruppe, Kommunikationsmodell, Forschungsstand, Analyse, Interpretation.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird nonverbale Kommunikation in der TV-Werbung eingesetzt?
In Werbeclips wird der körperliche Ausdruck gezielt genutzt, um Emotionen zu vermitteln und gleichzeitig den Schein von Echtheit und Spontaneität zu erwecken.
Was ist das EmFACS-System?
Das emotional Facial Action Coding System (EmFACS) ist eine wissenschaftliche Methode zur Erfassung und Kodierung von mimischen Ausdrücken und Emotionen.
Welche Zielgruppe wird in der Untersuchung analysiert?
Die Untersuchung konzentriert sich auf Werbespots im Abendprogramm (19 bis 23 Uhr), die primär die Kernzielgruppe der 14- bis 49-jährigen ansprechen.
Wird die Wirksamkeit der Werbung in dieser Arbeit untersucht?
Nein, die Arbeit untersucht lediglich die Art und den Umfang des Einsatzes nonverbaler Signale, nicht jedoch deren tatsächliche Wirkung auf den Zuschauer.
Welche Rolle spielt die TV-Serie „Lie to me“ in der Einleitung?
Die Serie wird als Beispiel dafür genannt, wie das Thema der Analyse von Mimik und Körpersprache einem breiten Publikum bekannt gemacht wurde.
Wie wurden die Daten für die Hausarbeit verarbeitet?
Die mittels EmFACS erfassten Daten wurden über einen Kodierbogen in eine SPSS-Datei übertragen und anschließend statistisch ausgewertet.
- Quote paper
- Andrea Widmann (Author), 2011, Die Nutzung nonverbaler Kommunikation in der deutschen TV-Werbung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177567