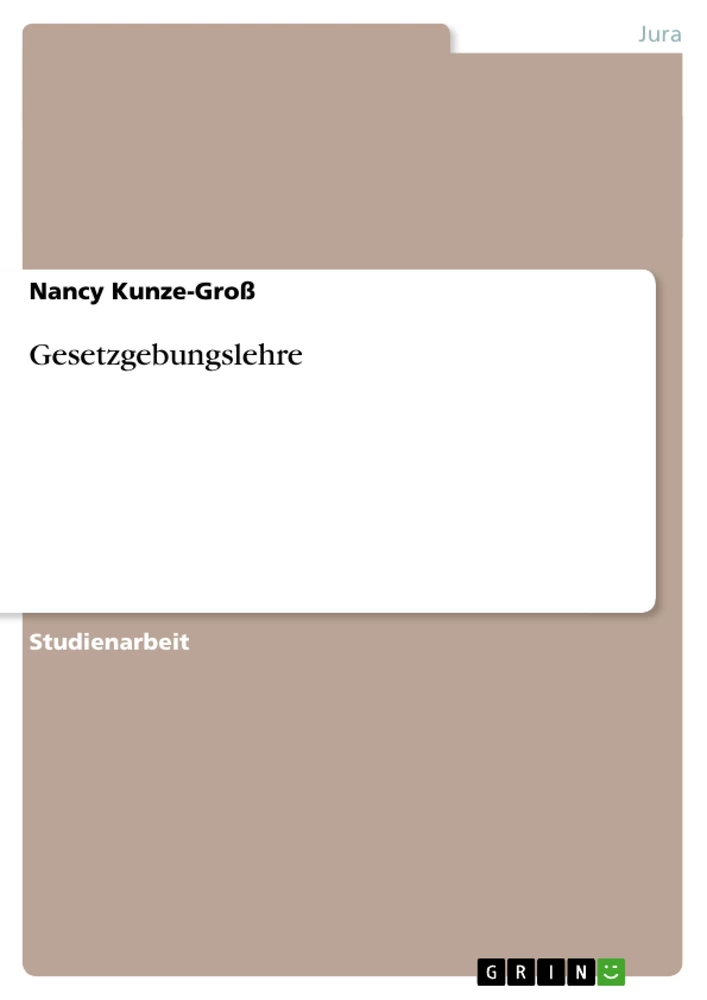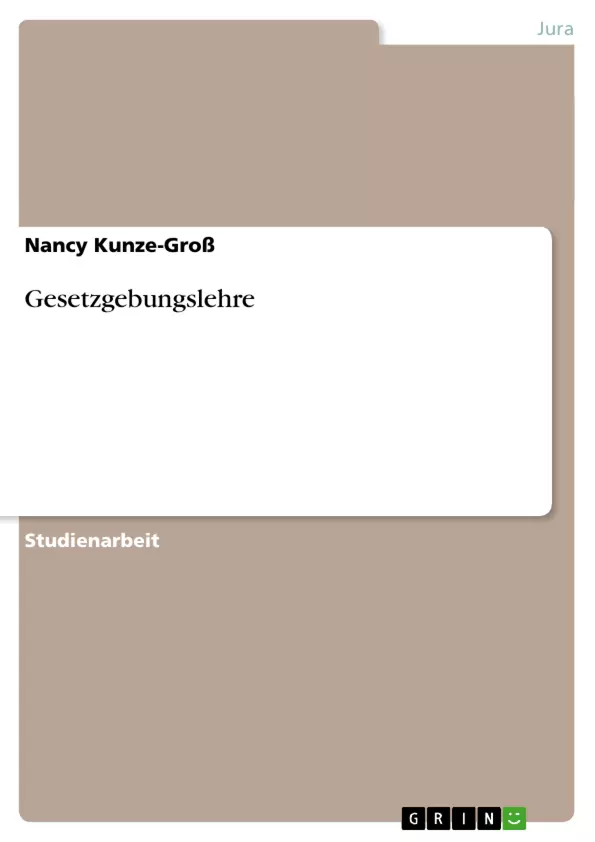In Deutschland entsteht neues Recht durch bewusste Satzung und nicht mehr primär habituell, also durch Gewohnheit. Der Grund dafür ist die Herausbildung eines institutionalisierten Gesetzgebungsverfahrens, die auf die Positivierung des Rechts beruht. Durch das Gewaltenteilungsprinzip des modernen Rechtsstaats wird die Rechtssetzung besonders in der Legislative, also der Gesetzgebung vollzogen, wie es der Name schon sagt. Zum kleinen Teil kommt Rechtssetzung aber auch in der Verwaltung in Form von Rechtsverordnungen und in der Rechtssprechung in Form von Richterrecht vor, obwohl diese Bereiche andere Aufgabenstellungen haben.
Obwohl die Rechtssoziologie das Recht als Ergebnis gesellschaftlicher
Prozesse ansieht und dadurch die gegenseitige Abhängigkeit von Recht
und Gesellschaft betrachtet, verwundert lange Zeit die Vernachlässigung der Untersuchung des institutionalisierten Gesetzgebungsverfahrens in der Legislative. Die Rechtssoziologie konzentrierte sich auf ein Gegenmodell, bei dem die Rechtssprechung auch im Regelfall konkretisierende Normen schafft und damit materielle Rechtssetzung betreibt. Daher wurde die Gesetzgebung lange im Forschungsbereich anderer Disziplinen (z.B. politische Soziologie, politische Wissenschaften) gesehen. Erst in den letzten 50 Jahren entwickelte sich eine Gesetzgebungswissenschaft, die als besonderer Zweig der Rechtssoziologie u.a. von Sinzheimer und Noll vertreten wurde.
1 Rehbinder, S. 220, Rn 190
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriff des Gesetzes
- Entstehung von Gesetzen
- Einleitung
- Bedingungen zur Mobilisierung des Gesetzgebers
- Zustandekommen eines Gesetzesinhalts
- Formaler Gang des Gesetzgebungsverfahrens
- Gesetzliche Regelungsformen
- Nachwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entstehung von Gesetzen in Deutschland und untersucht, wie das institutionalisierte Gesetzgebungsverfahren funktioniert. Dabei liegt der Fokus auf der Rechtssoziologie und dem "Gang des informellen Geschehens", der die Bedingungen und Akteure beleuchtet, die zur Mobilisierung des Gesetzgebers führen.
- Die Rolle des Gesetzgebers in der Gesellschaft
- Die Entstehung von Gesetzen aus rechtssoziologischer Perspektive
- Das formale Gesetzgebungsverfahren in Deutschland
- Die Bedeutung des informellen Geschehens für die Gesetzgebung
- Die Identifikation von Akteuren, die die Gesetzgebung beeinflussen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt die grundlegende Problematik dar, dass in Deutschland neues Recht durch bewusste Satzung und nicht mehr durch Gewohnheit entsteht. Sie führt die Herausbildung eines institutionalisierten Gesetzgebungsverfahrens und die Positivierung des Rechts ein. Außerdem wird die Rolle der Legislative bei der Rechtssetzung im modernen Rechtsstaat hervorgehoben.
2. Begriff des Gesetzes
Dieses Kapitel erläutert den Begriff des Gesetzes sowohl im materiellen als auch im formellen Sinne. Es wird zwischen abstrakten und generellen Rechtsvorschriften und konkreten Maßnahmen unterschieden, die durch Gesetze im formellen Sinne verabschiedet werden.
3. Entstehung von Gesetzen
3.1 Einleitung
Die Einleitung zum Kapitel "Entstehung von Gesetzen" stellt die Problematik dar, einen Mittelweg zwischen verschiedenen Perspektiven auf das Gesetzgebungsverfahren zu finden: formaler Ablauf, politisches Umfeld, Staats- und Gesetzgebungsfunktion sowie Studien zur Entstehung einzelner Gesetze.
3.2 Bedingungen zur Mobilisierung des Gesetzgebers
Dieses Unterkapitel beschäftigt sich mit den Bedingungen, unter denen der Gesetzgeber mobilisiert wird. Es wird betont, dass Gesetze nicht automatisch als Reaktion auf Probleme erlassen werden und bestimmte Akteure erforderlich sind, die einen gesetzlichen Regelungsbedarf artikulieren.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenschwerpunkte dieser Arbeit sind: Gesetzgebung, Rechtssoziologie, Gesetzgebungsverfahren, informelles Geschehen, Mobilisierung des Gesetzgebers, Akteure, formale Gesetzgebung, Rechtsetzung, Gesetzesbegriff, Rechtssprechung.
Häufig gestellte Fragen
Wie entsteht neues Recht in Deutschland?
Heute entsteht Recht primär durch bewusste Satzung in einem institutionalisierten Gesetzgebungsverfahren und nicht mehr durch Gewohnheit.
Was untersucht die Rechtssoziologie bei der Gesetzgebung?
Sie betrachtet das Recht als Ergebnis gesellschaftlicher Prozesse und untersucht insbesondere das informelle Geschehen hinter dem formalen Verfahren.
Was ist der Unterschied zwischen materiellem und formellem Gesetz?
Materielle Gesetze sind abstrakte Rechtsnormen, während formelle Gesetze alle Beschlüsse sind, die das Parlament im Gesetzgebungsverfahren verabschiedet.
Wann wird ein Gesetzgeber mobilisiert?
Mobilisierung erfolgt nicht automatisch; Akteure müssen einen Regelungsbedarf artikulieren und politischen Druck aufbauen, um das Verfahren einzuleiten.
Welche Rolle spielt die Rechtsprechung bei der Normsetzung?
Obwohl die Legislative primär zuständig ist, betreibt auch die Rechtsprechung durch Richterrecht faktisch materielle Rechtssetzung.
- Quote paper
- Nancy Kunze-Groß (Author), 2002, Gesetzgebungslehre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17757