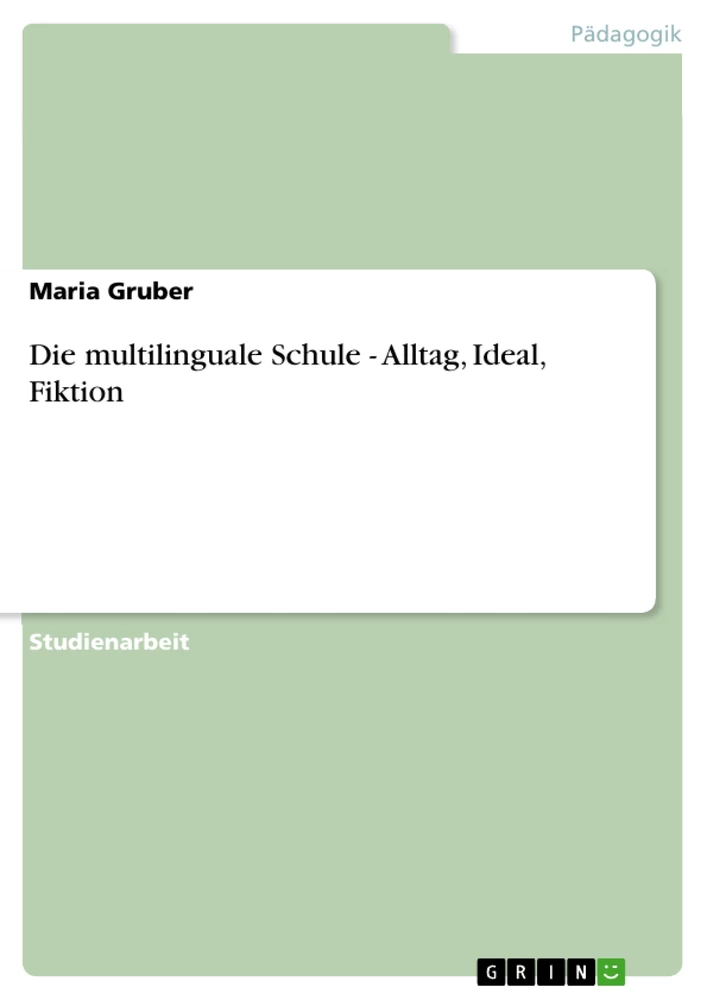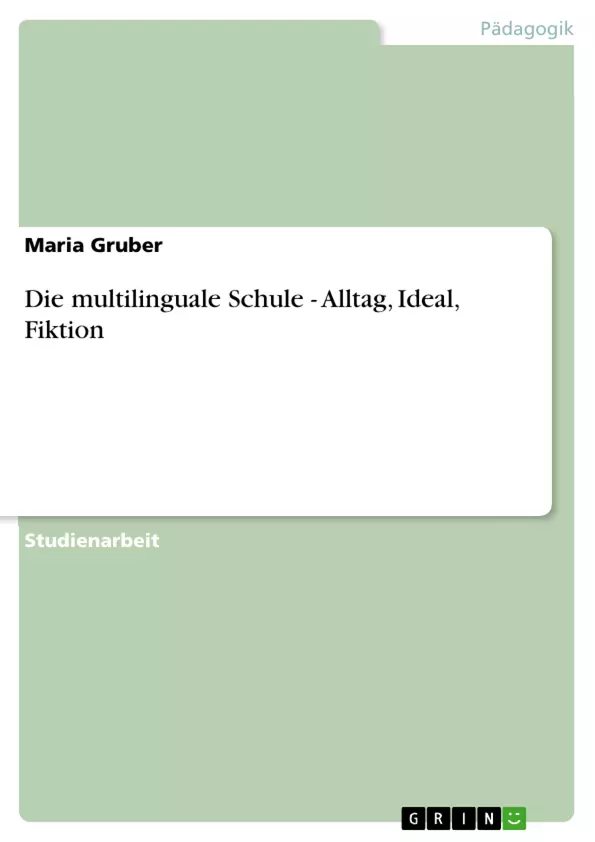Multilinguale Schulen stellen in der heutigen Welt, in der das Schlagwort ,,Globalisierung" und Verständigung über Sprachgrenzen hinweg Alltag geworden sind, eine Selbstverständ-lichkeit dar- so könnte man meinen. Dass sie jedoch eher selten vorkommen und traditionelle Modelle des Schulwesens vorherrschen, mag daher auf den ersten Blick verwundern. Im Folgenden soll die multilinguale Schule, die von vielen übersehen und häufig gar nicht in Betracht gezogen wird, ins Bewusstsein gerückt werden. Bevor jedoch näher auf die alltägli-che Praxis, Ideale und Fiktionen eingegangen wird, soll die Bedeutung ,,multilingual" in die-sem Zusammenhang kurz erläutert werden. ,,Multilingual" (und parallel dazu ,,plurilingual") bedeutet wörtlich zunächst nichts anderes als ,,mehrsprachig". (Kremnitz 1990, 38) In der heutigen, meistverbreiteten Sicht zählt dazu auch der Bilingualismus, also die Fähigkeit zwei Sprachen alternativ zu sprechen, wobei der Grad der Kompetenz dabei eine untergeordnete Rolle spielt. (a.a.O.: 22) Eine extreme Position im Sinne der Kompetenz erwähnt Braun, indem er Mehrsprachigkeit nur dann anerkennt, wenn sie die perfekte, angewendete Gleichbeherrschung mindestens zweier oder mehrerer Sprachen bezeichnet. (a.a.O.: 21) Ähnliches gilt für das Verständnis von Multilingualismus als eine Situation, bei der mehr als zwei Sprachen in einer Gesellschaft in Kontakt stehen. (a.a.O.: 38) Übergreifender ist "[...] die Definition von Bilingualismus als Fähigkeit des Indiviuduums, sich mit beiden Sprachgruppen zu identifizieren (Malmberg, 1973)." (Fthenakis u.a. 1985, 16) Auch wenn in etlichen Staaten keine offizielle Sprache gesetzlich festgelegt ist, so wird sie dennoch implizit vorausgesetzt. Dadurch, dass sie zugleich auch die Unterrichtssprache stellt, wird oft die Sprache von anderssprachigen Migranten ausgeblendet. (Kremnitz 1990, 88) Da Sprache jedoch eine der bewährtesten Methoden ist, ethnische Zusammengehörigkeit und Verschiedenheit zu markieren, erfüllt sie auch identitätsstiftende Funktionen. (Gogolin 1994, 14) Wird eine Sprache ausgeschlossen, bedeutet das für ihre Sprecher einen Angriff auf die eigene Identität.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Begriffsklärung „multilinguale Schule“.
- 2 Alltag, Ideale und Fiktionen der multilingualen Schule
- 2.1 Alltag
- 2.1.1 Negative Aspekte im multilingualen Schulalltag.
- 2.1.2 Positive Aspekte im multilingualen Schulalltag
- 2.2 Ideale
- 2.3 Fiktion
- 2.1 Alltag
- 3 Konsequenzen.
- Literatur..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Konzept der multilingualen Schule im Kontext der heutigen globalisierten Welt und analysiert die Diskrepanz zwischen Ideal, Realität und Fiktion in der Praxis.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „multilinguale Schule“
- Analyse des Alltags multilingualer Schulen, inklusive positiver und negativer Aspekte
- Diskussion von Idealvorstellungen und Fiktionen im Zusammenhang mit multilingualen Schulkonzepten
- Untersuchung der Folgen von multilingualen Schulmodellen
- Einbezug von Beispielen aus verschiedenen Ländern (Belgien, Kanada, Deutschland)
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel definiert den Begriff „multilinguale Schule“ und erläutert die unterschiedlichen Perspektiven auf Mehrsprachigkeit, insbesondere den Unterschied zwischen Bilingualismus und Multilingualismus.
Kapitel 2 befasst sich mit dem Alltag multilingualer Schulen und untersucht sowohl positive als auch negative Aspekte der Praxis. In diesem Zusammenhang werden verschiedene Beispiele aus Belgien, Kanada und Deutschland analysiert, die die Herausforderungen und Potenziale multilingualer Schulsysteme aufzeigen.
Schlüsselwörter
Multilinguale Schule, Mehrsprachigkeit, Bilingualismus, Globalisierung, Schulalltag, Ideale, Fiktionen, Sprachpolitik, Interkulturelle Kompetenz, Integration, Inklusion, Deutsch als Fremdsprache.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Bilingualismus und Multilingualismus?
Bilingualismus bezeichnet die Fähigkeit, zwei Sprachen zu sprechen. Multilingualismus (oder Mehrsprachigkeit) bezieht sich auf Situationen, in denen mehr als zwei Sprachen in Kontakt stehen oder von einem Individuum beherrscht werden.
Warum sind multilinguale Schulen trotz Globalisierung eher selten?
Oft herrschen traditionelle Schulmodelle vor, die eine offizielle Unterrichtssprache priorisieren und die Sprachen von Migranten im Lehrplan ausblenden.
Welche negativen Aspekte gibt es im multilingualen Schulalltag?
Probleme können durch die Ausgrenzung von Herkunftssprachen entstehen, was als Angriff auf die Identität der Sprecher empfunden werden kann, sowie durch organisatorische Überforderung des Systems.
Welche Länderbeispiele werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit analysiert Beispiele aus Belgien, Kanada und Deutschland, um unterschiedliche Ansätze und Herausforderungen multilingualer Schulmodelle aufzuzeigen.
Wie hängen Sprache und ethnische Identität zusammen?
Sprache ist ein zentrales Merkmal zur Markierung ethnischer Zusammengehörigkeit. Die Anerkennung oder Ablehnung einer Sprache in der Schule beeinflusst maßgeblich die Identitätsbildung der Schüler.
- Quote paper
- M.A. Maria Gruber (Author), 2005, Die multilinguale Schule - Alltag, Ideal, Fiktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177624