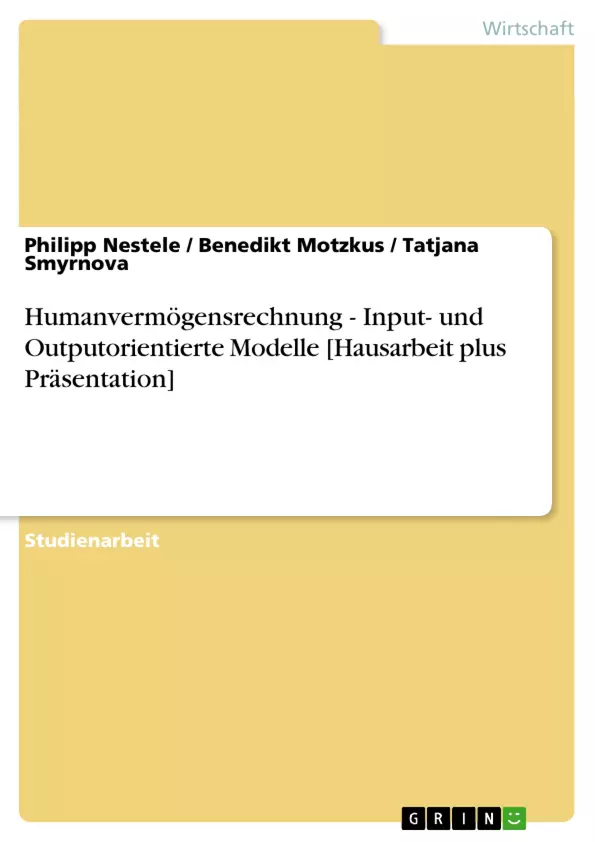Im koalitionstheoretischen Ansatz der Unternehmenstheorie wird ein Unternehmen als Koalition verschiedener Unternehmensbeteiligter dargestellt. Diese Koalitionäre erwarten aus ihrer Beteiligung am Unternehmen Anreize (Nutzenzugänge) und sind im Gegenzug bereit, dafür entsprechende Beiträge (Nutzenabgänge) zu leisten. Die Koalitionsteilnehmer verstehen somit ein Unternehmen als Instrument zur Erreichung ihrer individuellen Nutzenoptima, welche durch das Zusammenwirken sämtlicher in einem Unternehmen organisierten Ressourcen erzielt werden sollen. Sowohl die Unternehmensführung als auch die übrigen Unternehmensbeteiligten benötigen daher Informationen, aus denen hervorgeht, in welchem Maße die jeweiligen Ressourcen wie zu Nutzenerzielungen in der Vergangenheit beigetragen haben bzw. in der Zukunft beitragen werden.
Zu diesen an der Nutzenerzielung beteiligten Ressourcen eines Unternehmens gehören auch die menschlichen Ressourcen. Als menschliche Ressourcen können z.B. menschliche Kenntnisse, Fähigkeiten, Einstellungen, Bedürfnisse oder Erwartungen bezeichnet werden. Diese menschlichen Ressourcen unterliegen ebenso wie die anderen (sachlichen) Ressourcen dem Informationsinteresse aller Unternehmensbeteiligter. Nach einer häufig vertretenen Ansicht enthält das Rechnungswesen der Unternehmen jedoch weniger Informationen über die menschlichen als über die sachlichen Unternehmensressourcen. Diese ungleiche Berücksichtigung der Informationen führte zu einer bislang etwas einseitigen Forschungsrichtung der Betriebswirtschaftslehre. Als praktisch normative Wissenschaft beschäftigte sie sich in ihrem Bemühen um die Entwicklung von Methoden und Modellen zur Stützung von Entscheidungssituationen der Entscheidungspraxis in Unternehmen mehr mit der modellhaften Erfassung der sachlichen Ressourcen als mit den menschlichen Ressourcen eines Unternehmens. Diese beiden Sachverhalte sind seit etwa Anfang der sechziger Jahre als Lücke im Rechnungswesen der Unternehmen von amerikanischen Soziologen und Rechnungswesenfachleuten erkannt worden. Seit jenem Zeitpunkt werden die Bestrebungen zur Schließung dieser Lücken unter dem Stichwort Human Resource Accounting (bzw. Human Asset Accounting oder Human Resource Measurement) diskutiert, unter welchem die Erfassung der menschlichen Ressourcen bzw. des Humanvermögens der Unternehmen im Rechnungswesen verstanden wird.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen des Humanvermögens
- Begriff des Humanvermögens
- Entwicklung des Humanvermögengedankens
- Bedeutung des Humanvermögens
- Ziele und Aufgaben der Humanvermögensrechnung
- Einzel- und gesamtwirtschaftliche Aspekte
- Bedeutung des Faktors Arbeit
- Stellenwert der Humanvermögensrechnung im Unternehmen
- Konzept des Human Resource Accounting
- Inputorientierte Modelle (Human Resource Cost Accounting)
- Bewertung des Humanvermögens auf der Basis von Anschaffungskosten
- Bewertung des Humanvermögens auf der Basis von Wiederbeschaffungskosten
- Bewertung des Humanvermögens auf der Basis von Opportunitätskosten
- Bewertung des Humanvermögens auf der Basis von Fluktuationskosten
- Bewertung des Humanvermögens auf der Basis von effizienzgewichteten Personalkosten
- Outputorientierte Modelle (Human Resource Value Accounting)
- Firmenwertmethode
- Bewertung des Humanvermögens mit zukünftigen Leistungsbeiträgen
- Bewertung des Humanvermögens über Verhaltensvariablen
- Stärken und Schwächen des Human Resource Accounting
- Stärken und Schwächen der inputorientierten Modelle
- Stärken und Schwächen der outputorientierten Modelle
- Humanvermögensrechnung in der Praxis
- Anwendungsmöglichkeiten in der betrieblichen Praxis
- Grenzen der praktischen Anwendung
- Berechnungsbeispiel
- Schlussfolgerung und Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Übungsarbeit befasst sich mit dem Konzept der Humanvermögensrechnung und analysiert sowohl input- als auch outputorientierte Modelle zur Bewertung des Humanvermögens. Die Arbeit zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis für die Bedeutung des Humanvermögens im Unternehmenskontext zu entwickeln und die verschiedenen Ansätze zur Messung und Bewertung des Humanvermögens aufzuzeigen.
- Das Konzept des Humanvermögens und seine Entwicklung
- Die Bedeutung des Humanvermögens für Unternehmenserfolg und Wettbewerbsfähigkeit
- Inputorientierte Modelle der Humanvermögensrechnung (Human Resource Cost Accounting)
- Outputorientierte Modelle der Humanvermögensrechnung (Human Resource Value Accounting)
- Stärken und Schwächen der verschiedenen Modelle sowie deren praktische Anwendung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Grundlagen des Humanvermögens: Dieses Kapitel behandelt den Begriff des Humanvermögens, seine Entstehung und Bedeutung in der heutigen Wirtschaft. Es wird zudem auf die Herausforderungen der traditionellen Bilanzierung von Humanvermögen eingegangen.
- Kapitel 2: Ziele und Aufgaben der Humanvermögensrechnung: Das Kapitel erläutert die Ziele und Aufgaben der Humanvermögensrechnung, sowohl aus einzelwirtschaftlicher als auch aus gesamtwirtschaftlicher Sicht. Es befasst sich außerdem mit dem Stellenwert der Humanvermögensrechnung im Unternehmenskontext.
- Kapitel 3: Konzept des Human Resource Accounting: Dieses Kapitel stellt das Konzept des Human Resource Accounting vor und differenziert zwischen input- und outputorientierten Modellen. Es bietet eine detaillierte Beschreibung verschiedener Bewertungsmethoden für Humanvermögen, sowohl im Input- als auch im Outputbereich.
- Kapitel 4: Stärken und Schwächen des Human Resource Accounting: In diesem Kapitel werden die Stärken und Schwächen sowohl der input- als auch der outputorientierten Modelle im Detail analysiert. Es werden die Vor- und Nachteile der jeweiligen Ansätze in Bezug auf ihre Anwendbarkeit und Aussagekraft beleuchtet.
- Kapitel 5: Humanvermögensrechnung in der Praxis: Dieses Kapitel befasst sich mit den Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen der Humanvermögensrechnung in der betrieblichen Praxis. Es werden konkrete Beispiele und Berechnungsmethoden dargestellt, um die praktische Anwendung der verschiedenen Modelle zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Humanvermögensrechnung, Human Resource Accounting, Inputorientierte Modelle, Outputorientierte Modelle, Anschaffungskosten, Wiederbeschaffungskosten, Opportunitätskosten, Fluktuationskosten, Firmenwertmethode, zukünftige Leistungsbeiträge, Verhaltensvariablen, Stärken und Schwächen, praktische Anwendung, Berechnungsbeispiel.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Humanvermögensrechnung (Human Resource Accounting)?
Es ist die Erfassung und Bewertung der menschlichen Ressourcen (Kenntnisse, Fähigkeiten) eines Unternehmens im Rechnungswesen.
Was ist der Unterschied zwischen input- und outputorientierten Modellen?
Inputmodelle bewerten Kosten (z.B. Anschaffung, Training), während Outputmodelle den künftigen Wertbeitrag der Mitarbeiter schätzen.
Welche Rolle spielen Opportunitätskosten in der Personalbewertung?
Sie messen den Wert eines Mitarbeiters anhand des Nutzens, der entgeht, wenn er an einer anderen Stelle im Unternehmen nicht eingesetzt werden kann.
Was ist die Firmenwertmethode?
Ein outputorientiertes Modell, das versucht, den Anteil des Humankapitals am gesamten Marktwert eines Unternehmens zu berechnen.
Warum wird Humanvermögen selten in Bilanzen ausgewiesen?
Gründe sind rechtliche Einschränkungen, die schwierige Messbarkeit und die Tatsache, dass Mitarbeiter nicht Eigentum des Unternehmens sind.
- Arbeit zitieren
- Philipp Nestele (Autor:in), Benedikt Motzkus (Autor:in), Tatjana Smyrnova (Autor:in), 2002, Humanvermögensrechnung - Input- und Outputorientierte Modelle [Hausarbeit plus Präsentation], München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17762

![Titel: Humanvermögensrechnung - Input- und Outputorientierte Modelle [Hausarbeit plus Präsentation]](https://cdn.openpublishing.com/thumbnail/products/17762/large.webp)