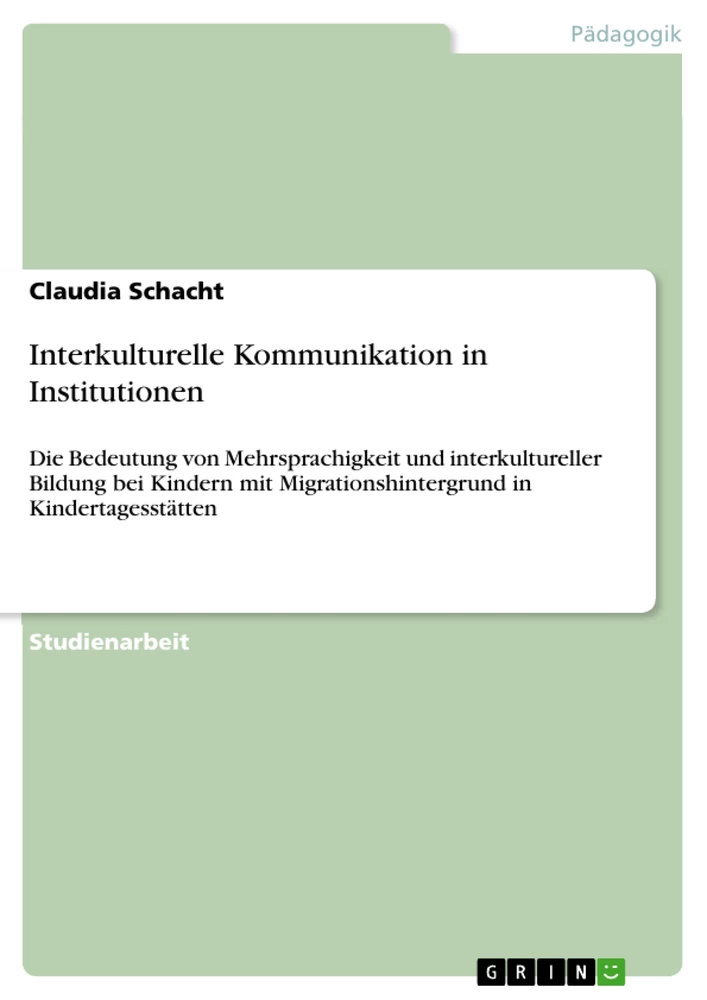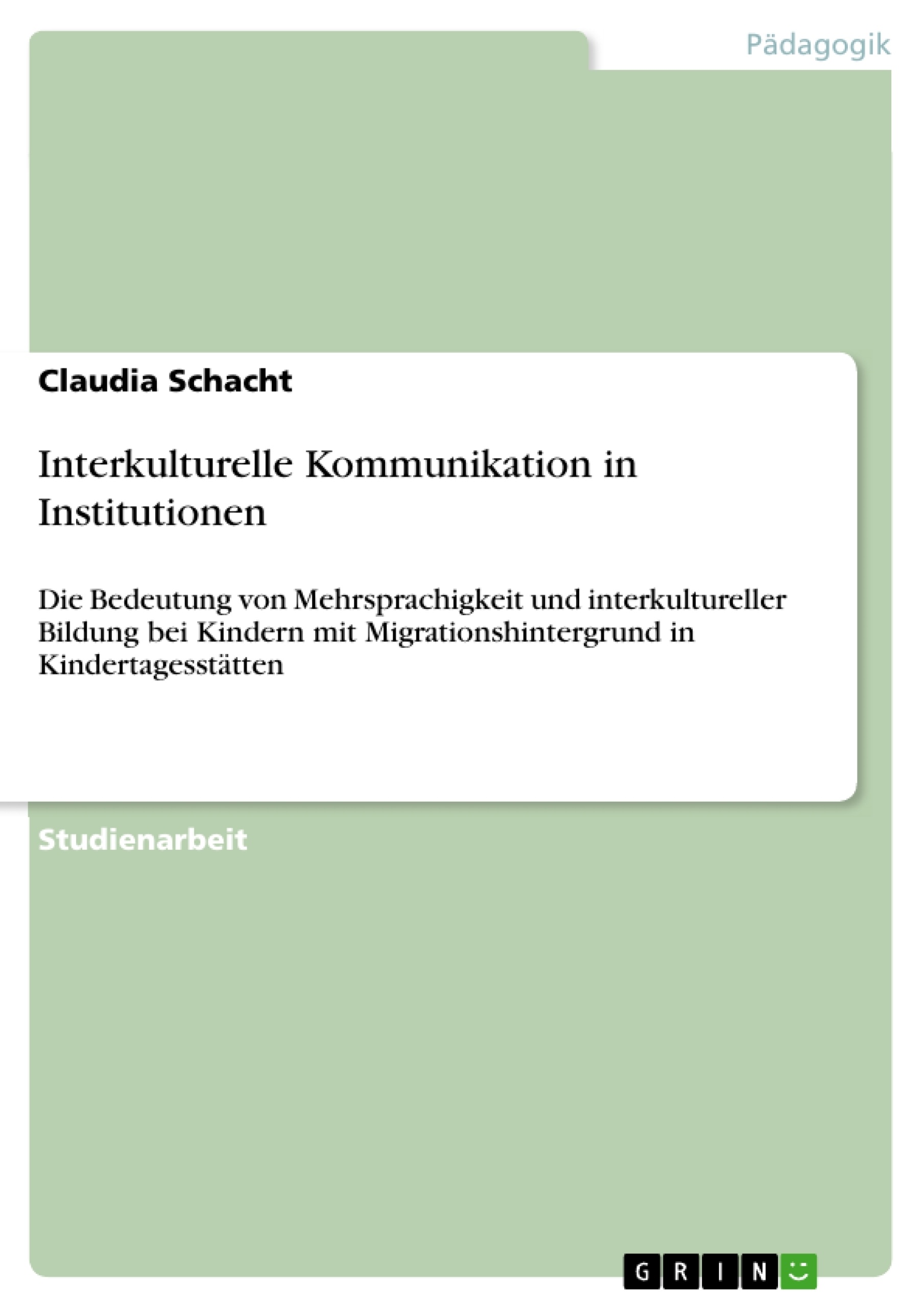In der deutschen Bildungsdiskussion ist die Integration und Förderung ausländischer Kinder ein zentrales Thema – insbesondere nach der PISA-Studie 2001, die Defizite im deutschen Bildungssystem im Hinblick auf den Ausgleich sozialer Unterschiede und die Bildungsbeteiligung von Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund auf-gezeigt hat. Vor allem die Sprachdefizite von Migrantenkindern in der deutschen Sprache werden hervorgehoben. Während Mehrsprachigkeit einerseits als wichtige Kompetenz anerkannt wird, sieht es bei der Erziehung von Kindern mit Migrationshin-tergrund anders aus: In der Regel werden nicht die spezifischen mehrsprachigen und interkulturellen Entwicklungsprofile gesehen, sondern die Mehrsprachigkeit dieser Kinder wird problemorientiert betrachtet und eher als Belastung im Kindergartenalltag empfunden.
Diese Arbeit setzt sich mit dem Thema Mehrsprachigkeit bei Kindern mit Migrations-hintergrund und der Bedeutung von interkultureller Bildung in Kindertagesstätten auseinander. Es soll insbesondere auf die Probleme hingewiesen werden, die so-wohl für die Kinder in den Tagesstätten als auch für die Institutionen bestehen. In diesem Zusammenhang muss auch auf die Rolle der pädagogischen Fachkräfte und auf die besondere und wichtige Rolle der Muttersprache aufmerksam gemacht wer-den.
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel:
Im ersten Kapitel erfolgt eine kurze Erläuterung zur Entstehung von Mehrsprachigkeit in Deutschland sowie eine Definition zum Begriff Mehrsprachigkeit.
Im zweiten Abschnitt erfolgt ein Überblick über die Bedeutung der Muttersprache und die Mehrsprachigkeit – zum einen für die Kinder mit Migrationshintergrund und zum anderen für die Kindertageseinrichtung. Anschließend wird die Interdependenz- Hypothese vorgestellt, die einen wichtigen Beitrag zur Annerkennung der Mutter-sprache von Kindern mit Migrationshintergrund geleistet hat.
Im dritten Abschnitt werden interkulturelle Aspekte in der Kindertageseinrichtung dar-gestellt – insbesondere Aspekte zur interkulturellen Bildung.
Im letzten Kapitel erfolgt ein Überblick über aktuelle Maßnahmen der Politik zur Sprachförderung speziell in Niedersachsen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mehrsprachigkeit – Entwicklung und Definition
- Entstehung
- Zur Begriffsdefinition „Mehrsprachigkeit"
- Aspekte zur Mehrsprachigkeit in Kindertagesstätten
- Die Bedeutung der Muttersprache
- Die Bedeutung von Mehrsprachigkeit in der Kindertagesstätte
- Interdependenz-Hypothese
- Interkulturelle Aspekte in Kindertagesstätten
- Interkulturelle Kommunikation in Kindertagesstätten
- Interkulturelle Bildung in Kindertagesstätten
- Aktuelle Maßnahmen der Politik zur Sprachförderung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Mehrsprachigkeit von Kindern mit Migrationshintergrund und der Bedeutung von interkultureller Bildung in Kindertagesstätten. Sie untersucht die Herausforderungen, denen diese Kinder und die Einrichtungen gegenüber stehen, und hebt die Rolle der pädagogischen Fachkräfte sowie die besondere Wichtigkeit der Muttersprache hervor.
- Die Entstehung und Definition von Mehrsprachigkeit in Deutschland
- Die Bedeutung der Muttersprache und Mehrsprachigkeit für Kinder mit Migrationshintergrund und Kindertagesstätten
- Interkulturelle Kommunikation und Bildung in Kindertagesstätten
- Aktuelle politische Maßnahmen zur Sprachförderung
- Die Bedeutung der Muttersprache für die sprachliche Entwicklung von Kindern mit Migrationshintergrund
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Entstehung von Mehrsprachigkeit in Deutschland, ausgehend vom Zuzug von ausländischen Arbeitskräften und ihren Familien in den 1960er Jahren. Es werden die frühen bildungspolitischen Ansätze zur Integration von Kindern mit Migrationshintergrund und die Bedeutung der Muttersprache diskutiert.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Bedeutung der Muttersprache und der Mehrsprachigkeit in Kindertagesstätten. Es werden sowohl die Vorteile für Kinder mit Migrationshintergrund als auch die Herausforderungen für die Einrichtung beleuchtet. Die Interdependenz-Hypothese wird vorgestellt, die die Bedeutung der Muttersprache für die Entwicklung der Zweitsprache unterstreicht.
Das dritte Kapitel widmet sich interkulturellen Aspekten in Kindertagesstätten, mit Fokus auf interkulturelle Kommunikation und Bildung. Es werden wichtige Ansätze und Herausforderungen für die interkulturelle Arbeit in diesen Einrichtungen erläutert.
Schlüsselwörter
Mehrsprachigkeit, interkulturelle Kommunikation, interkulturelle Bildung, Kinder mit Migrationshintergrund, Muttersprache, Sprachförderung, Kindertagesstätten, Integration, PISA-Studie, Interdependenz-Hypothese.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Interdependenz-Hypothese?
Diese Hypothese besagt, dass eine gute Entwicklung der Muttersprache die Basis für den erfolgreichen Erwerb einer Zweitsprache (z.B. Deutsch) bildet.
Warum wird Mehrsprachigkeit oft als Problem gesehen?
In vielen Bildungseinrichtungen liegt der Fokus einseitig auf Defiziten im Deutschen, statt die mehrsprachige Kompetenz als wertvolle Ressource anzuerkennen.
Welche Rolle spielen pädagogische Fachkräfte bei der Integration?
Erzieher müssen interkulturelle Kompetenzen besitzen, um auf die spezifischen Bedürfnisse von Kindern mit Migrationshintergrund einzugehen und Vorurteile abzubauen.
Was bedeutet interkulturelle Bildung in der Kita?
Es geht darum, Vielfalt als Normalität zu begreifen, kulturelle Unterschiede wertschätzend zu behandeln und allen Kindern gleiche Bildungschancen zu ermöglichen.
Welche Maßnahmen zur Sprachförderung gibt es in Niedersachsen?
Die Arbeit gibt einen Überblick über aktuelle politische Programme, die speziell darauf abzielen, die Sprachkompetenz vor dem Schuleintritt zu stärken.
Wie beeinflusste die PISA-Studie 2001 die Bildungsdiskussion?
PISA deckte auf, dass das deutsche Schulsystem soziale Unterschiede und Migrationshintergründe nur unzureichend ausgleicht, was zu einem Umdenken in der Sprachförderung führte.
- Arbeit zitieren
- Claudia Schacht (Autor:in), 2007, Interkulturelle Kommunikation in Institutionen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177750