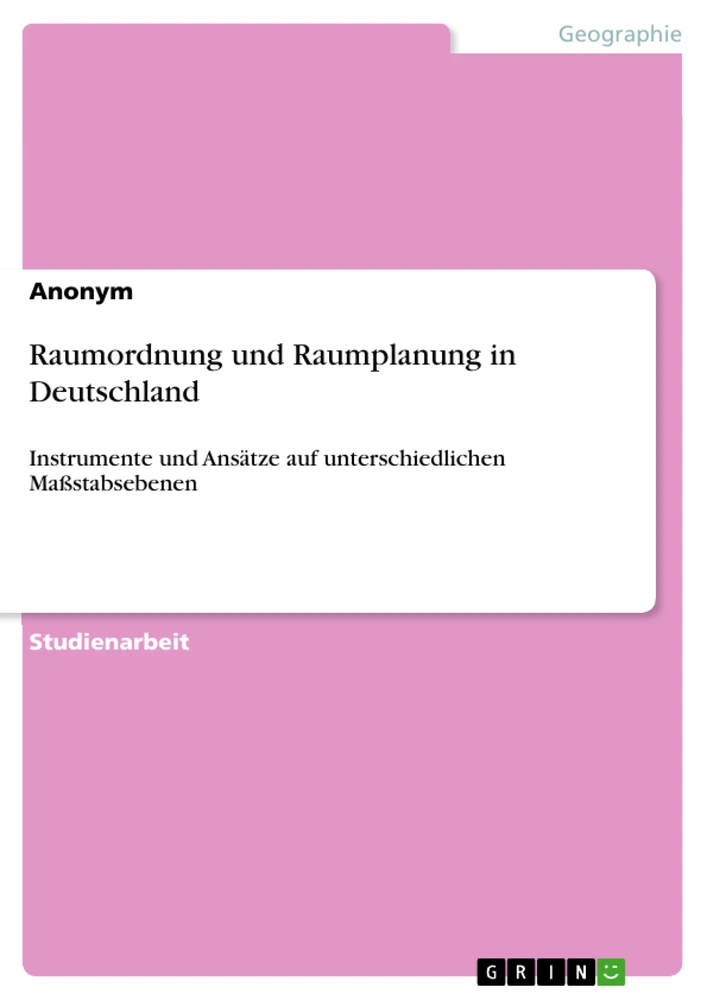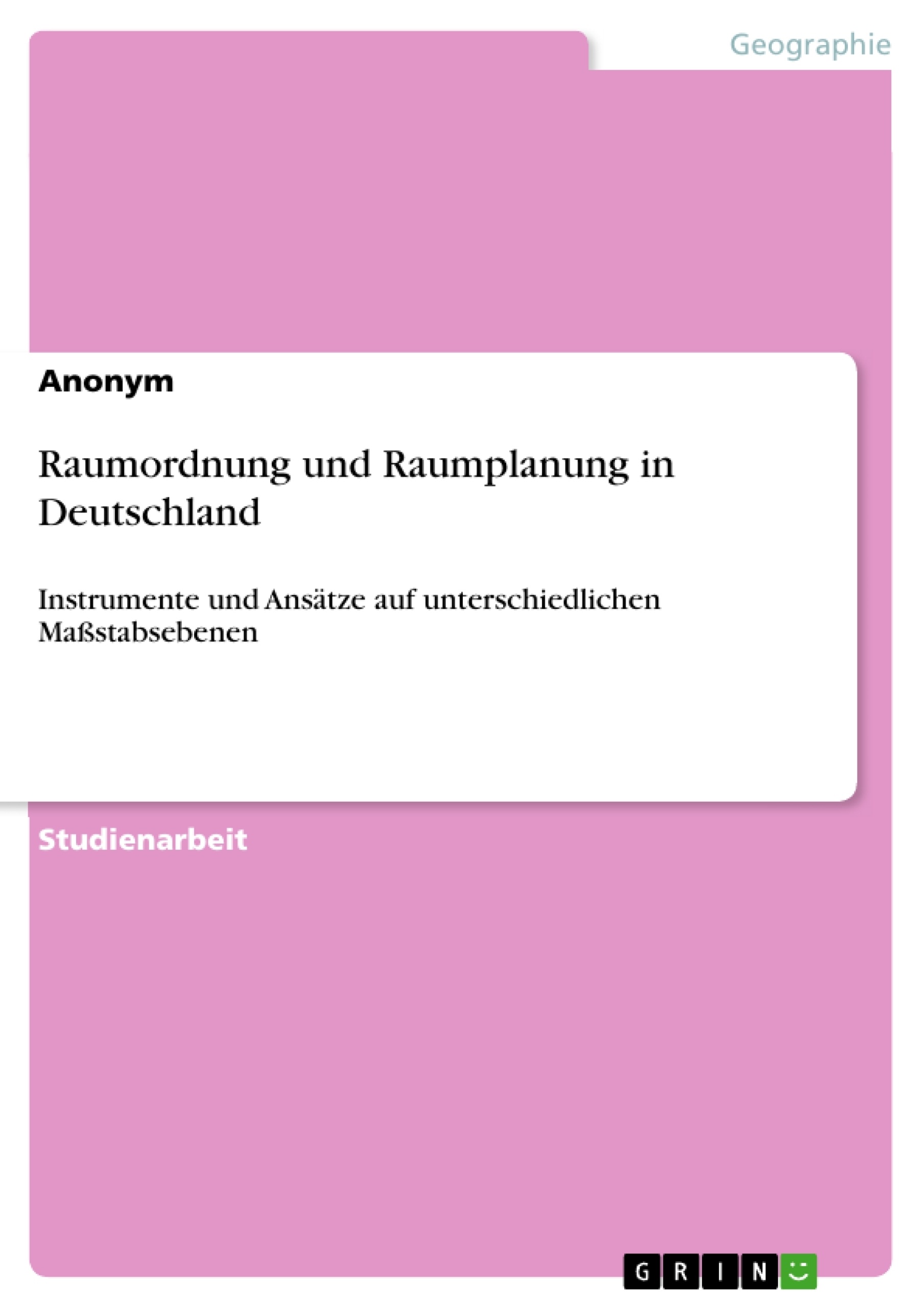Eine einheitliche Definition für den Begriff Raumordnung gibt es bis heute nicht, allerdings ist man sich einig, „[dass] die Raumordnung mit der großräumigen, über das Gebiet einer Gemeinde hinausgehenden Planung verbunden ist“ (Brenken/Schefer 1966:178).
Folglich beschäftigt die Raumordnung Deutschlands nicht nur den Bund sondern ebenso alle Länder, Regierungsbezirke und Kommunen. Alle Beteiligten müssen miteinander kooperieren um die Forderung des Grundgesetztes „[…] nach Wahrung der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse über das Gebiet eines Landes hinaus“ gewährleisten zu können (BMRBS 1996:3-9).
Jeder Bewohner Deutschlands kommt täglich mit der Raumordnung in Berührung, sei es auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder beim Besuch der Schule. Die Infrastruktur, die Bereiche Arbeiten, Wohnen und Freizeit müssen unter Berücksichtigung der Umwelt von planerischer Hand so miteinander verknüpft werden, dass Funktionalität, Nachhaltigkeit und Gleichwertigkeit in allen Regionen sichergestellt werden (BMRBS 1996:3-9).
Ziel dieser Hausarbeit ist es einen Einblick in die Raumordnung Deutschlands zu geben. Es werden zunächst geschichtliche Hintergründe und Grundsätzliches über die Raumordnung in Deutschland behandelt. Anschließend wird die Struktur näher betrachtet und aktuelle Entwicklungen vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Überblick Raumordnung
- 2.1 Historische Entwicklung
- 2.2 Aufgaben und Ziele
- 3 Struktur der Raumordnung in Deutschland
- 3.1 Raumplanung auf Bundesebene
- 3.2 Raumplanung auf Landesebene
- 3.3 Raumplanung auf regionaler Ebene
- 3.4 Raumplanung auf kommunaler Ebene
- 4 Instrumente der Raumordnung
- 5 Aktuelle Entwicklungen
- 6 Fazit
- 7 Summary
- 8 Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit bietet einen Einblick in die Raumordnung Deutschlands. Die Arbeit behandelt zunächst die historischen Hintergründe und grundlegenden Prinzipien der Raumordnung. Anschließend wird die Struktur der Raumordnung auf verschiedenen Ebenen detailliert betrachtet und aktuelle Entwicklungen werden vorgestellt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Verknüpfung von Raumordnung mit verschiedenen politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Aspekten.
- Historische Entwicklung der Raumordnung in Deutschland
- Aufgaben und Ziele der Raumordnung
- Struktur der Raumordnung auf verschiedenen Ebenen (Bund, Länder, Regionen, Kommunen)
- Instrumente der Raumordnung
- Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Raumordnung in Deutschland ein und stellt fest, dass es keine einheitliche Definition gibt, aber die Raumordnung mit großräumiger Planung über Gemeindegrenzen hinaus verbunden ist. Sie betont die Kooperation zwischen Bund, Ländern und Kommunen zur Gewährleistung einheitlicher Lebensverhältnisse und den täglichen Bezug jedes Bürgers zur Raumordnung durch Infrastruktur und die Verknüpfung von Arbeit, Wohnen und Freizeit unter Berücksichtigung der Umwelt. Das Ziel der Hausarbeit ist es, einen Einblick in die Raumordnung Deutschlands zu geben, indem historische Hintergründe, grundlegende Prinzipien, die Struktur und aktuelle Entwicklungen behandelt werden.
2 Überblick Raumordnung: Dieses Kapitel beschreibt Raumordnung als Planung des menschlichen Lebensraums, beeinflusst vom Prinzip der zentralen Orte (Christaller) zur optimalen Anordnung von Produktions- und Konsumstandorten. Es betont die Rolle der Nachhaltigkeit in der Raumordnung, die zukünftige Generationen berücksichtigt, und gliedert die Umsetzung in drei Schritte: Planung, Entscheidung und Umsetzung.
2.1 Historische Entwicklung: Dieser Abschnitt beschreibt die Intensivierung der Raumplanung nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Die Schwierigkeiten bei der Überführung der Reichsgesetzgebung in Bundesrecht aufgrund des zentralistischen Ansatzes und des föderalistischen Grundgesetzes werden erläutert. Die anfängliche sektorale Planung in Ministerien und die spätere Gründung des Sachverständigenaussausschusses für Raumordnung (SARO) mit der Entwicklung des Raumordnungsgesetzes (1962) werden hervorgehoben. Der Abschnitt beleuchtet auch den Wandel nach der Wiedervereinigung, die Privatisierung staatlicher Aufgaben und den Übergang vom Fordismus zum Postfordismus, der Anpassungen in der Raumordnung erforderte. Die Rolle der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) und die Verabschiedung des Raumordnungspolitischen Orientierungsrahmens (ORA) und des Raumordnungspolitischen Handlungsrahmens (HARA) werden ebenfalls thematisiert.
2.2 Aufgaben und Ziele: Dieser Abschnitt beschreibt die Aufgaben der Raumordnung, darunter die optimale Entwicklung des Bundesgebietes unter Berücksichtigung verschiedener Raumstrukturen und -typen, die Schaffung räumlicher Voraussetzungen für europäische Zusammenarbeit und die Stärkung der dezentralen Siedlungsstruktur. Es werden die im Raumordnungsgesetz festgehaltenen Grundsätze erläutert, wie die Förderung und Sicherung von Raumstrukturen und die Angleichung der Lebensbedingungen in allen Gebieten.
Schlüsselwörter
Raumordnung, Raumplanung, Deutschland, Bundesebene, Landesebene, regionale Ebene, kommunale Ebene, historische Entwicklung, Aufgaben, Ziele, Instrumente, Nachhaltigkeit, zentrale Orte, dezentrale Siedlungsstruktur, Raumordnungsgesetz, aktuelle Entwicklungen.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Raumordnung in Deutschland
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Raumordnung in Deutschland. Sie behandelt die historische Entwicklung, die Aufgaben und Ziele der Raumordnung, ihre Struktur auf verschiedenen Ebenen (Bund, Länder, Regionen, Kommunen) sowie die verwendeten Instrumente und aktuelle Entwicklungen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Verknüpfung von Raumordnung mit politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Aspekten.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Hausarbeit deckt folgende Themen ab: Historische Entwicklung der Raumordnung in Deutschland, Aufgaben und Ziele der Raumordnung, Struktur der Raumordnung auf verschiedenen Ebenen (Bund, Länder, Regionen, Kommunen), Instrumente der Raumordnung, Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen der Raumordnung. Es wird auch auf das Prinzip der zentralen Orte (Christaller) und die Bedeutung von Nachhaltigkeit eingegangen.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von einem Überblick über die Raumordnung, einer detaillierten Betrachtung der Struktur auf verschiedenen Ebenen, einer Beschreibung der Instrumente der Raumordnung und den aktuellen Entwicklungen. Sie schließt mit einem Fazit und einem Summary ab. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung.
Welche Rolle spielt die Geschichte der Raumordnung in Deutschland?
Die historische Entwicklung wird ausführlich dargestellt, beginnend mit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und den Herausforderungen bei der Überführung der Reichsgesetzgebung in Bundesrecht. Die Gründung des Sachverständigenausschusses für Raumordnung (SARO) und die Entwicklung des Raumordnungsgesetzes (1962) werden ebenso behandelt wie der Wandel nach der Wiedervereinigung, die Privatisierung staatlicher Aufgaben und der Übergang vom Fordismus zum Postfordismus.
Welche Aufgaben und Ziele verfolgt die Raumordnung in Deutschland?
Die Raumordnung zielt auf die optimale Entwicklung des Bundesgebietes unter Berücksichtigung verschiedener Raumstrukturen und -typen ab. Sie soll räumliche Voraussetzungen für europäische Zusammenarbeit schaffen und eine dezentrale Siedlungsstruktur stärken. Wichtige Grundsätze sind die Förderung und Sicherung von Raumstrukturen und die Angleichung der Lebensbedingungen in allen Gebieten, wie im Raumordnungsgesetz festgehalten.
Welche Ebenen sind an der Raumordnung beteiligt?
Die Raumordnung in Deutschland umfasst die Bundesebene, die Landesebene, die regionale Ebene und die kommunale Ebene. Die Hausarbeit beschreibt die jeweiligen Aufgaben und Verantwortlichkeiten auf diesen Ebenen.
Welche Instrumente werden in der Raumordnung eingesetzt?
Die Hausarbeit erwähnt die Instrumente der Raumordnung, jedoch ohne detaillierte Beschreibungen. Diese sind Gegenstand weiterer Forschung und werden in späteren Kapiteln näher erläutert.
Welche aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen werden diskutiert?
Die Hausarbeit thematisiert aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen der Raumordnung, ohne konkrete Beispiele zu nennen. Diese werden im Detail in entsprechenden Kapiteln behandelt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Raumordnung, Raumplanung, Deutschland, Bundesebene, Landesebene, regionale Ebene, kommunale Ebene, historische Entwicklung, Aufgaben, Ziele, Instrumente, Nachhaltigkeit, zentrale Orte, dezentrale Siedlungsstruktur, Raumordnungsgesetz, aktuelle Entwicklungen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2009, Raumordnung und Raumplanung in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177793