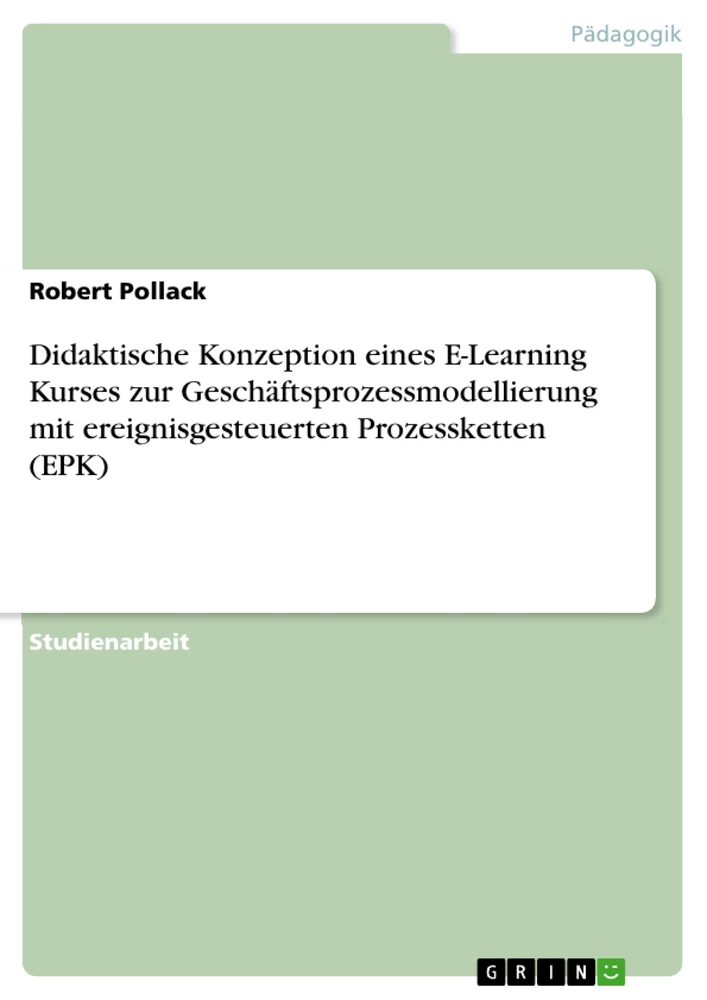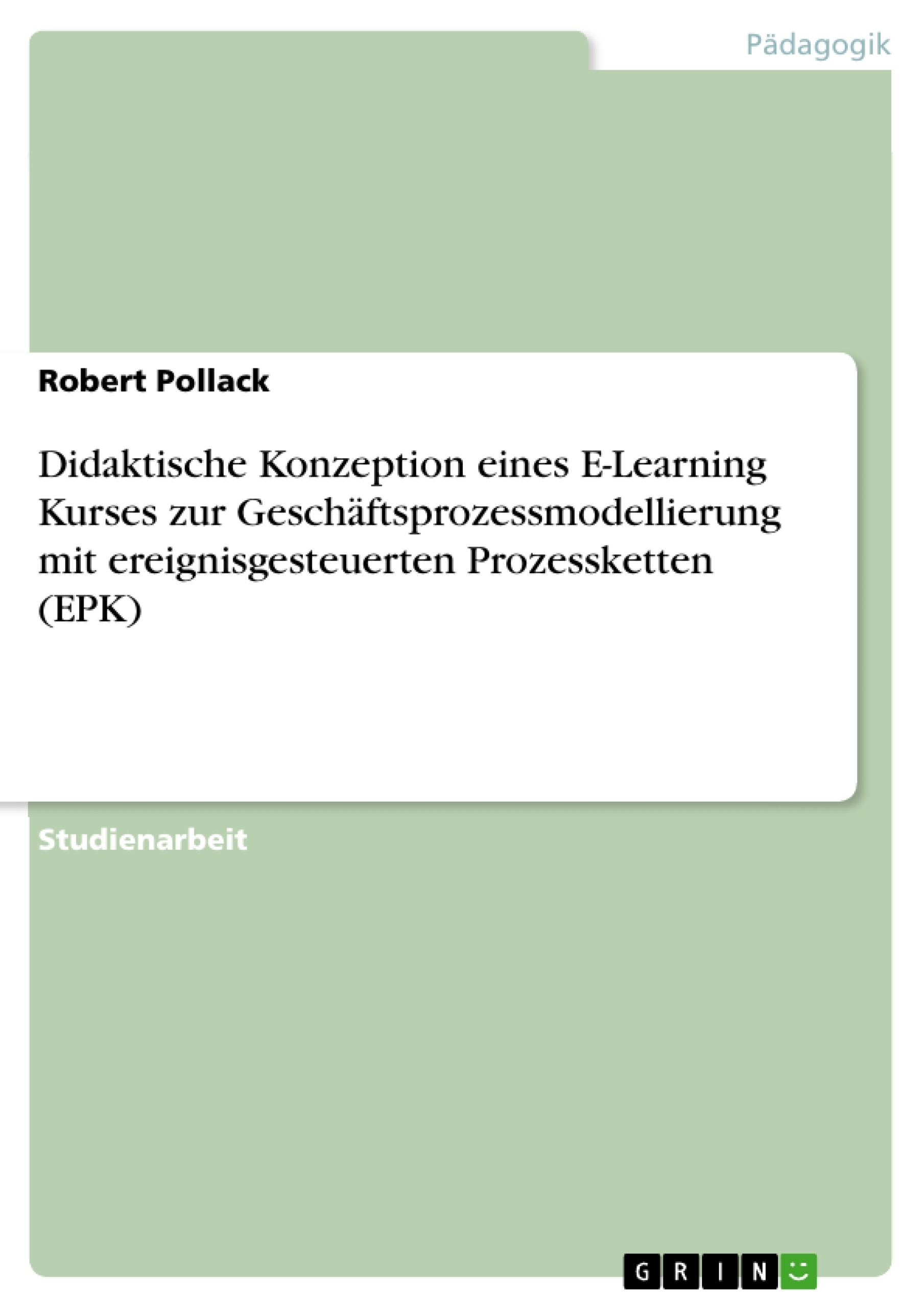Geschäftsprozessmodellierung stellt ein wichtiges Thema, sowohl im Bereich der Entwicklung betrieblicher Anwendungssysteme, als auch des Business Process Reengineering und der Geschäftsprozessoptimierung dar. Daraus folgt der Bedarf nach Fachkräften, die in diesem Bereich entsprechende Kompetenzen und Fähigkeiten besitzen. Daher soll untersucht werden, wie eine Konzeption einer virtuellen Lernumgebung zur Erlangung dieser Kompetenzen aussehen kann. Dabei wird als Lerngegenstand die Modellierungssprache der ereignisgesteuerten Prozesskette (EPK) betrachtet, da diese in der Praxis weit verbreitet ist (FETTKE 2009, 561).
Bei der Konzeption des Kurses werden folgende drei Leitfragen betrachtet:
• Welche Inhalte sollen in einem Anfängerkurs vermittelt werden?
• Wie kann der Kurs aufgebaut sein?
• Wie kann das Thema der Geschäftsprozessmodellierung in einer virtuellen Lernumgebung didaktisch aufbereitet werden?
Die Konzeption eines E-Learning Kurses ist in einen größeren Entwicklungs-prozess eingebunden. Dieser beinhaltet eine Analyse der Anforderungen, Pla-nung, Entwicklung sowie Einsatz und Evaluation (ISSING 1997). Im Rahmen der Konzeption werden dabei nur die Aspekte der Analyse und Planung betrachtet. Das Konzept soll allgemein gehalten sein, sodass es sich auf verschiedene Lernumgebungen und Bildungssituationen anwenden lässt. Dementsprechend Erfolgt keine Erstellung konkreter Lerninhalte und Übungsaufgaben, sondern Empfehlungen, welche Inhalte im Kurs thematisiert werden können.
Um einen Überblick über den fachlichen Teil der Konzeption zu gewinnen, wird in Kapitel 0 ein Einblick in die Grundlagen der Geschäftsprozessmodellierung mit EPKs gegeben. In Kapitel 3 wird die Erstellung der Konzeption anhand einer Schrittfolge dargelegt, die aus der Zielgruppenanalyse, der Inhaltsanalyse, dem Didaktischen Design und dem Betreuungskonzept besteht. Zur Abrundung der Konzeption werden in Kapitel 4 mögliche Inhalte und Aufbau der einzelnen Module des Kurses dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Grundlagen der Modellierung mit EPK
- Definition der Geschäftsprozessmodellierung
- Die ereignisgesteuerte Prozesskette ARIS
- Einordnung der EPK in ARIS
- Modellierungssprache und -regeln
- Vorgehensmodell zur EPK-Modellierung
- Konzeption des Kurses zur Geschäftsprozessmodellierung
- Schritte bei der Konzeption Multimedialer Lernumgebungen
- Analyse der Zielgruppe
- Analyse der Lerninhalte und Lehrziele
- Erstellung von Lerninhalten
- Zuordnung von Lehrzielen zu den Lerninhalten
- Festlegung der didaktischen Struktur
- Betreuungskonzept
- Aufbau der Module
- Modul 1: Einführung in die Geschäftsprozessmodellierung
- Modul 2: Funktionen und Ereignisse
- Modul 3: Organisationseinheit, Informationsobjekte und der Prozesswegweiser
- Modul 4: Modellierungswerkzeuge
- Modul 5: Konnektoren
- Modul 6: Komplexe Modellierung
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, eine didaktische Konzeption für einen E-Learning-Kurs zur Einführung in die Geschäftsprozessmodellierung mit ereignisgesteuerten Prozessketten (EPK) zu entwickeln. Es wird untersucht, wie die relevanten Kompetenzen und Fähigkeiten in einer virtuellen Lernumgebung vermittelt werden können. Die Konzeption berücksichtigt die Analyse der Anforderungen, Planung, Entwicklung sowie Einsatz und Evaluation des Kurses.
- Entwicklung eines didaktischen Konzepts für einen E-Learning-Kurs zur Geschäftsprozessmodellierung mit EPK.
- Analyse der Lerninhalte und Lehrziele für einen Anfängerkurs.
- Definition der didaktischen Struktur und des Aufbaus des Kurses.
- Erstellung eines Betreuungskonzepts für die Lernenden.
- Anwendung der EPK-Modellierungssprache in der Praxis.
Zusammenfassung der Kapitel
Problemstellung: Die Arbeit behandelt die Notwendigkeit einer virtuellen Lernumgebung zur Vermittlung von Kompetenzen in Geschäftsprozessmodellierung, insbesondere mit EPKs, aufgrund des steigenden Bedarfs an Fachkräften in diesem Bereich. Die Leitfragen befassen sich mit den Inhalten eines Anfängerkurses, dem Kursaufbau und der didaktischen Aufbereitung des Themas in einer virtuellen Lernumgebung. Der Fokus liegt auf der Analyse und Planung des E-Learning-Kurses, wobei konkrete Lerninhalte und Aufgaben nur exemplarisch empfohlen werden.
Grundlagen der Modellierung mit EPKs: Dieses Kapitel liefert eine Einführung in die Geschäftsprozessmodellierung. Es definiert die Begriffe "Geschäftsprozess" und "Modellierung" und beleuchtet den Ursprung und Aufbau von EPKs. Der konstruktivistische Ansatz der Modellierung wird hervorgehoben, der die subjektive Wahrnehmung des Modellierers und seine Interpretation der Realität betont. Die Einbindung der EPK in das ARIS-Framework wird kurz angerissen.
Konzeption des Kurses zur Geschäftsprozessmodellierung: Dieses Kapitel beschreibt die schrittweise Erstellung der E-Learning-Kurskonzeption. Es umfasst die Analyse der Zielgruppe, die Analyse der Lerninhalte und Lehrziele (inkl. der Erstellung von Lerninhalten und der Zuordnung von Lehrzielen), das didaktische Design und ein Betreuungskonzept. Der Ansatz ist allgemein gehalten, um eine Anwendung auf verschiedene Lernumgebungen und Bildungssituationen zu ermöglichen.
Aufbau der Module: Dieses Kapitel präsentiert einen möglichen Aufbau des E-Learning-Kurses, der in mehrere Module gegliedert ist. Jedes Modul wird kurz beschrieben, wobei der Fokus auf den Inhalten und der didaktischen Anordnung liegt. Die Kapitel geben einen Überblick über die Themen der einzelnen Module, jedoch ohne detaillierte Inhalte oder konkrete didaktische Umsetzung.
Schlüsselwörter
Geschäftsprozessmodellierung, Ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK), E-Learning, Didaktik, virtuelle Lernumgebung, ARIS, Kompetenzentwicklung, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftspädagogik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur didaktischen Konzeption eines E-Learning-Kurses zur Geschäftsprozessmodellierung mit EPK
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit beschreibt die didaktische Konzeption eines E-Learning-Kurses zur Einführung in die Geschäftsprozessmodellierung mit ereignisgesteuerten Prozessketten (EPK). Der Fokus liegt auf der Analyse, Planung und Entwicklung des Kurses, inklusive der didaktischen Gestaltung und des Betreuungskonzepts. Konkrete Lerninhalte und Aufgaben werden exemplarisch angedeutet.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein didaktisches Konzept für einen E-Learning-Kurs zur Geschäftsprozessmodellierung mit EPK zu entwickeln. Es soll untersucht werden, wie die relevanten Kompetenzen und Fähigkeiten in einer virtuellen Lernumgebung effektiv vermittelt werden können. Die Konzeption umfasst die Analyse der Anforderungen, Planung, Entwicklung, Einsatz und Evaluation des Kurses.
Welche Themen werden im Kurs behandelt?
Der Kurs umfasst die Grundlagen der Geschäftsprozessmodellierung mit EPK, inklusive der Definition von Geschäftsprozessen und Modellierung, sowie die Einordnung von EPK in das ARIS-Framework. Weitere Themen sind die Modellierungssprache und -regeln von EPK, ein Vorgehensmodell zur EPK-Modellierung und die Anwendung von EPK in der Praxis.
Wie ist der Kurs aufgebaut?
Der Kurs ist modular aufgebaut. Die Module behandeln folgende Themen: Einführung in die Geschäftsprozessmodellierung, Funktionen und Ereignisse, Organisationseinheit, Informationsobjekte und der Prozesswegweiser, Modellierungswerkzeuge, Konnektoren und komplexe Modellierung. Jeder Modul wird kurz beschrieben, wobei der Fokus auf den Inhalten und der didaktischen Anordnung liegt.
Welche Zielgruppe wird angesprochen?
Die Zielgruppe des Kurses sind Anfänger im Bereich der Geschäftsprozessmodellierung. Die Konzeption berücksichtigt die spezifischen Bedürfnisse und das Vorwissen dieser Zielgruppe.
Wie wird die didaktische Struktur des Kurses beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die schrittweise Erstellung der E-Learning-Kurskonzeption. Dies umfasst die Analyse der Zielgruppe, die Analyse der Lerninhalte und Lehrziele (inkl. Erstellung von Lerninhalten und Zuordnung von Lehrzielen), das didaktische Design und ein Betreuungskonzept. Der Ansatz ist allgemein gehalten, um eine Anwendung auf verschiedene Lernumgebungen und Bildungssituationen zu ermöglichen.
Welches Betreuungskonzept wird vorgeschlagen?
Die Arbeit beinhaltet ein Betreuungskonzept für die Lernenden, das auf die spezifischen Bedürfnisse einer virtuellen Lernumgebung zugeschnitten ist. Die Details des Betreuungskonzepts sind jedoch nicht explizit ausgearbeitet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Geschäftsprozessmodellierung, Ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK), E-Learning, Didaktik, virtuelle Lernumgebung, ARIS, Kompetenzentwicklung, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftspädagogik.
Welche Software oder Tools werden im Kurs verwendet?
Die Arbeit erwähnt die Verwendung von Modellierungswerkzeugen im Kurs, benennt aber keine spezifischen Software-Lösungen.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den Lerninhalten?
Die Arbeit bietet eine Übersicht über die Lerninhalte, jedoch werden detaillierte Inhalte und konkrete didaktische Umsetzungen nur exemplarisch angedeutet. Der Fokus liegt auf der Konzeption und Planung des Kurses.
- Quote paper
- Robert Pollack (Author), 2011, Didaktische Konzeption eines E-Learning Kurses zur Geschäftsprozessmodellierung mit ereignisgesteuerten Prozessketten (EPK), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177832