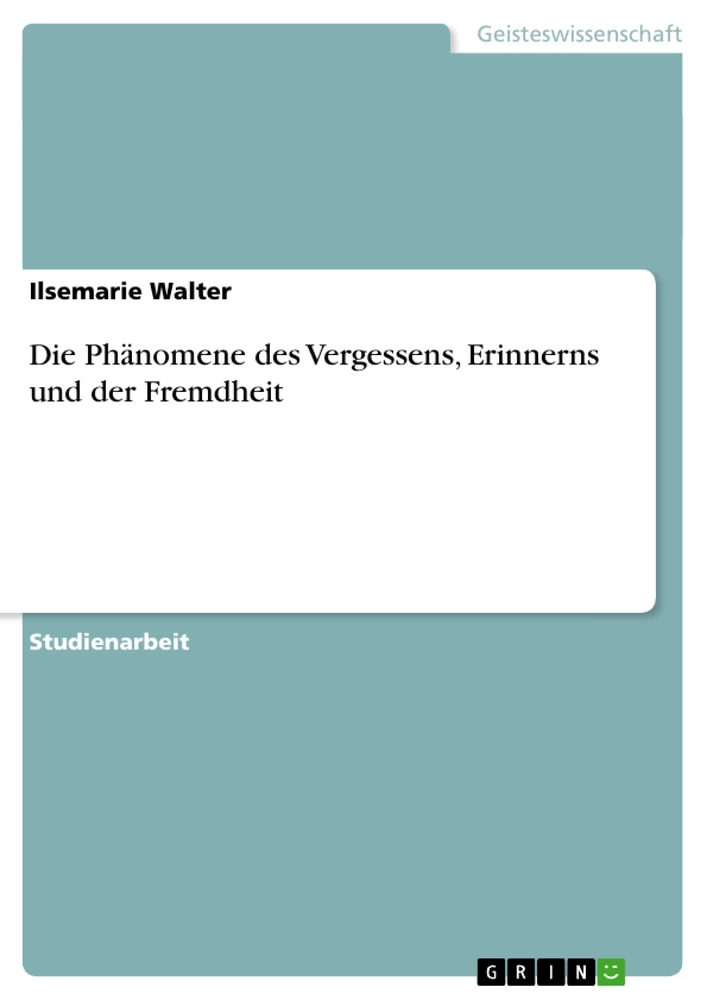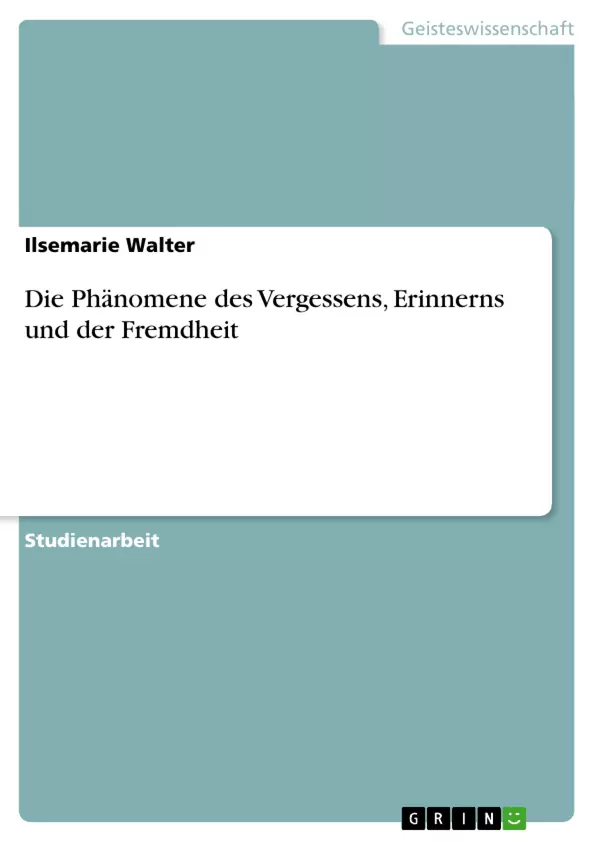In dieser Arbeit geht es um die Phänomene des Vergessens, des Erinnerns und der Fremdheit sowie um die Zusammenhänge zwischen diesen Phänomenen.
Im Hauptteil werden die diesbezüglichen Ausführungen Nietzsches in seiner zweiten „Unzeitgemäßen Betrachtung“ zusammengefasst und kommentiert. Dieser 1873 von Nietzsche verfasste Aufsatz stellt eine kritische Auseinandersetzung des Autors mit der Kultur seiner Zeit dar, enthält aber zugleich auch Nietzsches philosophisches Konzept des Erinnerns und Vergessens. Nietzsche nimmt diesen Phänomenen gegenüber eine pragmatische Haltung ein und fragt nach ihrem Nutzen oder Schaden. Anders als viele Philosophen, die im Vergessen nur eine negative Erscheinung sehen, ist für ihn Vergessen ein Wert; erst Vergessenkönnen mache das Glück zum Glück. Vergessen gehöre zum Leben wie der Schlaf; ohne zu vergessen könne man nicht nur nicht glücklich werden, sondern auch nichts tun, was andere glücklich macht, denn man würde dann kaum mehr zu handeln wagen. Der Geschichtswissenschaft seiner Zeit wirft Nietzsche vor, dass sie dem Leben schade, indem sie die Menschen mit Geschichte übersättige. Nur in mäßiger Dosis könnten die verschiedenen Arten der „Historie“ im Dienste des Lebens stehen, wobei Nietzsche eine monumentalische, eine antiquarische und eine kritische Historie unterscheidet. Monumentalische Historie zeige das Große, das einmal da war und deshalb auch wieder möglich sein kann. Antiquarische Historie sei mit Bewahren und Verehren verbunden und helfe dem Einzelnen zu einem Wir-Gefühl. Die kritische Historie stelle die Vergangenheit vor Gericht, zeige Ungerechtigkeit auf und mache dadurch auch Veränderung möglich. Alle drei Arten von Historie bergen nach Ansicht Nietzsches jedoch auch große Gefahren, wenn sie nicht am richtigen Platz eingesetzt werden.
Neben dieser Analyse von Nietzsches Aufsatz werden auch die Gedanken anderer Philosophen zum in Frage stehenden Themenkreis aufgegriffen. Unter anderem geht es um „Erkennen als Wiedererinnerung“ oder um „Erinnern als Wiederantworten“. Hier ist auch der Zusammenhang mit dem Konzept der „Fremdheit“ zu suchen, denn Erinnern als Umgang mit unserer Vergangenheit kann auch als eine spezifische Form des Umgangs mit dem Fremden gesehen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Erkennen als Wiedererinnerung - Platon und Marcel Proust
- Vergessen
- Sprachliche Annäherung
- Formen des Vergessens
- Vergessen in verschiedenen philosophischen Traditionen
- Der Nutzen des Vergessens: Nietzsches zweite „,Unzeit-gemäße Betrachtung“
- Historisches, Unhistorisches und Überhistorisches
- Drei Arten von Historie - ihr Nutzen und ihre Gefahren
- Die Übersättigung mit Geschichte ist dem Leben schädlich
- Vergessen können
- Vergangenes und Fremdes
- Einfallen und Entfallen
- Erinnern als Wiederantworten
- Geschichte, Erinnerung und Fremdheit – einige Fragen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Phänomenen des Vergessens, des Erinnerns und der Fremdheit und deren Zusammenhängen. Der Fokus liegt auf Nietzsches Ausführungen in seiner zweiten „Unzeitgemäßen Betrachtung“ und bezieht sich außerdem auf die Lehrveranstaltung „Phänomenologie des Fremden“. Die Arbeit stellt einige Fragen zur Fremdheit im Zusammenhang mit Geschichte.
- Die Rolle von Vergessen und Erinnern in der menschlichen Existenz
- Nietzsches Philosophie des Vergessens und deren Bedeutung für das Verständnis von Geschichte
- Die Verbindung zwischen Vergessen, Erinnern und der Erfahrung von Fremdheit
- Die Rolle der Sprache und des Gedächtnisses im Prozess des Vergessens
- Die Bedeutung von Schwellenmomenten und Übergängen im Kontext von Vergessen und Erinnern
Zusammenfassung der Kapitel
- Erkennen als Wiedererinnerung - Platon und Marcel Proust: Dieses Kapitel untersucht die Beziehung zwischen Erkennen und Erinnern anhand der Philosophien von Platon und Marcel Proust. Platon argumentiert, dass Erkennen eine „Wiedererinnerung“ an das „Urvergessen“ ist, das die menschliche Existenz kennzeichnet. Proust zeigt, dass Erinnerung durch sinnliche Erfahrungen ausgelöst werden kann und uns Dinge wiedererleben lässt, die wir nie wirklich gehabt haben.
- Vergessen: Dieses Kapitel betrachtet das Phänomen des Vergessens aus verschiedenen Perspektiven. Es analysiert den sprachlichen Ausdruck von Vergessen in verschiedenen Sprachen und beleuchtet unterschiedliche Formen des Vergessens.
- Vergessen in verschiedenen philosophischen Traditionen: Dieses Kapitel untersucht das Thema Vergessen im Kontext verschiedener philosophischer Traditionen.
- Der Nutzen des Vergessens: Nietzsches zweite „,Unzeit-gemäße Betrachtung“: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Nietzsches Argumenten über den Nutzen des Vergessens in seiner zweiten „Unzeitgemäßen Betrachtung“. Nietzsche argumentiert, dass Vergessen für die menschliche Existenz und die Bewältigung der Geschichte unerlässlich ist.
- Einfallen und Entfallen: Dieses Kapitel betrachtet die Phänomene des Einfallen und Entfallen im Kontext von Vergessen und Erinnern.
- Erinnern als Wiederantworten: Dieses Kapitel untersucht die Beziehung zwischen Erinnern und dem Wiederantworten auf vergangene Ereignisse.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Vergessen, Erinnern, Fremdheit, Phänomenologie, Philosophie, Geschichte, Nietzsche, Platon, Proust, Sprache, Gedächtnis, Schwellenmomente, Urvergessen, Wiedererinnerung.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Vergessen laut Nietzsche ein positiver Wert?
Für Nietzsche ist das Vergessenkönnen eine Voraussetzung für das Glück und die Fähigkeit zu handeln. Ohne Vergessen wäre der Mensch durch die Last der Geschichte gelähmt und könnte nicht im Moment leben.
Welche drei Arten der Historie unterscheidet Nietzsche?
Nietzsche unterscheidet die monumentalische Historie (das Große als Vorbild), die antiquarische Historie (Bewahren von Tradition) und die kritische Historie (Abrechnung mit der Vergangenheit für Veränderung).
Was bedeutet „Erkennen als Wiedererinnerung“ bei Platon?
Platon vertritt die Auffassung, dass alles Lernen eigentlich eine Wiedererinnerung (Anamnesis) an ein „Urvergessen“ ist, das die menschliche Seele vor der Geburt erfahren hat.
Wie hängen Erinnern und Fremdheit zusammen?
Erinnern kann als eine Form des Umgangs mit dem Fremden gesehen werden, da die eigene Vergangenheit uns oft fremd vorkommen kann. Die Phänomenologie des Fremden untersucht diesen Übergang.
Was kritisiert Nietzsche an der Geschichtswissenschaft seiner Zeit?
Er wirft ihr eine „Übersättigung mit Geschichte“ vor, die dem lebendigen Handeln schadet. Geschichte sollte nur in einer Dosis konsumiert werden, die dem Leben dient, nicht es erstickt.
- Arbeit zitieren
- Ilsemarie Walter (Autor:in), 2002, Die Phänomene des Vergessens, Erinnerns und der Fremdheit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17787