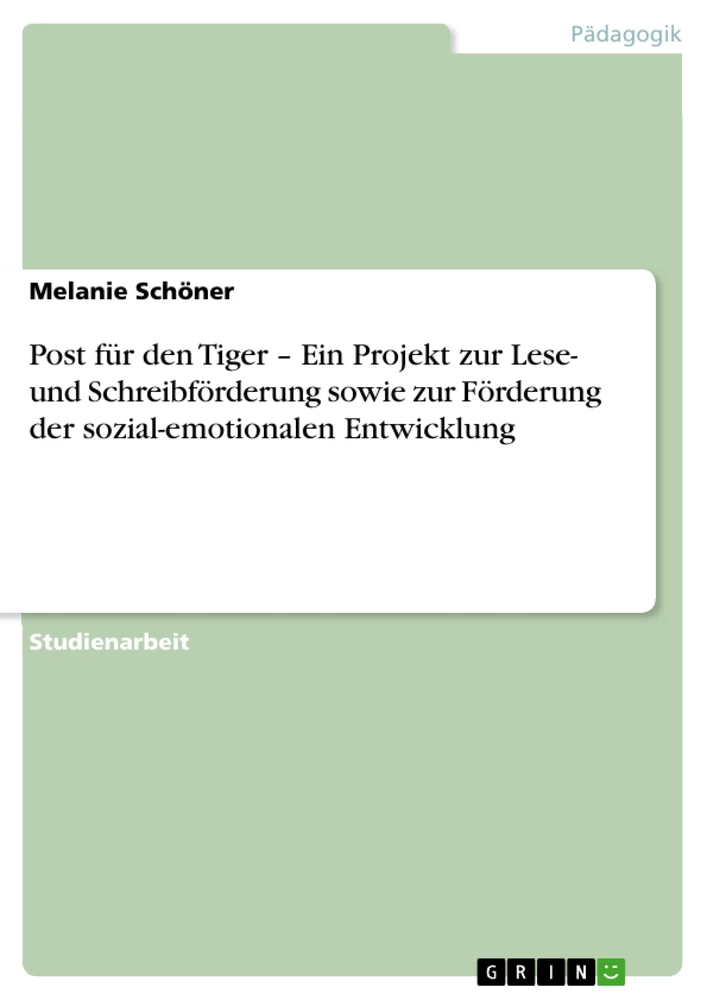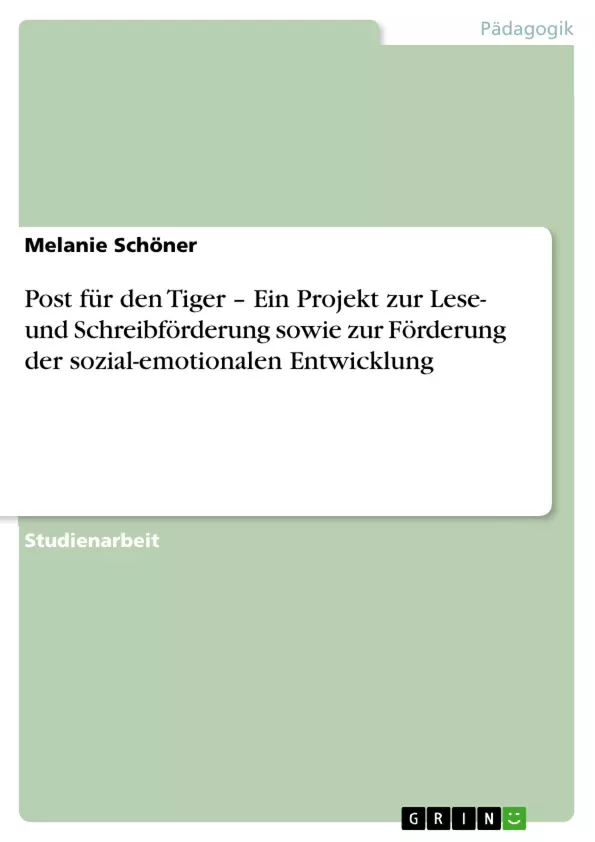Das Projekt wurde in einer Diagnose-und Förderklasse 1A durchgeführt. Der Inhalt des Buches von Janosch "Post für den Tiger" wurde genutzt, um das Erstlesen und Erstschreiben weiterzuentwickeln. Die Förderung der sozio-emotionalen Entwicklung erfolgte über Rollenspiele zum Thema und gemeinsame Aktivitäten. Zudem wurrde eine Einschätzung durch den ELDiB vorgenommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Diagnostik und individuelle Zielgestaltung
- Lernausgangslage in allen wesentlichen Bereichen
- Zielsetzungen (ELDIB)
- Theoretische Grundlegung und didaktisch-methodische Folgerungen
- Projektmethode
- Schriftspracherwerb
- Soziale und emotionale Kompetenzen
- Praktische Umsetzung
- Bezug zum Lehrplan
- Übersicht über die geplanten Lernvorhaben
- Darstellung der Schwerpunkte des Projekts
- Leseförderung
- Schreibförderung
- Inhaltliche Auseinandersetzung
- Förderung der sozio-emotionalen Entwicklung
- Teilnahme an einem Wettbewerb
- Auswertung und Reflexion
- Lernfortschritt
- Überprüfung der Ziele
- Persönlicher kritischer Rückblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das vorliegende Projekt zielt darauf ab, die Lese- und Schreibkompetenz von SchülerInnen mit Lernschwierigkeiten zu fördern sowie ihre sozial-emotionale Entwicklung zu unterstützen. Das Projekt basiert auf dem Bilderbuch "Post für den Tiger" von Janosch und nutzt die Geschichte als Ausgangspunkt für vielfältige Lernmöglichkeiten.
- Förderung der Lese- und Schreibkompetenz
- Entwicklung von Freude am Lesen und Schreiben
- Steigerung der Motivation und des Selbstbewusstseins im Bereich der Sprache
- Entwicklung sozialer und emotionaler Kompetenzen
- Förderung der Zusammenarbeit und Kommunikation im Klassenverband
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer detaillierten Beschreibung der Lernausgangslage der SchülerInnen, die anhand einer Lernstandsdiagnostik ermittelt wurde. Die Analyse beinhaltet die Bereiche Lesekompetenz, Schreibkompetenz und die sozio-emotionale Entwicklung der SchülerInnen. Die Autorin stellt anschließend die wichtigsten Ziele des Projekts dar, die sich auf die Förderung der Lese- und Schreibkompetenz sowie der sozialen und emotionalen Entwicklung der SchülerInnen konzentrieren.
Im dritten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen des Projekts erläutert, wobei die Projektmethode, der Schriftspracherwerb und die Entwicklung sozialer und emotionaler Kompetenzen im Vordergrund stehen. Die Autorin beleuchtet die Bedeutung dieser Bereiche für die praktische Umsetzung des Projekts und zeigt deren Relevanz für die Zielerreichung auf.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der praktischen Umsetzung des Projekts. Zunächst wird die Einbettung des Projekts im Lehrplan dargelegt, bevor die einzelnen Lerneinheiten im Detail vorgestellt werden. Die Schwerpunkte des Projekts, die sich auf die Leseförderung, Schreibförderung, die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Buch, die Förderung der sozio-emotionalen Entwicklung der SchülerInnen sowie die Teilnahme an einem Wettbewerb konzentrieren, werden in diesem Kapitel genauer beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Hausarbeit fokussiert auf die Förderung der Lese- und Schreibkompetenz von SchülerInnen mit Lernschwierigkeiten im Kontext des Bilderbuches "Post für den Tiger". Dabei werden die Projektmethode, der Schriftspracherwerb und die sozio-emotionale Entwicklung der SchülerInnen als zentrale Themenbereiche betrachtet. Die Analyse der Lernausgangslage der SchülerInnen, die Erarbeitung von individuellen Lernzielen und die Auswertung des Projekts anhand des Lernfortschritts der SchülerInnen bilden den Kern der Arbeit. Die Arbeit liefert einen wertvollen Beitrag zur Diskussion von didaktisch-methodischen Ansätzen zur Förderung von Lese- und Schreibkompetenz sowie sozialer und emotionaler Kompetenzen bei SchülerInnen mit Lernschwierigkeiten.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es im Projekt „Post für den Tiger“?
Das Projekt nutzt Janoschs Kinderbuch, um Schülern in einer Diagnose- und Förderklasse spielerisch das Erstlesen und Erstschreiben zu vermitteln.
Wie wird die sozio-emotionale Entwicklung gefördert?
Durch Rollenspiele zu den Buchthemen und gemeinsame Aktivitäten lernen die Kinder, soziale Kompetenzen wie Kooperation und Kommunikation zu stärken.
Was ist der ELDiB?
Der ELDiB (Entwicklungsorientierter Längsschnitt-Diagnostikbogen) dient zur Einschätzung des Entwicklungsstandes und zur individuellen Zielplanung für Kinder mit Förderbedarf.
Warum eignet sich die Projektmethode für den Schriftspracherwerb?
Die Projektmethode ermöglicht ein ganzheitliches, motivierendes Lernen, das theoretische Grundlagen mit praktischem Handeln und persönlichen Erfahrungen verknüpft.
Welche Rolle spielt die Leseförderung in diesem Projekt?
Die Kinder setzen sich intensiv mit dem Inhalt auseinander, wodurch nicht nur die Technik des Lesens, sondern auch die Freude an Literatur und Sprache geweckt wird.
- Quote paper
- Melanie Schöner (Author), 2010, Post für den Tiger – Ein Projekt zur Lese- und Schreibförderung sowie zur Förderung der sozial-emotionalen Entwicklung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177916