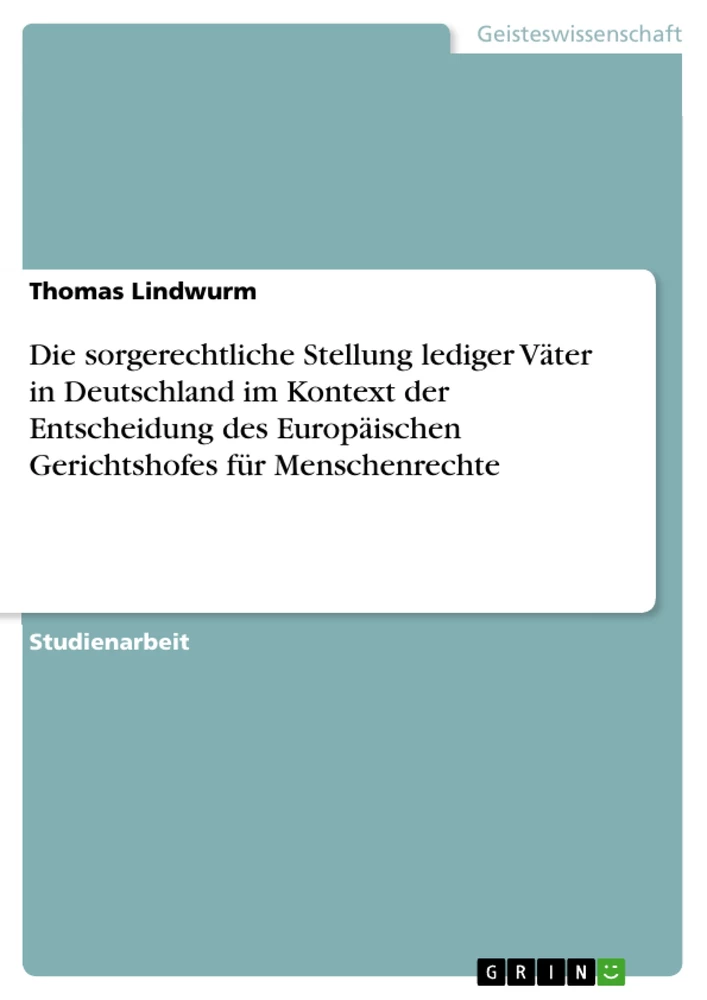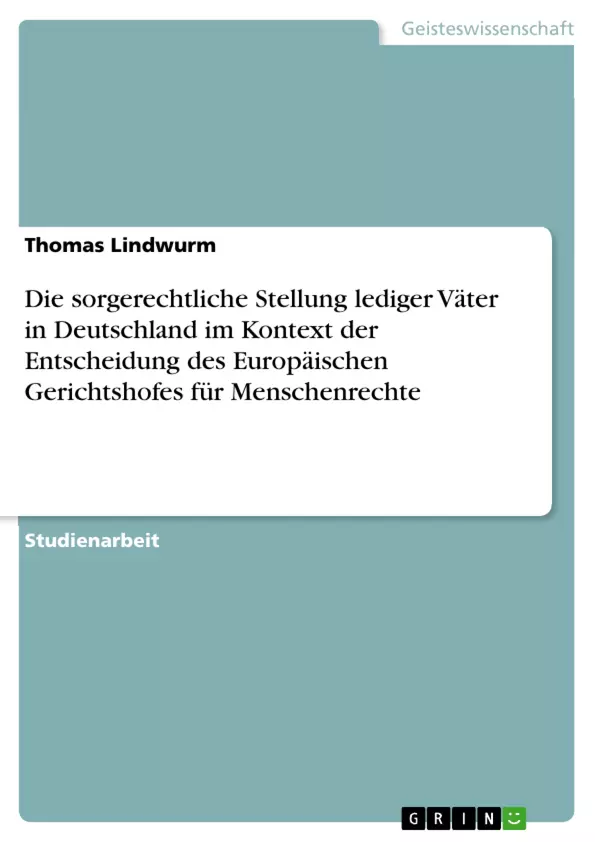Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 03.11.1982 wurde die bis dahin geltende Formulierung des §1671 Abs. 4 S. 1 mit dem Wortlaut „Die Elterliche Sorge ist einem Elternteil allein zu übertragen“ hinfällig.
Das in Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG geregelte Recht der Pflege und Erziehung des Kindes wurde somit zumindest nicht nur für Kinder verheirateter, sondern auch geschiedener Eltern mit der Reform des Kindschaftsrechtes vom 16.12.1997 als rechtskräftig anerkannt.
Etwa ein Drittel der werdenden Väter in Deutschland haben bislang dennoch keinen Rechtsanspruch auf die gemeinsame Elterliche Sorge und stehen ihren mit der Kindesmutter verheirateten oder von dieser geschiedenen Mitvätern hierin nach.
Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, auf das hier Bezug genommen wird, fordert den deutschen Gesetzgeber nun letztinstanzlich auf, Abhilfe zu schaffen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gegenwärtige Situation
- Problematik der Ausgangssituation
- Instanzenweg am Konkreten Fall
- Rechtsstellung des EuGHMR
- Punkte der Individualbeschwerde
- Rechtliche Sonderregelungen
- Internationale Dimension
- Anwendung von Präzedenzfällen des EuGHMR
- Urteil
- Erste Reaktionen des BMJ
- Politische Standpunkte
- UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes (KRK)
- Lösungsansätze
- Fazit
- Besonderes Fazit
- Quellenangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Studienarbeit analysiert den Rechtsfall Zaunegger/Deutschland, der vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EuGHMR) entschieden wurde. Im Zentrum steht die Frage der sorgerechtlichen Stellung lediger Väter in Deutschland im Kontext der Entscheidung des EuGHMR und dessen gesellschaftspolitischen Kontext. Der Fall Zaunegger betrifft einen Vater, dem die gemeinsame elterliche Sorge für seine Tochter verwehrt wurde, obwohl er mit der Kindesmutter in einer eheähnlichen Gemeinschaft lebte. Die Arbeit beleuchtet die Problematik der aktuellen Rechtslage, die sich mit verschiedenen Grundrechten in Konflikt befindet, und analysiert den Instanzenweg des Falles. Sie integriert verschiedene politische Standpunkte und Lösungsansätze zur Reform des Sorgerechts für nichteheliche Kinder.
- Die sorgerechtliche Stellung lediger Väter in Deutschland
- Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte im Fall Zaunegger
- Die Problematik der aktuellen Rechtslage und ihre Inkompatibilität mit Grundrechten
- Die politische Debatte um eine Reform des Sorgerechts für nichteheliche Kinder
- Die Bedeutung des Kindeswohls und der Gleichheit vor dem Gesetz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Rechtsfall Zaunegger/Deutschland vor und erläutert die Problematik der sorgerechtlichen Stellung lediger Väter in Deutschland. Die gegenwärtige Situation beleuchtet die Rechtslage in Deutschland und die Entwicklung des Sorgerechts für nichteheliche Kinder. Die Problematik der Ausgangssituation zeigt die gesellschaftlichen Veränderungen und die steigende Zahl von Kindern, die außerhalb einer Ehe geboren werden. Das Kapitel über den Instanzenweg am konkreten Fall beschreibt den Verlauf des Rechtsstreits von den deutschen Gerichten bis zum EuGHMR. Die Rechtsstellung des EuGHMR erläutert die Rolle und die Bedeutung des Gerichtshofes im europäischen Rechtssystem. Die Punkte der Individualbeschwerde fassen die Argumente des Klägers Zaunegger vor dem EuGHMR zusammen. Die rechtlichen Sonderregelungen beleuchten die Problematik der fehlenden Übergangsregelungen für unverheiratete Eltern, die sich vor Inkrafttreten des Kindschaftsreformgesetzes trennten. Die internationale Dimension analysiert die Rechtslage in anderen europäischen Ländern im Vergleich zu Deutschland.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Sorgerecht, ledige Väter, nichteheliche Kinder, Familienrecht, Diskriminierung, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EuGHMR), Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), Kindeswohl, Gleichheit vor dem Gesetz, politische Debatte, Reform des Sorgerechts, UN-Kinderrechtskonvention.
Häufig gestellte Fragen
Worum ging es im Rechtsfall Zaunegger gegen Deutschland?
Ein lediger Vater klagte vor dem EuGHMR, weil ihm nach deutschem Recht die gemeinsame elterliche Sorge gegen den Willen der Mutter verwehrt wurde.
Wie entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EuGHMR)?
Der EuGHMR entschied, dass die deutsche Regelung diskriminierend ist und gegen das Recht auf Schutz des Familienlebens verstößt.
Warum ist die aktuelle Rechtslage für ledige Väter problematisch?
Bisher hatten ledige Väter keinen Rechtsanspruch auf gemeinsame Sorge, wenn die Mutter nicht zustimmte, was sie gegenüber verheirateten oder geschiedenen Vätern benachteiligte.
Welche Rolle spielt das Kindeswohl bei dieser Entscheidung?
Das Kindeswohl steht im Zentrum; der EuGHMR argumentiert, dass der pauschale Ausschluss des Vaters dem Kindeswohl nicht zwingend dient.
Was fordert die UN-Kinderrechtskonvention in diesem Zusammenhang?
Sie fordert die Gleichbehandlung von Kindern unabhängig vom Familienstand der Eltern und das Recht des Kindes auf Kontakt zu beiden Elternteilen.
- Arbeit zitieren
- Thomas Lindwurm (Autor:in), 2010, Die sorgerechtliche Stellung lediger Väter in Deutschland im Kontext der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177960