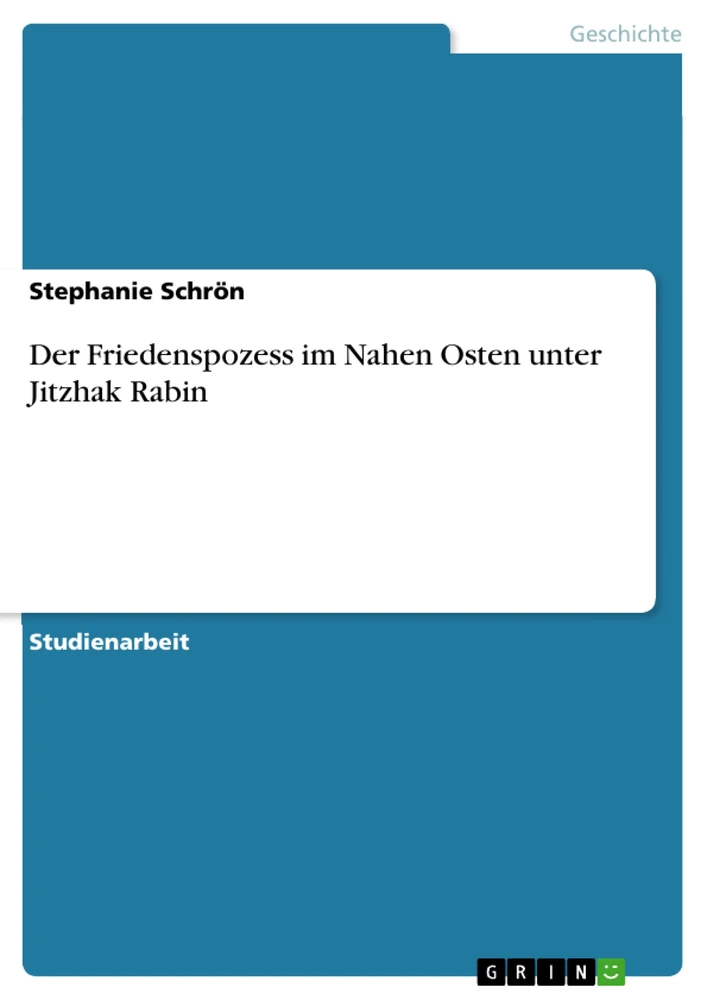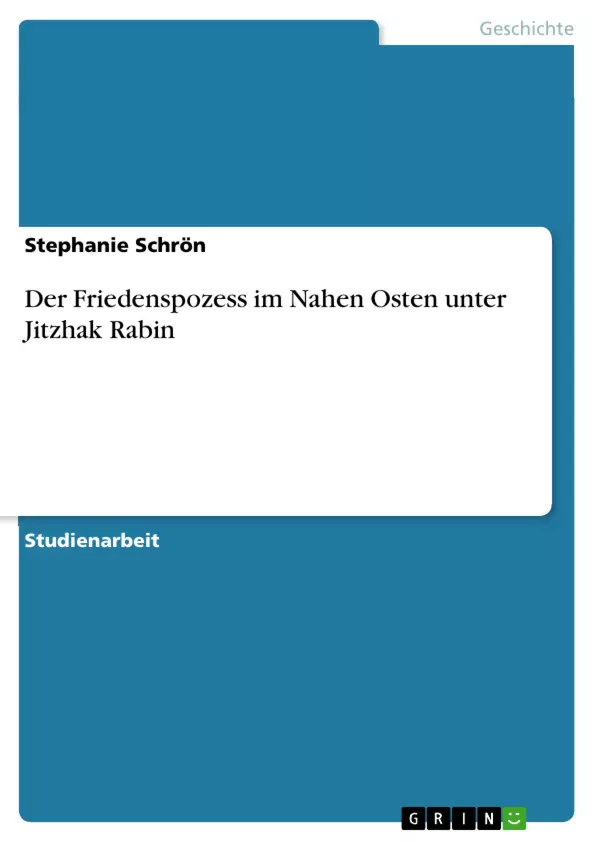Die vorliegende Arbeit enthält den Versuch, den Friedensprozess im Nahen Osten in den Jahren 1993 bis 1995 unter dem damaligen Ministerpräsidenten Jitzhak Rabin darzulegen. Dabei ist die Zeit zwischen 1993 und 1995 nur eine, wenn auch entscheidende, Phase der Friedensbemühungen zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn. In diesen Jahren wurde die Prinzipienerklärung über eine vorübergehende Selbstverwaltung („Oslo I“) ausgehandelt, der Friede mit Jordanien getroffen und das Gaza-Jericho-Abkommen („Oslo II“) unterzeichnet.
Im Verlauf der Arbeit soll gezeigt werden, dass der Friedensprozess nicht einfach nur unter Jitzhak Rabin stattfand, sondern vor allem mit und durch ihn. Überprüft werden soll die These, dass der Friedensprozess ohne Jitzhak Rabin nicht funktioniert hätte. Natürlich haben auch der damalige Außenminister Shimon Peres, Palästinenserpräsident Yassir Arafat und König Hussein von Jordanien einen großen Anteil an der Entwicklung und Umsetzung des Friedensprozesses. Jitzhak Rabin war nicht nur einer der „Friedensmacher“, er wurde auch Opfer der Anstrengungen um einen dauerhaften Frieden: am 4. November 1995 wurde Rabin in Tel Aviv von dem jüdischen Fanatiker Yigal Amir auf einer Friedenskundgebung erschossen.
Im Jahr 1948 wurde der Staat Israel gegründet. [...] Ein Ende des Konflikts ist bis heute nicht in Sicht. Die bisherigen Bemühungen – sei es von Seiten der Israelis oder Palästinenser, aber auch von Seiten der EU, den USA oder den Vereinten Nationen – um einen dauerhaften Frieden sind gescheitert. Als hoffnungsvoller Weg in den Frieden galt Anfang der 1990er Jahre der Osloer Friedensprozess. Dieser sollte in mehreren Stufen und unter Berücksichtigung der Bedingungen beider Parteien eine dauerhafte Koexistenz von Palästinensern und Israelis ohne Gewalt und Krieg herstellen und sichern. [...]
Einleiten in das Hauptthema „Schritte in den Frieden?“ wird ein kurzer Rückblick auf den 4. November 1995. [...] Hierbei wird nicht chronologisch vorgegangen, sondern es werden Themenschwerpunkte gesetzt und erörtert. [...] In der vorliegenden Arbeit soll nicht primär auf detaillierte Inhalte der Abkommen eingegangen werden, sondern der Fokus soll auf die Art und Weise, wie Rabin agierte, gerichtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der 4. November 1995
- Schritte in den Frieden?
- Rabin als Botschafter in Washington
- „Land für Frieden“ - Rabin und die Siedlungspolitik
- Rabins Rücktritt als Ministerpräsident
- Die Nahostfriedenskonferenz
- Rabins Annäherung an die PLO und an Yassir Arafat
- Die Gegenseitige Anerkennung und die Unterzeichnung von Oslo I
- Die unmittelbaren Reaktionen auf die Prinzipienerklärung
- Der Frieden mit Jordanien und die Verleihung des Friedensnobelpreises
- Die Unterzeichnung von Oslo II
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den israelisch-palästinensischen Friedensprozess zwischen 1993 und 1995 unter Ministerpräsident Jitzhak Rabin. Ziel ist es, Rabins Rolle und Einfluss auf diesen Prozess zu beleuchten und die These zu überprüfen, ob der Prozess ohne ihn möglich gewesen wäre. Dabei werden die Beiträge anderer wichtiger Akteure wie Shimon Peres und Yassir Arafat berücksichtigt.
- Rabins politische Entwicklung und Wandel seiner Haltung zum Friedensprozess
- Die Verhandlungen und Unterzeichnungen der Oslo-Abkommen
- Die Rolle der internationalen Akteure (USA, Jordanien)
- Die innenpolitischen Herausforderungen und Widerstände gegen Rabins Politik
- Die Folgen des Friedensprozesses und die Ermordung Rabins
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Fokus der Arbeit: die Darstellung des Friedensprozesses im Nahen Osten zwischen 1993 und 1995 unter Jitzhak Rabin, mit besonderem Augenmerk auf dessen persönliche Rolle und die These, dass der Prozess ohne ihn nicht funktioniert hätte. Die Bedeutung der Oslo-Abkommen und der Ermordung Rabins wird hervorgehoben, und es wird die Methode der thematischen statt chronologischen Analyse angekündigt.
Der 4. November 1995: Dieses Kapitel beschreibt die Friedenskundgebung in Tel Aviv am 4. November 1995, bei der Jitzhak Rabin ermordet wurde. Es wird die Atmosphäre der Kundgebung geschildert, Rabins Rede analysiert, und die Bedeutung des Ereignisses für den Friedensprozess hervorgehoben. Die Reaktion der Menge auf Rabins Rede und seine emotionale Umarmung mit Shimon Peres werden detailliert beschrieben, was den Paradigmenwechsel in Rabins Politik verdeutlicht.
Schritte in den Frieden?: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Facetten von Rabins Weg zum Frieden. Es beleuchtet seine Zeit als Botschafter in Washington, seine Siedlungspolitik, seinen Rücktritt als Ministerpräsident und die Nahostfriedenskonferenz. Der Fokus liegt auf Rabins Handlungsweise und den Konflikten nach den Unterzeichnungen der Abkommen, die schließlich im Höhepunkt der Ermordung Rabins gipfelten. Der Zusammenhang zwischen seinen verschiedenen Stationen und seinen Handlungen wird hier detailliert betrachtet.
Schlüsselwörter
Jitzhak Rabin, Friedensprozess, Nahostkonflikt, Oslo-Abkommen, PLO, Yassir Arafat, Shimon Peres, Siedlungspolitik, Gewalt, Frieden, Israel, Palästina.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Israelisch-Palästinensischer Friedensprozess unter Jitzhak Rabin (1993-1995)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den israelisch-palästinensischen Friedensprozess zwischen 1993 und 1995 unter Ministerpräsident Jitzhak Rabin. Der Schwerpunkt liegt auf Rabins Rolle und Einfluss auf diesen Prozess und der Frage, ob der Prozess ohne ihn möglich gewesen wäre. Die Analyse berücksichtigt auch die Beiträge anderer wichtiger Akteure wie Shimon Peres und Yassir Arafat.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht Rabins politische Entwicklung und den Wandel seiner Haltung zum Friedensprozess, die Verhandlungen und Unterzeichnungen der Oslo-Abkommen, die Rolle internationaler Akteure (USA, Jordanien), die innenpolitischen Herausforderungen und Widerstände gegen Rabins Politik sowie die Folgen des Friedensprozesses und die Ermordung Rabins.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, die den Fokus und die Methodik (thematische statt chronologischer Analyse) beschreibt. Es folgen Kapitel zu Rabins Ermordung am 4. November 1995, den Schritten zum Frieden (einschließlich seiner Zeit als Botschafter, Siedlungspolitik, Rücktritt und der Nahostfriedenskonferenz), und abschließend eine Schlussbetrachtung. Kapitelübersichten bieten einen detaillierten Einblick in den jeweiligen Inhalt.
Welche Rolle spielte Jitzhak Rabin im Friedensprozess?
Die Arbeit untersucht detailliert Rabins Rolle als zentrale Figur im Friedensprozess. Analysiert werden seine politischen Entscheidungen, seine Verhandlungen mit der PLO und Yassir Arafat, seine Konfrontationen mit internen Gegnern und die Auswirkungen seines Handelns auf den Verlauf des Prozesses. Die These der Arbeit ist, dass der Prozess ohne ihn anders verlaufen wäre, möglicherweise nicht erfolgreich.
Welche Bedeutung hatten die Oslo-Abkommen?
Die Oslo-Abkommen sind ein zentraler Bestandteil der Arbeit. Die Verhandlungen, die Unterzeichnungen und die unmittelbaren Reaktionen darauf werden eingehend analysiert. Ihre Bedeutung für den Friedensprozess und die langfristigen Folgen werden beleuchtet.
Wie wird die Ermordung Rabins behandelt?
Die Ermordung Rabins am 4. November 1995 wird als ein Schlüsselereignis mit tiefgreifenden Folgen für den Friedensprozess dargestellt. Das Kapitel beschreibt die Ereignisse des Tages, analysiert Rabins Rede und die Reaktionen darauf. Die Bedeutung des Ereignisses für den weiteren Verlauf des Friedensprozesses wird hervorgehoben.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine thematische statt einer chronologischen Analyse. Dies ermöglicht es, die verschiedenen Aspekte von Rabins Rolle und den Herausforderungen des Friedensprozesses strukturiert und fokussiert zu untersuchen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Jitzhak Rabin, Friedensprozess, Nahostkonflikt, Oslo-Abkommen, PLO, Yassir Arafat, Shimon Peres, Siedlungspolitik, Gewalt, Frieden, Israel, Palästina.
- Quote paper
- Stephanie Schrön (Author), 2010, Der Friedenspozess im Nahen Osten unter Jitzhak Rabin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177983