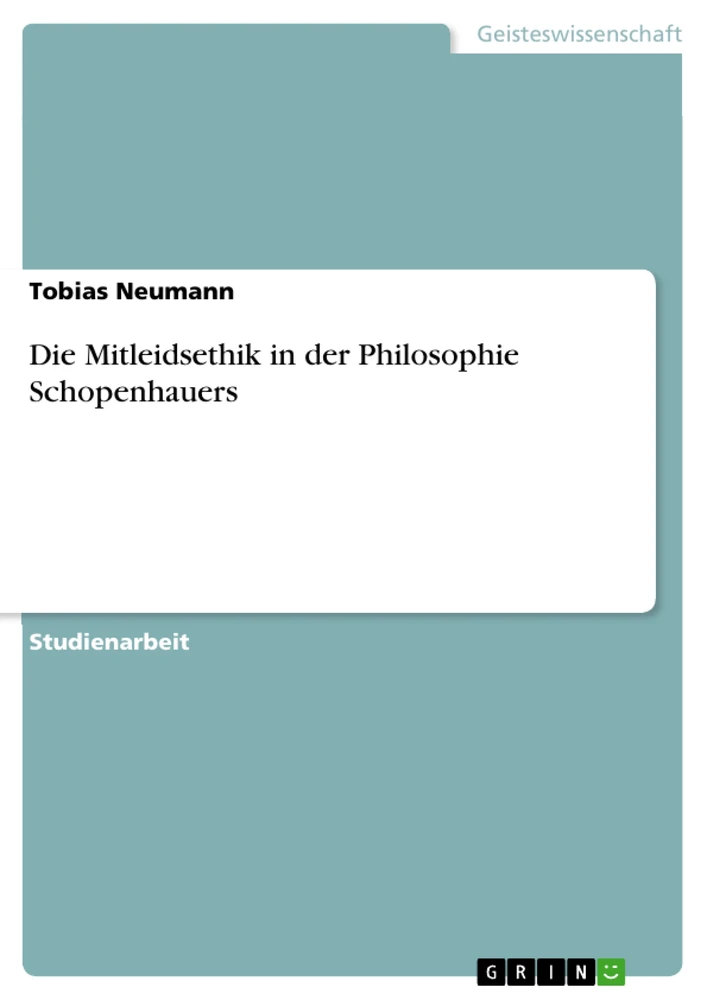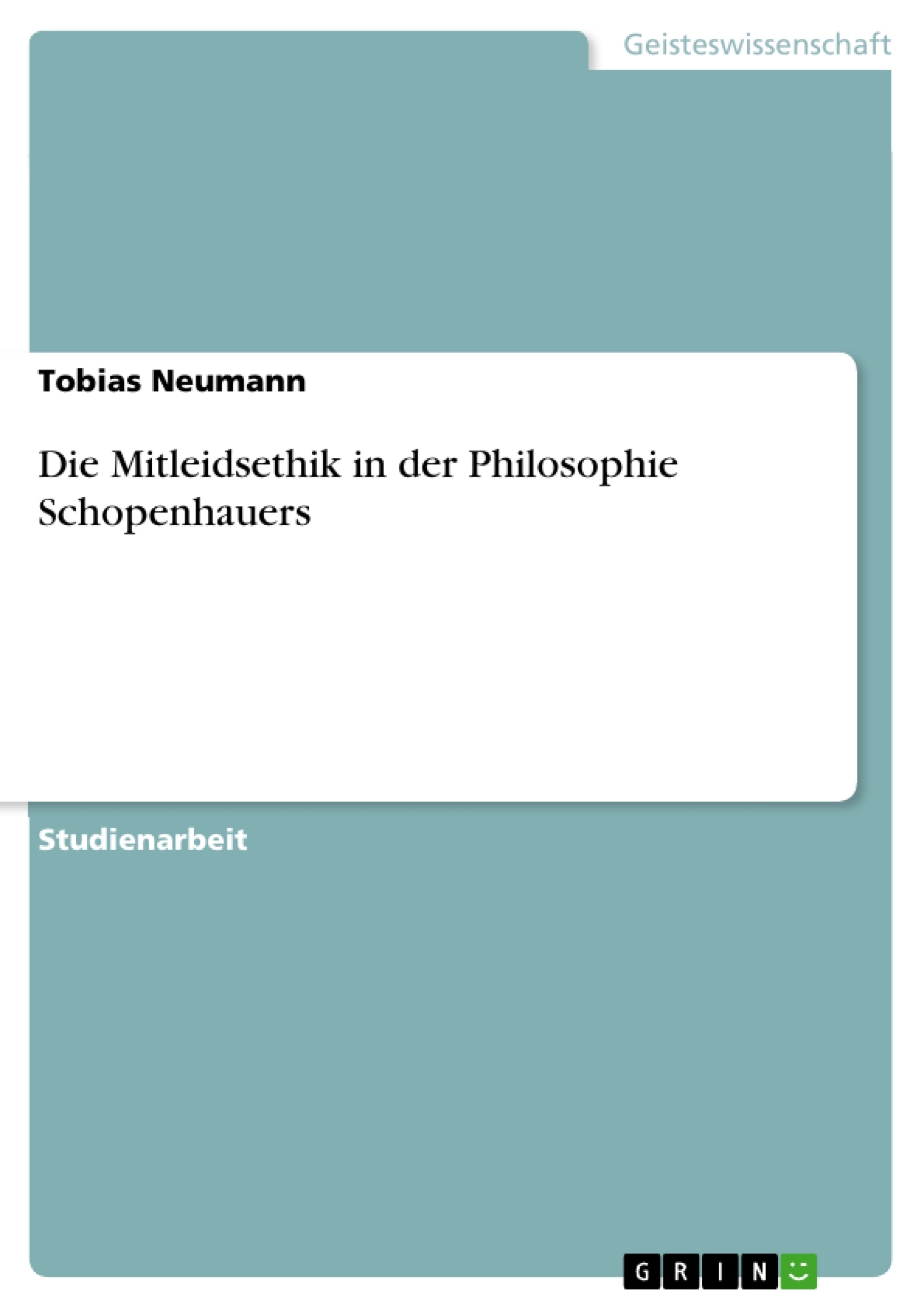Schopenhauers „pessimistische“ Philosophie ist erfüllt von einem Ausdruck des Leidens an den Widrigkeiten der Welt. Damit ist gemeint, dass eine Welt voller Schmerz, Qual, Furcht und Todesangst Impetus für eine Philosophie war, die als Konsequenz einen Erlösungsweg aufzeichnet. Um zu verstehen, warum Schopenhauer die Welt so pessimistisch betrachtet, in der Welt so viel Leiden sieht, richten wir unseren Blick zunächst auf die Voraussetzungen und Anfänge seines Schaffens. Im Anschluss werden wir uns der sogenannten „Mitleidsethik“ Schopenhauers zuwenden und herausstellen, was das Besondere an der Mitleidskonstruktion seiner Moralphilosophie ist und welche Möglichkeiten der Erlösung sie birgt.
Inhaltsverzeichnis
- Grundlegendes zur Philosophie Arthur Schopenhauers
- Verortung der Mitleidsethik in Schopenhauers Philosophie
- Mitleid als zentrales Moment in Schopenhauers Ethik und deren Konsequenz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Mitleidsethik in Schopenhauers Philosophie. Sie beleuchtet die grundlegenden Prinzipien von Schopenhauers Philosophie und die Rolle des Mitleids in seiner Ethik. Die Arbeit analysiert die Konsequenzen dieser Ethik und zeigt auf, welche Möglichkeiten der Erlösung sie bietet.
- Schopenhauers pessimistische Weltsicht
- Die Rolle des Mitleids in Schopenhauers Ethik
- Die Konsequenzen der Mitleidsethik
- Möglichkeiten der Erlösung im Lichte von Schopenhauers Philosophie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Grundlegendes zur Philosophie Arthur Schopenhauers
Dieses Kapitel führt in Schopenhauers Philosophie ein und beleuchtet seine pessimistische Sicht auf die Welt. Es zeigt die Voraussetzungen und Anfänge von Schopenhauers Schaffen und erklärt seine Sichtweise auf die Welt als ein "Jammertal" voller Leiden.
2. Verortung der Mitleidsethik in Schopenhauers Philosophie
Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung des Mitleids in Schopenhauers Philosophie und stellt die Mitleidsethik in den Kontext seiner anderen philosophischen Werke.
3. Mitleid als zentrales Moment in Schopenhauers Ethik und deren Konsequenz
Dieses Kapitel analysiert die zentrale Rolle des Mitleids in Schopenhauers Ethik und erklärt, wie es zu einer Möglichkeit der Erlösung werden kann.
Schlüsselwörter
Schopenhauer, Mitleidsethik, Pessimismus, Wille zum Leben, Leiden, Erlösung, Metaphysik, immanente Metaphysik, Weltwille.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Kernmerkmal von Schopenhauers Pessimismus?
Schopenhauer betrachtet die Welt als einen Ort voller Leiden, Schmerz und Todesangst, was er als Folge des blinden, unstillbaren "Willens zum Leben" erklärt.
Was versteht man unter der Mitleidsethik?
Die Mitleidsethik ist das Zentrum von Schopenhauers Moralphilosophie. Sie besagt, dass wahre Moral nur aus dem Mitleid entsteht, bei dem man das Leiden eines anderen wie sein eigenes empfindet.
Wie bietet Schopenhauers Philosophie einen Weg zur Erlösung?
Erlösung findet sich durch die Verneinung des Willens und das Überwinden des egoistischen Individualismus, wofür das Mitleid ein entscheidender erster Schritt ist.
Was ist der "Weltwille" in Schopenhauers Metaphysik?
Der Weltwille ist die metaphysische Urkraft, die hinter allen Erscheinungen steht und die Ursache für das endlose Streben und damit das Leiden in der Welt ist.
Warum bezeichnet Schopenhauer die Welt als "Jammertal"?
Für Schopenhauer überwiegt das Übel in der Welt das Gute bei weitem; Glück ist für ihn nur die kurze Abwesenheit von Schmerz.
- Quote paper
- Tobias Neumann (Author), 2009, Die Mitleidsethik in der Philosophie Schopenhauers, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178039