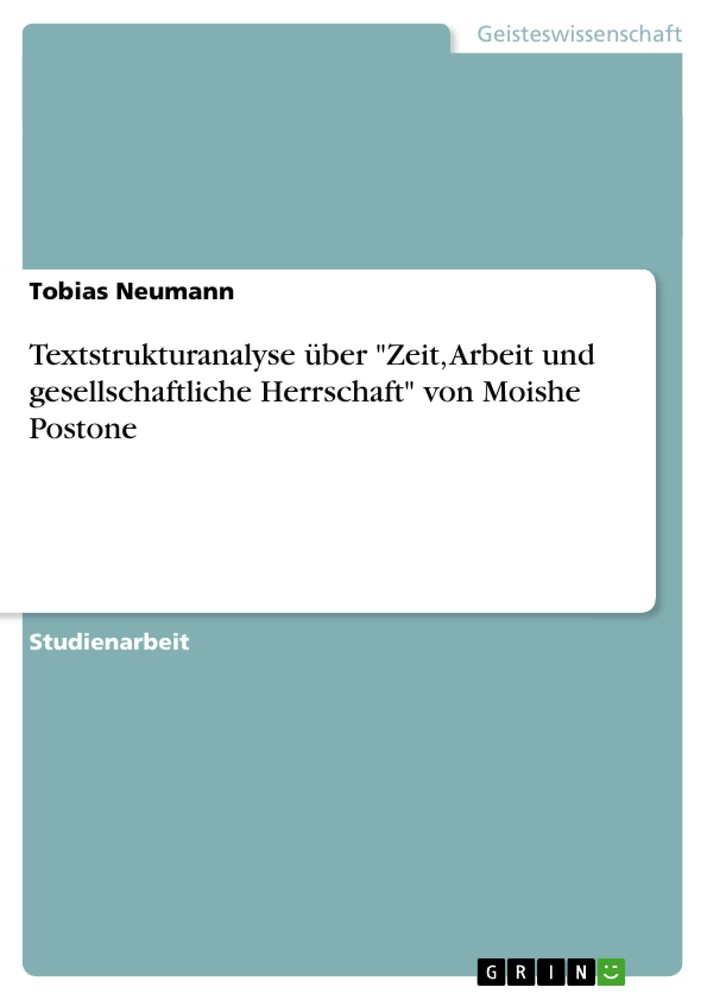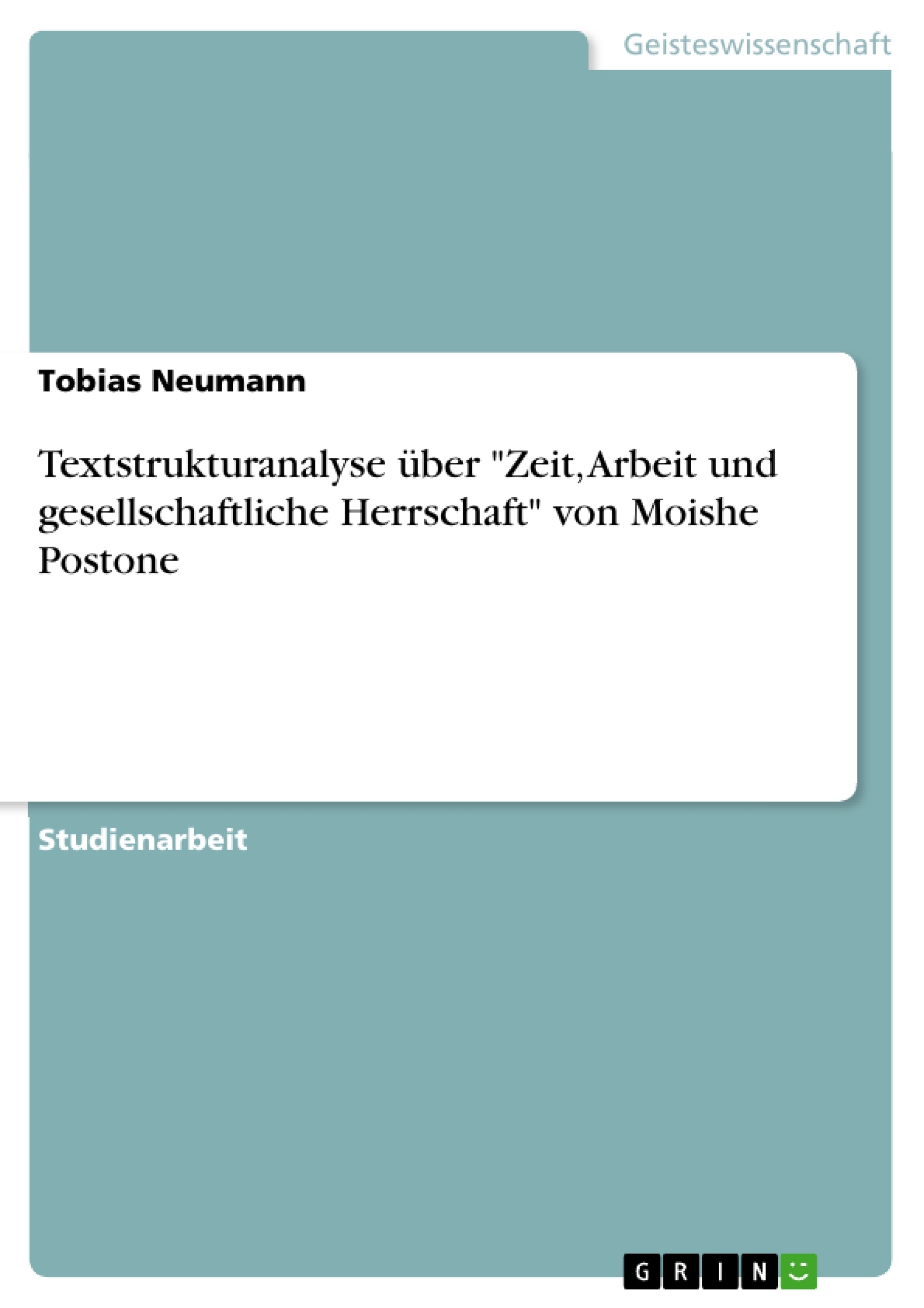Es handelt sich bei diesem Text um eine Textstrukturanalyse des Textes von Moise Postone mit dem Titel "Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft".
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Argumentationsanalyse
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert den Begriff der „abstrakten Zeit" und ihre Entstehung im Kontext der gesellschaftlichen Entwicklung, insbesondere im Zusammenhang mit der Herausbildung des Kapitalismus. Er befasst sich mit der Transformation der Zeitwahrnehmung von einer „konkreten" zu einer „abstrakten" Zeitform und deren Auswirkungen auf die gesellschaftlichen Verhältnisse.
- Die Entwicklung von „konkreter" zu „abstrakter" Zeit
- Die Rolle der Warenförmigkeit in der Entstehung abstrakter Zeit
- Die Verbindung zwischen abstrakter Zeit und gesellschaftlicher Herrschaft
- Die Entfremdung von der Zeit im Kapitalismus
- Die Auswirkungen der Zeit auf das gesellschaftliche Bewusstsein
Zusammenfassung der Kapitel
-
Die Einleitung stellt den Autor Moishe Postone und seine Arbeitsschwerpunkte vor. Sie gibt einen Überblick über die Thematik des Textes, die sich mit der Veränderung der Zeitwahrnehmung und deren Auswirkungen auf die gesellschaftliche Herrschaft auseinandersetzt. Postone argumentiert, dass die heute gebräuchliche Form abstrakter Zeit nicht nur mit der neuen Struktur gesellschaftlicher Verhältnisse verbunden ist, sondern dass sich dadurch auch eine neue Form von Herrschaft konstituiert hat.
-
Die Argumentationsanalyse geht detailliert auf Postones Definitionen von „konkreter" und „abstrakter" Zeit ein. Er beschreibt „konkrete Zeit" als abhängig von Ereignissen und zeigt auf, dass sie in vorkapitalistischen Gesellschaften eine bewegliche Einheit war. Im Gegensatz dazu wird „abstrakte Zeit" als kontinuierlich, gleichförmig und homogen, unabhängig von Ereignissen, dargestellt. Postone argumentiert, dass die Entstehung abstrakter Zeit im Zusammenhang mit der Ausbreitung der Warenförmigkeit in den gesellschaftlichen Verhältnissen steht.
Der Autor beleuchtet die Entwicklung der mechanischen Uhr und ihre Bedeutung für den Übergang zu abstrakter Zeit. Er betont, dass die Erfindung der Uhr nicht allein den Übergang zu abstrakter Zeit auslöste, sondern dass es sich um einen soziokulturellen Prozess handelt, der durch gesellschaftliche Faktoren beeinflusst wird. Postone verweist auf die Bedeutung der Zeitdisziplin in den Klöstern des mittelalterlichen Europas und in den städtischen Zentren, die zu einer zunehmenden Verwendung von Uhren und anderen Messinstrumenten führte.
Postone argumentiert, dass die Entstehung abstrakter Zeit eng mit der Organisation der gesellschaftlichen Zeit und der Modernisierung der Arbeitsweise in der mittelalterlichen Tuchindustrie verbunden ist. Die Einführung von Arbeitsglocken zur Regulierung der Arbeitszeit spiegelt für ihn eine neue Gesellschaftsform wider, in der die Produktivität eine zentrale Rolle spielt. Die Regulierung der Arbeitszeit durch konstante Stunden führte zu einem Bruch zwischen dem ursprünglich von Sonnenaufgang und Untergang geregelten Arbeitstages und einem durch konstante Stunden definierten Arbeitstag, der auch über den Sonnenuntergang hinaus gehen konnte.
Postone zeigt, dass die Durchsetzung abstrakter Zeit mit dem Fortschreiten des Kapitalismus einhergeht. Die Warenform als hegemoniale Strukturform des gesellschaftlichen Lebens verbreitete sich und beeinflusste auch die Zeitwahrnehmung. Die Gleichheit und Teilbarkeit konstanter Zeiteinheiten wurden zu einem Merkmal des alltäglichen Lebens in den Städten und führten zu einer zunehmenden Abstraktifizierung und Quantifizierung der alltäglichen Dinge.
Postone sieht in der abstrakten Zeit eine neue Form von Herrschaft, die sich sowohl in der Herrschaft der Zeit über die Menschen in der Gesellschaft als auch in der Herrschaft der die Zeit zuteilenden, organisierenden und kontrollierenden Klasse manifestiert. Er betont, dass die Herrschaft der Zeit im Kapitalismus zwar gesellschaftlich konstituiert ist, aber einen Zwang auf alle Mitglieder der Gesellschaft ausübt, auch auf die herrschende Klasse.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die „abstrakte Zeit", „konkrete Zeit", „gesellschaftliche Herrschaft", „Kapitalismus", „Warenförmigkeit", „Zeitdisziplin", „Produktivität", „Entfremdung" und „Transformation der Zeitwahrnehmung". Der Text untersucht die Entstehung und Auswirkungen der abstrakten Zeit im Kontext der gesellschaftlichen Entwicklung und ihrer Verbindung zur Herrschaft im Kapitalismus.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Moishe Postone unter "abstrakter Zeit"?
Abstrakte Zeit ist kontinuierlich, gleichförmig und homogen. Sie ist unabhängig von Ereignissen und entstand laut Postone im Zusammenhang mit der kapitalistischen Warenförmigkeit.
Was ist der Unterschied zur "konkreten Zeit"?
Konkrete Zeit ist ereignisabhängig und war in vorkapitalistischen Gesellschaften eine bewegliche Einheit (z.B. geregelt durch Sonnenaufgang und -untergang).
Wie hängen Zeit und gesellschaftliche Herrschaft zusammen?
Postone argumentiert, dass die abstrakte Zeit eine neue Form der Herrschaft konstituiert, da sie einen Zwang zur Produktivität auf alle Gesellschaftsmitglieder ausübt.
Welche Rolle spielte die Erfindung der mechanischen Uhr?
Die Uhr war nicht der alleinige Auslöser, aber ein wichtiges Instrument zur Durchsetzung der Zeitdisziplin, die für die Modernisierung der Arbeitsweise nötig war.
Was bedeutet Entfremdung von der Zeit im Kapitalismus?
Der Mensch wird zum Sklaven konstanter Zeiteinheiten. Die Zeit wird quantifiziert und bestimmt den Rhythmus des Lebens, anstatt dass der Mensch die Zeit selbst bestimmt.
- Quote paper
- Tobias Neumann (Author), 2007, Textstrukturanalyse über "Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft" von Moishe Postone, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178043