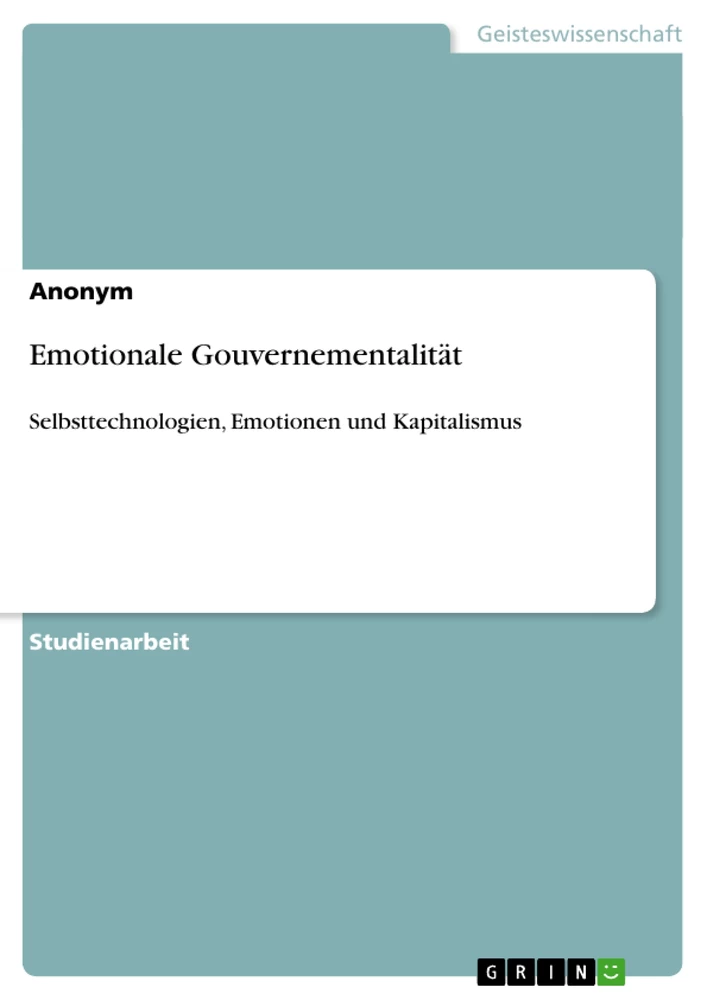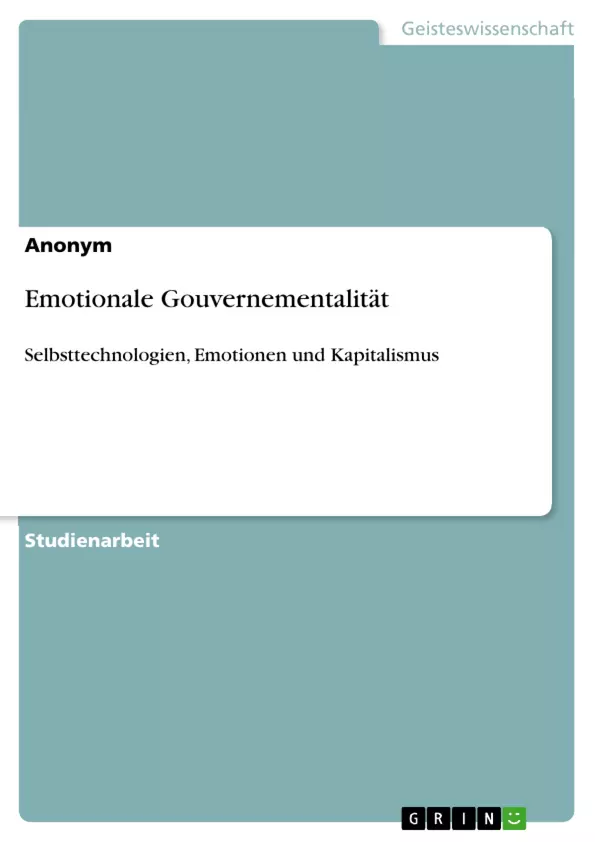Dass Emotionen im modernen Kapitalismus eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielen dürfte spätestens mit Arlie Hochschilds Studie „Das gekaufte Herz“ ein Gemeinplatz in den Sozialwissenschaften sein.
Emotionen spielten allerdings schon bei den Begründern der Soziologie eine Rolle, wenn auch, wie Dirk Baecker feststellt, es bisher nicht zu einer ausgearbeiteten, soziologischen Theorie der Emotionen gekommen sei (vgl. Baecker 2004). Ansätze finden sich bei Talcott Parssons und Georg Simmel. Aber auch Max Weber spricht in Bezug auf die ‚Moderne’ von einer Abstumpfung der Gefühlswelt was auch in Webers bekannter Metapher des „stahlharten Gehäuse(s)“ deutlich wird (vgl. Weber 2010, S. 201). Eva Illouz sieht auch in Webers ‚protestantischer Ethik’ eine emotionssoziologische These formuliert, denn es seien die „Angstaffekte [...] die im Mittelpunkt rastloser unternehmerischer Tätigkeit stehen“ (Illouz 2007b, S. 7). Neuere Ansätze liegen von Kemper, Gerhards, Schützeichel, Esser u.a vor. Die vorliegende Arbeit schließt hauptsächlich an die Arbeiten von Eva Illouz und Sighard Neckel an. Mit Ulrich Bröckling soll außerdem einer Gouvernementalitäts-Perspektive auf Emotionen nachgegangen werden.
Für Illouz ist der Kapitalismus seit Anfang des letzten Jahrhunderts viel stärker durch Emotionalität geprägt als dies normalerweise angenommen wird. Daher spricht sie auch von einem emotionalen Kapitalismus. Diesen Annahmen werde ich in Kapitel 2.1 weiter nachgehen.
Sighard Neckel geht es um die Inanspruchnahme von Emotionen für das Humankapital. Neckel untersucht dabei vor allem das Modell der ‚Emotionalen Intelligenz’, welches in der neueren Zeit in allen gesellschaftlichen Bereichen an Bedeutung gewonnen hat (Kapitel 2.2).
Mir geht es dabei um die Frage, wie sich die vorhandenen Studien zu den Theorien der Gouvernementalität verhalten. Bisher wurde die Bedeutung von Emotionen im Kapitalismus hauptsächlich im Bereich der Unternehmensführung oder im Konsumverhalten untersucht. Ich möchte daher meinen Blick von der ökonomischen Sphäre auf die, im weitesten Sinne politische Sphäre ausweiten.
In der weiteren Analyse möchte ich aufzeigen, dass aus den emotionstheoretischen Überlegungen eine Form der Regierungstätigkeit sichtbar wird, welche als ein autopoietischer Kreislauf von Bedürfniserzeugung und Bedürfnisbefriedigung auftritt (Kapitel 3). Weitere Überlegungen schließen daraufhin an die Autopoiesis des wissenschaftlichen Systems an.(Kapitel 4).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Emotionen, Psychologie - Kapitalismus, Regierung
- Eva Illouz — Vom Geist des emotionalen Kapitalismus
- Sighard Neckel — Die Paradoxien des Emotionsmanagements
- Ulrich Bröckling — Der Kreativitäts- und Empowerment-Imperativ
- Die Autopoiesis der emotionalen Gouvernementalität
- Autopoiesis von Wissenschaft
- Schluß
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Thema der emotionalen Gouvernementalität und untersucht, wie Emotionen im modernen Kapitalismus als Mittel der Selbst- und Fremdregierung eingesetzt werden. Die Arbeit analysiert verschiedene Ansätze zur Verknüpfung von Emotionen, Psychologie, Kapitalismus und Regierungsform und untersucht dabei insbesondere die Theorien von Eva Illouz, Sighard Neckel und Ulrich Bröckling.
- Die Psychologisierung der Arbeitswelt und des Privatlebens
- Die Rolle von Emotionen im Konsumverhalten und im Humankapital
- Die Bedeutung von Selbsttechnologien und Emotionsmanagement
- Die autopoietische Logik der Bedürfniserzeugung und Bedürfnisbefriedigung
- Die Selbstreferenz und die Selbstproduktion von Gegenständen der Wissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Forschungsgegenstand der Arbeit vor und erläutert die Relevanz von Emotionen im modernen Kapitalismus. Sie verweist auf die Bedeutung von Emotionen in der Produktion, im Vertrieb, in der Dienstleistung und im Konsum und stellt die zentralen Theorien der Arbeit, die von Eva Illouz, Sighard Neckel und Ulrich Bröckling vertreten werden, vor.
Das zweite Kapitel behandelt die Verstrickung von Emotionen, Psychologie, Kapitalismus und Regierungsform. Es analysiert die Theorien von Eva Illouz, Sighard Neckel und Ulrich Bröckling, die sich mit der Psychologisierung der Arbeitswelt, dem Emotionsmanagement und dem Kreativitäts- und Empowerment-Imperativ auseinandersetzen.
Im dritten Kapitel wird die Autopoiesis der emotionalen Gouvernementalität untersucht. Die Arbeit zeigt auf, wie durch die Konstruktion von Bedürfnissen und die Formbarkeit des Subjekts ein Kreislauf von Bedürfniserzeugung und Bedürfnisbefriedigung entsteht, der sich durch alle Bereiche der Gesellschaft zieht.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Autopoiesis von Wissenschaft und analysiert, wie die Wissenschaften, insbesondere die Sozialwissenschaften, ihren Gegenstand selbst erzeugen. Die Arbeit zeigt auf, wie durch die Konstruktion von Kategorien und Begriffen neue gesellschaftliche Phänomene geschaffen werden, die wiederum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen werden.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Emotionen, Kapitalismus, Gouvernementalität, Selbsttechnologien, Emotionsmanagement, Psychologisierung, Kreativität, Empowerment, Autopoiesis, Wissenschaft, Bedürfniserzeugung, Bedürfnisbefriedigung, Subjektivierung und gesellschaftliche Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter "emotionalem Kapitalismus"?
Nach Eva Illouz ist der moderne Kapitalismus stark durch Emotionalität geprägt. Gefühle werden ökonomisiert, während gleichzeitig ökonomische Logiken (wie Effizienz) das Privatleben und die Psyche durchdringen.
Was bedeutet "emotionale Gouvernementalität"?
Es beschreibt eine Regierungsform, die nicht durch Zwang, sondern durch die Steuerung von Emotionen und die Selbstführung des Individuums funktioniert (z. B. durch den Imperativ zur Kreativität oder Selbstoptimierung).
Welche Rolle spielt die Psychologisierung der Arbeitswelt?
Emotionale Intelligenz und Soft Skills werden zu Humankapital. Unternehmen nutzen psychologische Ansätze, um die Leistungsbereitschaft und Bindung der Mitarbeiter über deren Gefühlswelt zu steuern.
Was ist der "Kreativitäts-Imperativ" nach Ulrich Bröckling?
Es ist der gesellschaftliche Druck auf das Individuum, ständig kreativ, eigenverantwortlich und unternehmerisch ("Entrepreneurial Self") zu handeln, was zu neuen Formen der Selbstausbeutung führen kann.
Wie hängen Bedürfniserzeugung und Regieren zusammen?
Die Arbeit zeigt auf, dass durch die ständige Erzeugung neuer Bedürfnisse (z. B. nach Anerkennung oder Selbstverwirklichung) ein Kreislauf entsteht, über den Individuen in ökonomische und politische Strukturen eingebunden bleiben.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2011, Emotionale Gouvernementalität, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178191