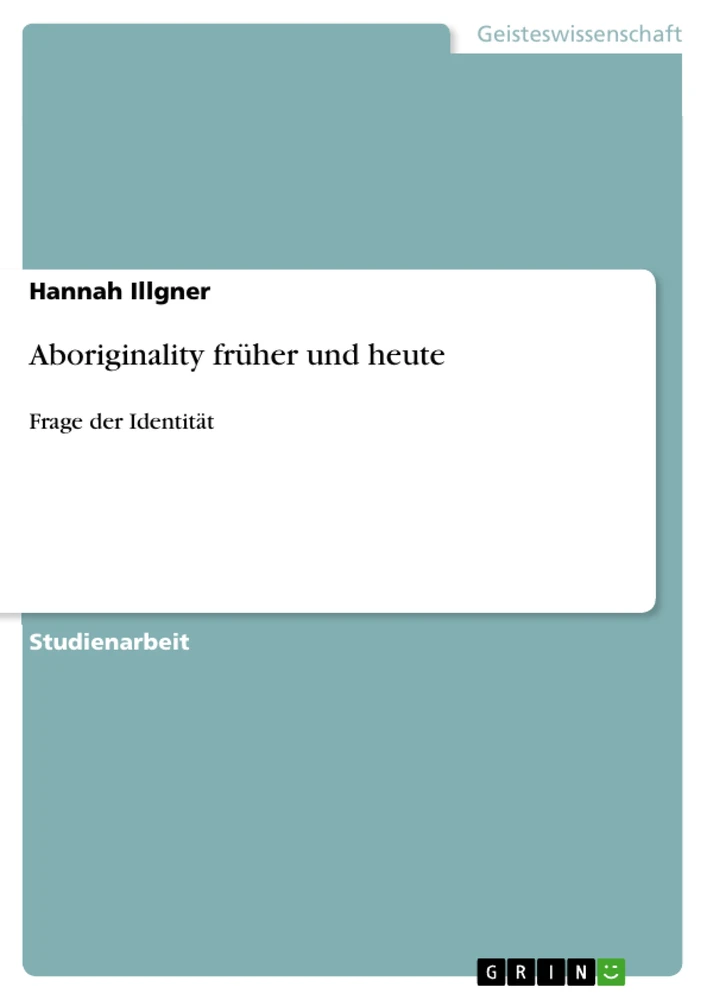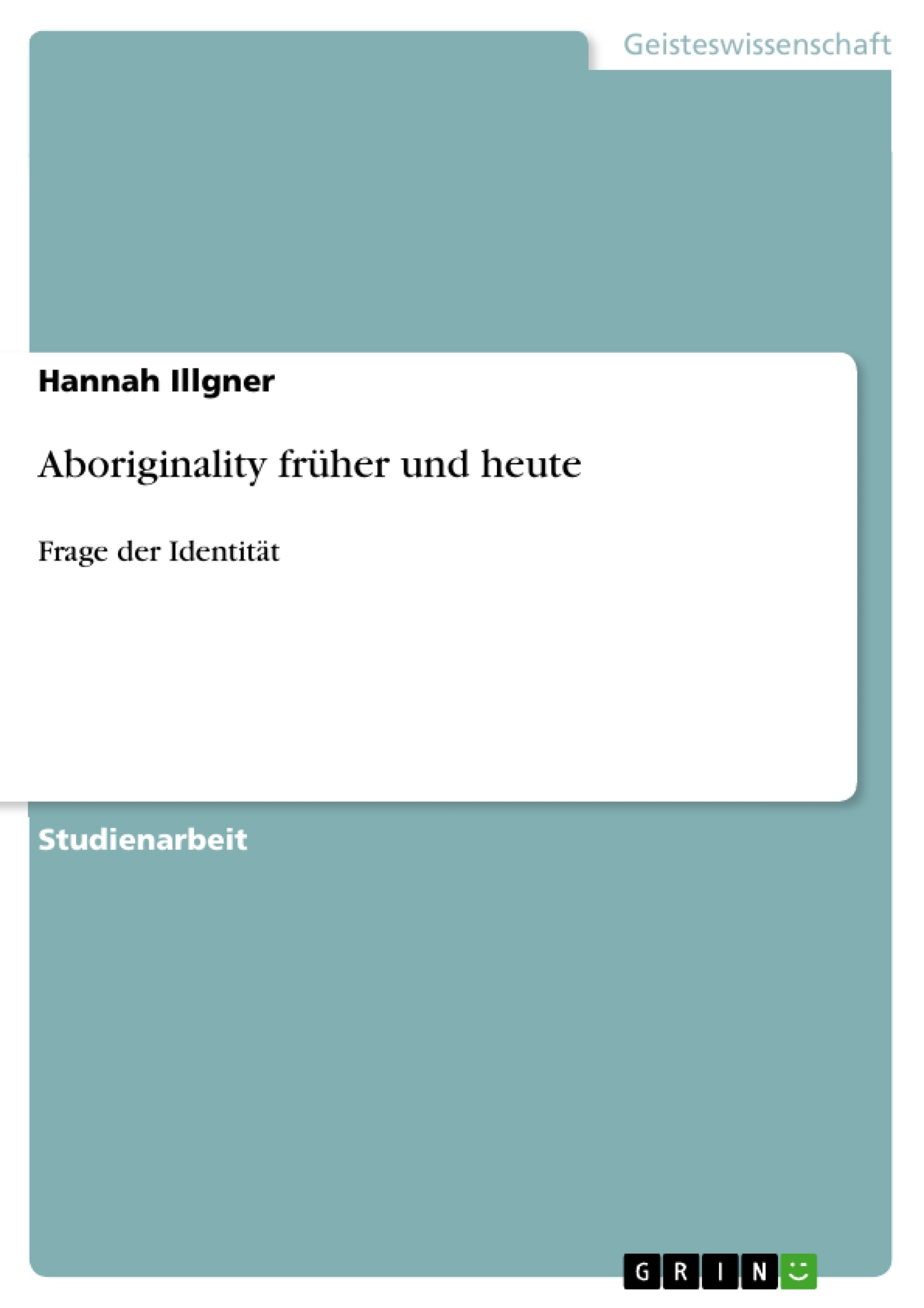Aborigines bevölkern den australischen Kontinent seit mindestens 40 000 Jahren, Schätzungen gehen sogar von bis zu 100 000 Jahren aus. Die Kultur der Aborigines ist hochkomplex: Es gibt mehr als 200 verschiedene Sprachen. Überdies besitzen die Aborigines eine hoch entwickelte Ontologie, die Mensch, Natur und Gesellschaft zu einem unlösbaren Ganzen verbindet. Die britischen Kolonialherren setzten es sich jedoch als Ziel die Kultur und die Traditionen der Aborigines zu zerstören und zu vernichten. Trotz der jahrhundertelangen Geschichte der Unterdrückung, Vertreibung und Tötung haben die Aborigines und ihre Kultur überlebt. Im heutigen Australien leben viele verschiedene Kulturen nebeneinander; die indigene Bevölkerung, die europäischen Einwanderer und weitere Einwanderer aus dem asiatischen Raum. Dieser „Mix“ an Kulturen und Gesellschaften hält ein gewaltiges Konfliktpotenzial bereit, vor allem bezüglich der Vergangenheit.
In dieser Arbeit soll die Gruppe der Aborigines mit Hinblick auf die folgenden Fragestellungen betrachtet werden: Kann man von einer Einheit der Aborigines sprechen? Wie hängt die Vergangenheit mit der heutigen Identität der Aborigines zusammen und wie stellt sich die heutige Situation dar? Was wird oder könnte die Zukunft bringen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Terminologie
- Akkulturation
- Assimilation
- Aborigine
- Aboriginality: Die aboriginale Identität?
- Blick zurück: Die Vergangenheit des australischen Kontinents
- Australien heute: Eine Nation?
- Blick in die Zukunft: Gerechtigkeit?
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Geschichte und die gegenwärtige Situation der Aborigines in Australien. Sie beleuchtet die komplexen Zusammenhänge zwischen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft der indigenen Bevölkerung und fragt nach der Einheit der Aborigines, dem Einfluss der Kolonialgeschichte auf ihre Identität und den Herausforderungen für eine gerechte Zukunft.
- Die Bedeutung der Kolonialgeschichte für die Identität der Aborigines
- Die Definition von „Aborigine“ und „Aboriginality“
- Der Prozess der Akkulturation und Assimilation
- Die Herausforderungen der Nationbildung in Australien
- Der Ausblick auf eine gerechte Zukunft für die Aborigines
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Einheit der Aborigines, dem Zusammenhang zwischen Vergangenheit und Gegenwart ihrer Identität und den Herausforderungen der Zukunft. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich mit grundlegenden Begriffen, der Geschichte der Unterdrückung, der heutigen Situation und einem Ausblick auf die Zukunft beschäftigt. Die Einleitung betont die kulturelle Komplexität der Aborigines und das gewaltige Konfliktpotenzial des kulturellen „Mix“ im heutigen Australien.
Terminologie: Dieses Kapitel definiert wichtige Begriffe wie Akkulturation und Assimilation, differenziert sie voneinander und beleuchtet ihre Bedeutung im Kontext der Geschichte der Aborigines. Es wird der Versuch der Assimilation durch die australische Regierung erläutert, der den bewussten Verlust der Identität der indigenen Bevölkerung zum Ziel hatte. Die verschiedenen Bedeutungen und die Schwierigkeiten bei der Definition von "Aborigine" und "Aboriginality" werden ausführlich diskutiert, unter Berücksichtigung der Fragmentierung der Aborigine-Gemeinschaften und der Diversität ihrer Kulturen und Sprachen. Die Definition des "Department of Aboriginal Affairs" wird kritisch hinterfragt.
Blick zurück: Die Vergangenheit des australischen Kontinents: (Diese Zusammenfassung fehlt im Ausgangstext und müsste aus dem vollständigen Text erstellt werden.)
Australien heute: Eine Nation?: (Diese Zusammenfassung fehlt im Ausgangstext und müsste aus dem vollständigen Text erstellt werden.)
Blick in die Zukunft: Gerechtigkeit?: (Diese Zusammenfassung fehlt im Ausgangstext und müsste aus dem vollständigen Text erstellt werden.)
Schlüsselwörter
Aborigines, Aboriginality, Akkulturation, Assimilation, Identität, Kolonialismus, Australien, Indigene Bevölkerung, Nation, Gerechtigkeit, Kultur, Sprache, Geschichte, Unterdrückung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Australische Aborigines - Geschichte, Gegenwart und Zukunft
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Geschichte und die gegenwärtige Situation der australischen Aborigines. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der komplexen Zusammenhänge zwischen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft der indigenen Bevölkerung, der Frage nach der Einheit der Aborigines, dem Einfluss der Kolonialgeschichte auf ihre Identität und den Herausforderungen für eine gerechte Zukunft.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Die zentralen Themen sind die Kolonialgeschichte und deren Auswirkungen auf die Identität der Aborigines, die Definition von "Aborigine" und "Aboriginality", der Prozess der Akkulturation und Assimilation, die Herausforderungen der Nationbildung in Australien und der Ausblick auf eine gerechte Zukunft für die Aborigines. Die kulturelle Komplexität und die Diversität der Aborigine-Gemeinschaften werden hervorgehoben.
Welche Schlüsselbegriffe werden definiert?
Das Dokument definiert wichtige Begriffe wie Akkulturation und Assimilation und beleuchtet deren Bedeutung im Kontext der Geschichte der Aborigines. Die verschiedenen Bedeutungen und Schwierigkeiten bei der Definition von "Aborigine" und "Aboriginality" werden ausführlich diskutiert, inklusive einer kritischen Betrachtung der Definition des "Department of Aboriginal Affairs".
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument ist in folgende Kapitel gegliedert: Einleitung, Terminologie, Blick zurück: Die Vergangenheit des australischen Kontinents, Australien heute: Eine Nation?, Blick in die Zukunft: Gerechtigkeit?, Schlusswort. Die Kapitelzusammenfassungen für die Einleitung und das Kapitel "Terminologie" sind vollständig vorhanden; die Zusammenfassungen der anderen Kapitel fehlen im vorliegenden Auszug.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Die Arbeit untersucht die Geschichte und die gegenwärtige Situation der Aborigines in Australien und beleuchtet die komplexen Zusammenhänge zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sie fragt nach der Einheit der Aborigines, dem Einfluss der Kolonialgeschichte auf ihre Identität und den Herausforderungen für eine gerechte Zukunft.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen Aborigines, Aboriginality, Akkulturation, Assimilation, Identität, Kolonialismus, Australien, Indigene Bevölkerung, Nation, Gerechtigkeit, Kultur, Sprache, Geschichte, Unterdrückung.
- Quote paper
- Hannah Illgner (Author), 2008, Aboriginality früher und heute, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178205