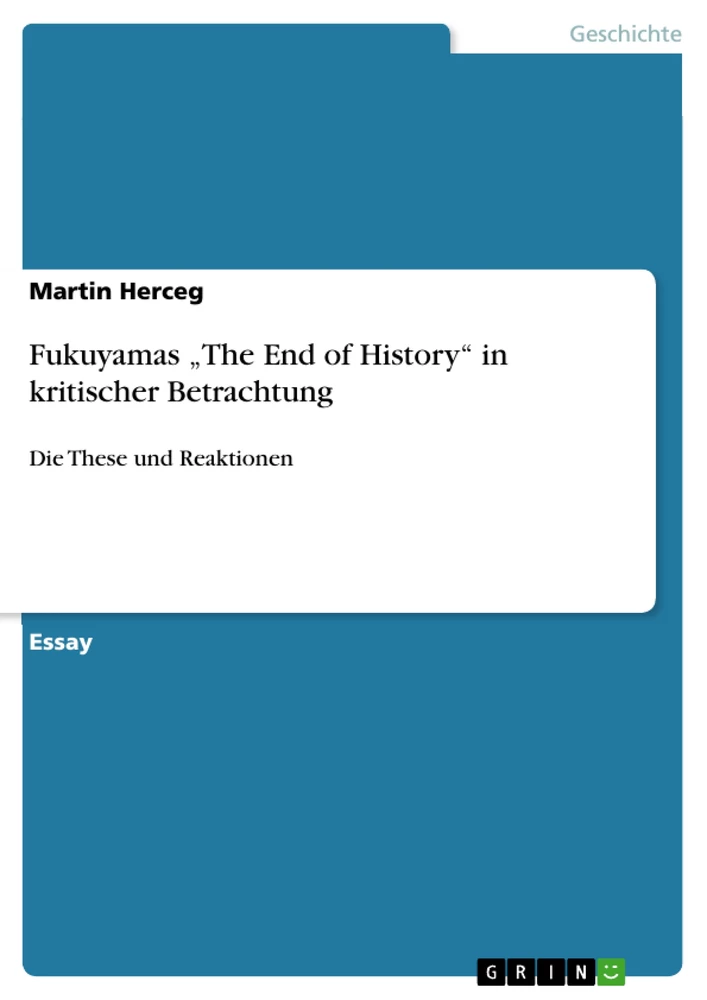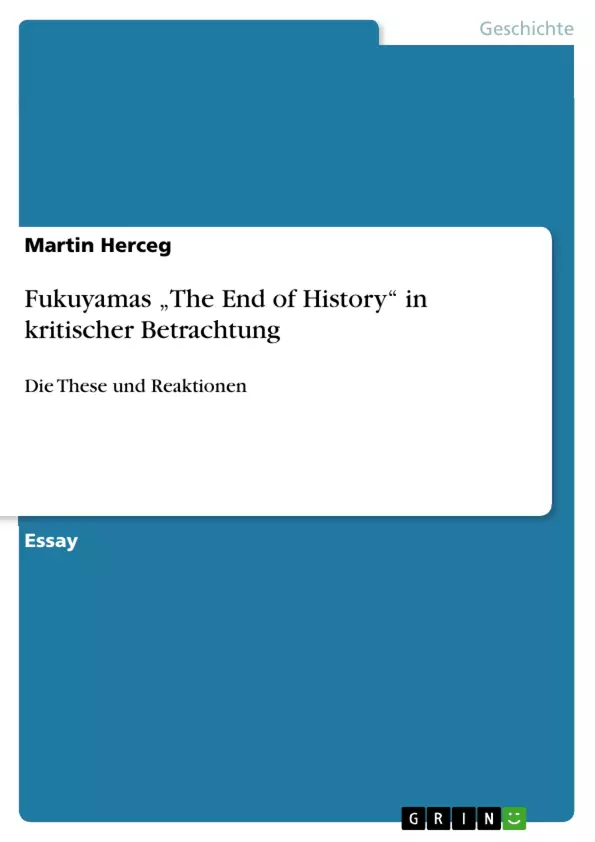Die Veröffentlichung des Aufsatzes „The End of History“ des Geschichtswissenschaftlers und Politologen Francis Fukuyama in der Zeitschrift „The National Interest“ war im Sommer 1989 der Startschuss für eine der kontroversesten Debatten der Geschichtsphilosophie der Neunziger Jahre.
Nun, mehr als zwei Jahrzehnte später, gilt es, einen historischen Blick auf Fukuyamas Ausgangsthese zu legen und diese in einem zweiten Schritt an der zeitgenössischen Kritik zu prüfen.
Francis Fukuyama versuchte in seinem Aufsatz darzulegen, wie sich um das Jahr 1989 ein Konsens über die Legitimität der liberalen Demokratie als Regierungssystem herausgebildet hat, welche andere konkurrierende Formen der Herrschaft, wie die Monarchie, den Faschismus und eben im Jahr 1989, den Kommunismus verdrängt hat. So kommt Fukuyama zu der These, dass die liberale Demokratie möglicherweise den Endpunkt der ideologischen Evolution der Menschen, und daher die endgültige Regierungsform darstellt. In seinem von Hegel und Kojeve geprägtem Verständnis sieht er somit das „Ende der Geschichte“ eingeleitet.
Inhaltsverzeichnis
- 1989 — das Ende der Geschichte?
- Fukuyamas „The End of History" in kritischer Betrachtung
- Die Veröffentlichung des Aufsatzes „The End of History"
- Francis Fukuyama versuchte in seinem Aufsatz darzulegen, wie sich um das Jahr 1989 ein Konsens über die Legitimität der liberalen Demokratie als Regierungssystem herausgebildet hat, welche andere konkurrierende Formen der Herrschaft, wie die Monarchie, den Faschismus und eben im Jahr 1989, den Kommunismus verdrängt hat. So kommt Fukuyama zu der These, dass die liberale Demokratie möglicherweise den Endpunkt der ideologischen Evolution der Menschen, und daher die endgültige Regierungsform darstellt. In seinem von Hegel und Kojeve geprägtem Verständnis sieht er somit das „Ende der Geschichte" eingeleitet.
- In seinem Aufsatz versucht Fukuyama folglich auch zunächst sein Verständnis von Geschichte deutlich zu machen, in dem er auf Hegel verweist, der, wie auch Marx, von Geschichte als kohärenten evolutionären Prozeß, der die Erfahrungen aller Menschen und aller Zeiten umfasst, ausgeht. Des Weiteren führt er mit Kojeve einen weiteren Verfechter der Hegelschen Ideologie auf. In seiner weiteren Argumentation geht Fukuyama auf die beiden großen Hürden für den Liberalismus ein: Den Faschismus und den Kommunismus; welche er beide für gescheitert erklärt und dafür die Entwicklungen Japans, Chinas und er ehemaligen Sowjetunion skizziert. Eine Art Sonderfall sieht er allerdings in China , welches sich zwar von den leninistischen-marxistischen Denkweisen entfernt hat, aber dennoch als kommunistisches Land gilt, das allerdings angetrieben von Streben nach Überschuss und der medialen Entwicklung auch dem Weg des Westens folge.
- Anschließend richtet Fukuyama seinen Fokus auf Widersprüche, die es in „seiner" liberalen Demokratie geben könnte und sieht die Frage der Religion und des Nationalismus als mögliche Störfaktoren.
- Zuletzt stellt Fukuyama die Frage, ob nun mit dem „Ende der Geschichte" auch das Ende von Außenpolitik und internationalen Beziehung eingeläutet sei und nimmt Bezug auf die mögliche Entwicklung im „post-historischen" Russland. Mit der Aussage, dass das Ende der Geschichte eine traurige Zeit sein wird, zeigt Fukuyama am Ende seiner Ausführungen durchaus einen gewissen Grad an persönlicher Enttäuschung und öffnet somit das Feld für Reaktion und Kritik.
- Das Echo, dass Fukuyamas These folgte war, wie wir wissen, enorm. So reagierten in der Folge weltweit Journalisten und Geisteswissenschaftler ,zum Teil äußerst kritisch, auf „das Ende der Geschichte". So auch der britische Historiker Perry Anderson in seiner Monographie „Zum Ende der Geschichte" aus dem Jahr 1992, welche sich nicht nur auf Fukuyamas Aufsatz sondern auch auf dessen späteres Buch „The End of History and the Last Man" bezieht. Anderson beweißt hierbei viel Einfühlungsvermögen und es gelingt ihm zum Kern Fukuyamas Aussagen vorzudringen. Auch Jürgen Busche übt mit seinem in der Süddeutschen Zeitung erschienenen Artikel aus dem Jahr 1991 „Kein Ende der Geschichte" Kritik an Fukuyamas These.
- So sehen beide Kritiker das Gegenargument, dass die Geschichte immer fortlaufe und permanent geschieht als nichtig an, da Fukuyamas These Platz für weitere empirische Ereignisse lässt und daher falsch verstanden worden ist. Auch die sich verändernde „Menschliche Natur" kann der These des „Endes der Geschichte" nichts anhaben.
- Ein weiteres Gegenargument zu Fukuyama ist die nicht vorhandene Berücksichtigung der Konflikte und Ungleichheiten, die sich innerhalb der am Ende stehenden liberalen demokratischen Gesellschaften abzeichnen, denn gerade die Prozesse in diesen neuen Gesellschaften scheinen, wie wir heute wissen, nicht nur durch die „Kräfte des Marktes" lösbar.
- Entscheidet man den stark geschichtsphilosophischen Tenor ausblendet und sich fragt, wer den zielgerichteten Prozess der Geschichte und der Menschheit eingeleitet hat. Hier verlässt sich Fukuyama zu sehr auf Hegel und Kojeve. Auch der Blick auf die Probleme der Gegenwart ist in Fukuyamas Ausführungen fragwürdig. So sieht er wohl mögliche Kriege, Nationalismus, Fanatismus und Armut als Kategorien an, doch die neuen Herausforderungen an die Gesellschaften der Neunziger Jahre, wie die Wissenschaft als unbekannte Größe und die Emanzipation des Menschen werden durch sein rückwärtiges Verständnis ignoriert. So beurteilt Jürgen Busche in seinem Artikel die Geschichte nicht als beendet, sondern als neu und schwerer. Und auch Anderson sieht die Instabilität in Fukuyamas These am Ende seiner Ausführung in Fragen wie der Emanzipation der Frau und anderen Prozessen die mit dem „Ende der Geschichte" eben nicht in Kohärenz schwingen.
- Betrachtet man aus heutiger Sicht die Kontroverse um Fukuyamas Aufsatz stellen sich je nach gewählter Perspektive eine Vielzahl von Fragen: Warum war der Aufschrei in der breiten Öffentlichkeit im Jahr 1989 so groß? Lässt sich Fukuyamas These bis in die heutige Zeit transportieren? Welche Rolle spielen die Umstände des Jahres 1989 für den öffentlichen Diskurs? Welche Kategorien sind aus heutiger Sicht in der Diskussion vernachlässigt worden?
- Diese Fragen zu beantworten stellt eine Herausforderung in der Rückbetrachtung auf das Jahr 1989 für die Geschichtswissenschaft dar.
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit beschäftigt sich mit der Kritik an Francis Fukuyamas Aufsatz „The End of History“ aus dem Jahr 1989. Ziel ist es, die These Fukuyamas im Kontext der damaligen Zeit zu beleuchten und die Kritik an dieser These, insbesondere die von Perry Anderson und Jürgen Busche, zu analysieren.
- Das Ende der Geschichte als Konzept
- Die liberale Demokratie als Endpunkt der ideologischen Evolution
- Kritik an Fukuyamas These aus historischer und philosophischer Perspektive
- Die Rolle von Geschichte und Gesellschaft im Kontext des „Endes der Geschichte“
- Die Relevanz von Fukuyamas These für die Gegenwart
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in den historischen Kontext der Veröffentlichung von Fukuyamas Aufsatz „The End of History“. Es wird erläutert, wie der Fall des Kommunismus in der Sowjetunion und die damit verbundenen Veränderungen in Osteuropa die Debatte über das Ende der Geschichte befeuerten.
Im nächsten Kapitel wird Fukuyamas These des „Endes der Geschichte“ vorgestellt. Es wird erläutert, wie Fukuyama auf Hegel und Kojeve Bezug nimmt und die liberale Demokratie als Endpunkt der ideologischen Evolution der Menschheit darstellt.
Im dritten Kapitel werden die Kritikpunkte von Perry Anderson und Jürgen Busche an Fukuyamas These näher beleuchtet. Beide Kritiker argumentieren, dass Geschichte nicht zu Ende sei, sondern sich permanent weiterentwickle. Sie kritisieren Fukuyamas Fokus auf die liberale Demokratie und die Vernachlässigung von anderen wichtigen Faktoren, wie der Rolle der Religion und des Nationalismus.
Das vierte Kapitel setzt sich mit den Relevanz von Fukuyamas These für die Gegenwart auseinander. Es wird diskutiert, inwiefern die Kritik an Fukuyamas These auch heute noch relevant ist und welche neuen Herausforderungen für die Gesellschaften des 21. Jahrhunderts relevant sind.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Ende der Geschichte, die liberale Demokratie, Francis Fukuyama, Perry Anderson, Jürgen Busche, Geschichtsphilosophie, Ideologie, Kommunismus, Nationalismus, Religion, Geschichte und Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernaussage von Fukuyamas „The End of History“?
Fukuyama vertritt die These, dass die liberale Demokratie den Endpunkt der ideologischen Evolution der Menschheit und somit die endgültige Regierungsform darstellt.
Warum gilt das Jahr 1989 als Wendepunkt in dieser Theorie?
Mit dem Scheitern des Kommunismus und dem Ende des Kalten Krieges sah Fukuyama den Sieg des Liberalismus über konkurrierende Ideologien wie Faschismus und Monarchie als besiegelt an.
Welche Rolle spielen Hegel und Kojève in Fukuyamas Argumentation?
Fukuyama stützt sich auf deren Verständnis von Geschichte als kohärentem, evolutionärem Prozess, der auf ein bestimmtes Ziel zusteuert.
Welche Kritik üben Perry Anderson und Jürgen Busche an der These?
Die Kritiker argumentieren, dass Geschichte permanent weiterläuft und Fukuyama wichtige Faktoren wie Religion, Nationalismus und soziale Ungleichheiten vernachlässigt.
Wie bewertet die Arbeit Fukuyamas Sicht auf China?
Fukuyama sah China als Sonderfall, das sich zwar ökonomisch öffnet, aber politisch kommunistisch bleibt, wobei er dennoch eine langfristige Annäherung an den Westen prognostizierte.
Ist Fukuyamas These aus heutiger Sicht noch relevant?
Die Arbeit diskutiert, ob die These in die heutige Zeit transportiert werden kann oder ob neue Herausforderungen wie Wissenschaft und Emanzipation sein rückwärtiges Verständnis widerlegen.
- Citar trabajo
- Martin Herceg (Autor), 2011, Fukuyamas „The End of History“ in kritischer Betrachtung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178220