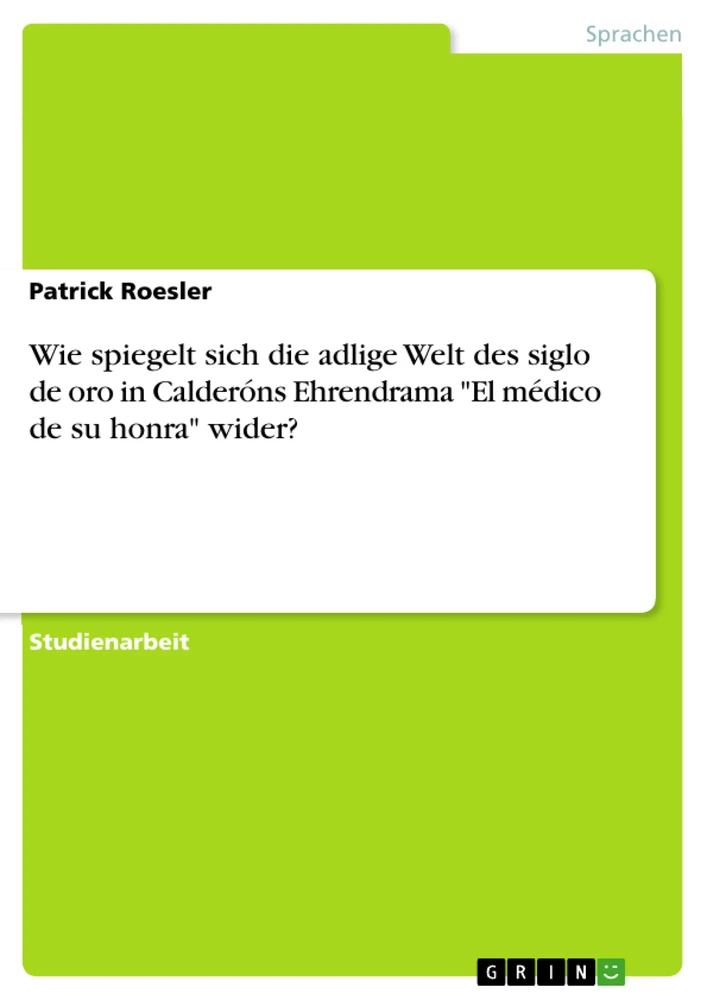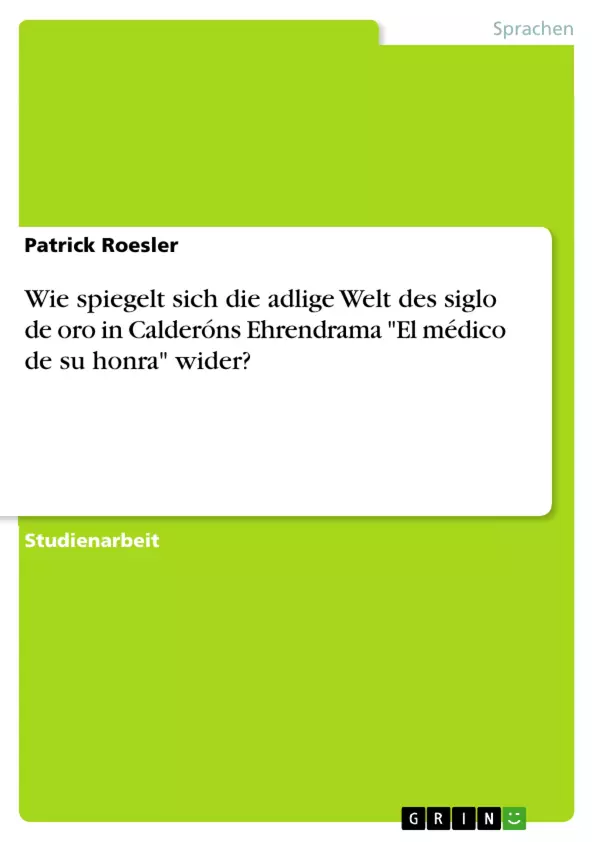In dieser Arbeit beschäftige ich mich mit dem Ehrbegriff im Theaterstück "Der Arzt seiner Ehre" von Pedro Calderón de la Barca.
Seit Mitte des 16. Jahrhunderts hatte sich die Rivalität zwischen der Weltmacht Spanien und der Handelsnation England immer weiter verschärft. Englische Freibeuterschiffe bedrohten ständig die zwischen der Neuen Welt und Spanien verkehrenden Schiffsverbände, die Edelmetalle, und somit die Geldmittel für den riesige Summen verschlingenden Staatsapparat, nach Spanien brachten. Um sich zu rächen und den guten Ruf der spanischen Flotte wiederherzustellen, zog Philipp II. 1588 die gesamten Kräfte im Hafen von Lissabon zusammen. Zwar fehlte an allen Ecken und Enden das dafür nötige Geld und Essensrationen, doch der spanische König ließ sich davon nicht beirren.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Pedro Calderón de la Barca
- Zum Inhalt von "El médico de su honra"
- Ehrbegriff und Adel
- Spiegel der Wirklichkeit oder poetisierte Welt?
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit der Reflexion der adligen Welt des siglo de oro im Ehrendrama "El médico de su honra" von Pedro Calderón de la Barca. Ziel ist es, die Darstellung des Adels und seiner Werte in dem Stück zu untersuchen und die Frage zu beleuchten, inwieweit dieses Drama ein Spiegelbild der spanischen Gesellschaft des 17. Jahrhunderts ist oder eine idealisierte Welt präsentiert.
- Die Rolle des Ehrebegriffs im spanischen Adel
- Die Darstellung der adligen Moral und Lebensweise
- Die Beziehung zwischen Realität und Fiktion im Theater des siglo de oro
- Die Funktion des Dramas als Spiegelbild der Gesellschaft oder als Mittel zur Vermittlung moralischer Werte
- Die Bedeutung des "El médico de su honra" im Kontext des spanischen Theaters
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort beleuchtet die historische Situation Spaniens im 16. Jahrhundert, die von Rivalität mit England und dem Glauben an die eigene Weltherrschaft geprägt war. Die folgende Sektion widmet sich Pedro Calderón de la Barca, seinem Leben und Werk, mit Fokus auf seine bedeutendsten Theaterstücke und seine Rolle als Hofdramatiker. Der Abschnitt "Zum Inhalt von 'El médico de su honra'" skizziert die Handlung des Dramas, in der der infante Enrique und Doña Mencía, die in ein Landhaus zurückkehren, in alte Gefühle wieder verfallen. Diese Situation stellt ein Dilemma dar, da Mencía mit Don Gutierre verheiratet ist. Die folgenden Kapitel thematisieren den Ehrenbegriff im Adel und die Frage, inwieweit "El médico de su honra" ein Spiegelbild der Realität oder eine poetisierte Welt widerspiegelt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen des Textes sind: spanisches Theater, siglo de oro, Ehrendrama, Pedro Calderón de la Barca, "El médico de su honra", Adel, Ehrenbegriff, Realität, Fiktion, Gesellschaft, Moral, Tugend, Weltmacht, Spanien, England, Katholizismus.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt der Ehrenbegriff in Calderóns "El médico de su honra"?
Der Ehrenbegriff ist das zentrale Motiv des Dramas und bestimmt das Handeln der adligen Charaktere im spanischen Siglo de Oro, wobei die Ehre oft als fragiles Gut dargestellt wird, das durch äußere Umstände bedroht ist.
Wer ist der Autor von "Der Arzt seiner Ehre"?
Das Stück wurde von Pedro Calderón de la Barca verfasst, einem der bedeutendsten Dramatiker des spanischen Goldenen Zeitalters und damaligen Hofdramatiker.
Ist das Drama ein getreues Spiegelbild der spanischen Gesellschaft des 17. Jahrhunderts?
Die Arbeit untersucht genau diese Frage: Ob das Werk die reale adlige Welt widerspiegelt oder eine poetisierte, idealisierte Version der gesellschaftlichen Moral präsentiert.
Was ist der historische Hintergrund der Einleitung dieser Arbeit?
Der Text beleuchtet die Rivalität zwischen Spanien und England im 16. Jahrhundert, insbesondere die Bedrohung der spanischen Flotte durch Freibeuter und die Reaktion Philipps II. im Jahr 1588.
Welche zentralen Themen werden in der Analyse behandelt?
Zu den Schwerpunkten gehören die adlige Moral, das Verhältnis von Realität und Fiktion im Theater sowie die Funktion des Dramas als Mittel zur Vermittlung von Werten.
- Quote paper
- Patrick Roesler (Author), 2002, Wie spiegelt sich die adlige Welt des siglo de oro in Calderóns Ehrendrama "El médico de su honra" wider?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178225