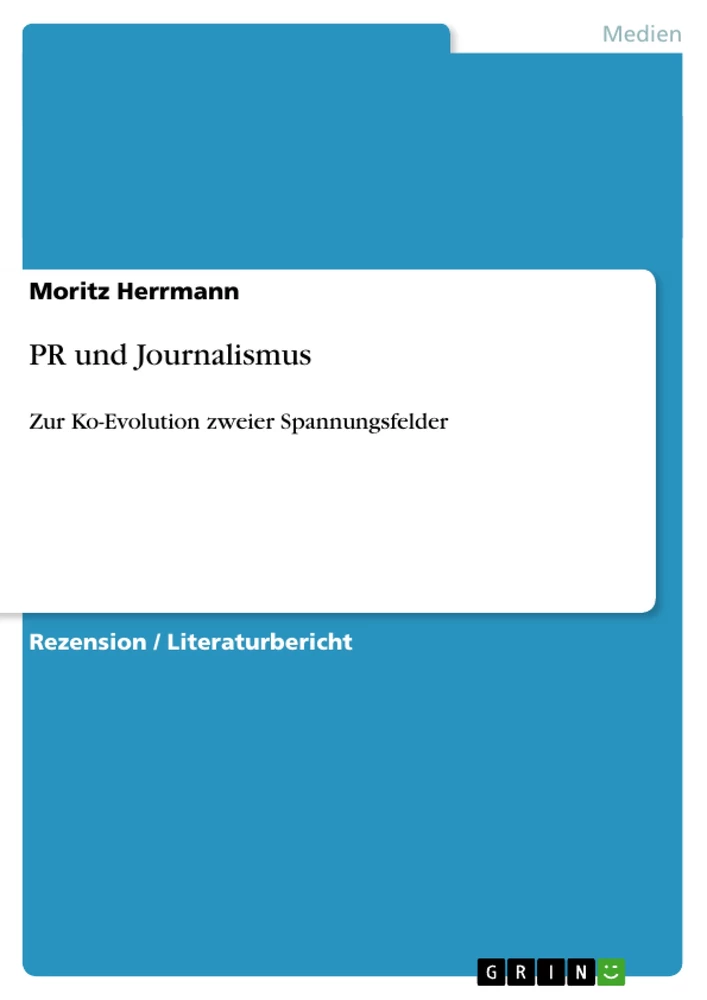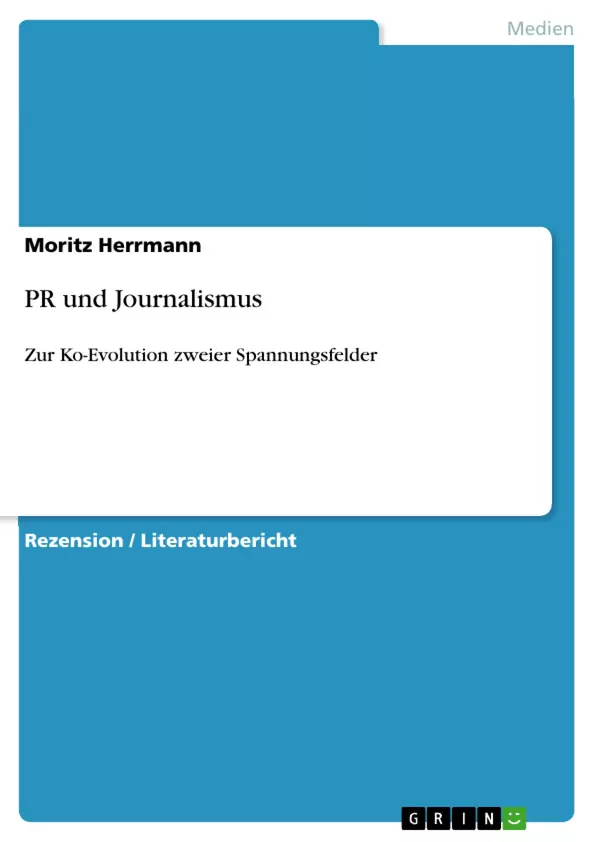Derzeit will niemand Papst sein. Eine Hysterie, die einer tragischen Komik nicht entbehrt, immerhin hat das kirchliche Oberhaupt de facto nichts falsch gemacht. Das zeigt ein lesenswerter SPIEGEL-Essay1 von Martin Mosebach. Dabei gelingt dem Schriftsteller auf zwei Seiten, was der Vatikan in zwei Wochen nicht zustande brachte: Die brisante Situation zu entschärfen. Die Aufhebung der Exkommunikation der vier Bischöfe um Pius-Bruder Richard Williamson bedeutet zwar eine gewisse Rehabilitation des Holocaust-Leugners und ist als solche strittig, aber unter anderen Gesichtspunkten durchaus nachzuvollziehen: Benedetto will verhindern, dass die Bischöfe ihr radikales Gedankengut weitertragen. Die Reintegration in das römische System verbietet das, weil die Bischöfe nach wie vor suspendiert bleiben, also nicht predigen dürfen, aber nunmehr kontrolliert werden können. Den Feind schwächen, indem man ihn zum Teil des eigenen Apparates macht, sich den Feind zum Freund machen – eine uralte Taktik, der sich schon biblische Könige bedienten. Dass also überhaupt erst empörte Stimmen laut werden konnten, die dem deutschen Papst mit Hitler-Jugend-Vergangenheit rechte Gesinnung unterstellen, oder aber Bundeskanzlerin Merkel sich mit scharfer Rüge an der vatikanischen Personalpolitik als Wahlkämpferin zu profilieren versucht, ist nicht dem was geschuldet, sondern dem wie. In der Sache die Aufregung gar nicht wert, hat erst die lückenhafte Kommunikation des Themas eine weltweite Beschwerdenlawine losgetreten. Ergo ist die Schuld weniger beim Pontifex als vielmehr bei der Pressestelle des Vatikans zu suchen. Einmal mehr hat diese bewiesen, dass sie nicht auf der Höhe der informationstechnischen Rasanz des 21. Jahrhunderts zu sein scheint. Behäbig, bürokratisch, bloßgestellt – Noch bevor man die Aufhebung der Exkommunikation mit einer offiziellen Meldung kommentieren und erklären konnte, sah sich der Papst auf den Titelblättern dieser Welt als Hetzer diffamiert. Deshalb muss die Frage erlaubt sein: Hat die Kirche in 144 Jahren nichts dazugelernt, sich gar zurückentwickelt?
Inhaltsverzeichnis
- Wissenschaftliche Ansätze zum Verhältnis von Journalismus und PR
- Der Ursprung von PR
- Erste Ergebnisse zur Ko-Evolution von Journalismus und PR auf Basis der PR-Geschichtsforschung
- Schlussdiskussion
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Essay von Philomen Schönhagen befasst sich mit der Ko-Evolution von Public Relations und Journalismus. Ziel des Aufsatzes ist es, die Entstehung und Entwicklung der Public Relations im Kontext des Journalismus zu untersuchen und deren Wechselwirkung aufzuzeigen.
- Die Entstehung von Public Relations als Reaktion auf Fehlentwicklungen und Versäumnisse der Massenmedien
- Die Rolle von Public Relations als Gegenöffentlichkeit
- Die Abhängigkeit und Interaktion von Public Relations und Journalismus
- Die Bedeutung von Public Relations für die Meinungsbildung und -vielfalt
- Die Herausforderungen für den Journalismus im Zeitalter der Informations- und Kommunikationstechnologien
Zusammenfassung der Kapitel
Der Essay beginnt mit einer Analyse wissenschaftlicher Ansätze zum Verhältnis von Journalismus und PR. Schönhagen beleuchtet die Defizite dieser Theorien und leitet daraus die Zielsetzung ihrer Arbeit ab, die sich auf die Frage nach dem Ursprung von PR konzentriert. Im nächsten Abschnitt untersucht sie die Entstehung von Public Relations und fasst anschließend historische Ergebnisse zur Ko-Evolution von Journalismus und PR zusammen.
Besonders interessant ist die Auseinandersetzung mit dem Wesen und Verständnis von Public Relations. Schönhagen widerlegt den Irrglauben, PR sei lediglich eine Ausdifferenzierung der Werbung, indem sie historische Beispiele aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft heranzieht. Sie argumentiert, dass PR als Gegenöffentlichkeit entstanden ist, um auf einseitige oder fehlende Berichterstattung in den Massenmedien zu reagieren.
Im weiteren Verlauf des Essays analysiert Schönhagen die Abhängigkeit und Interaktion von Public Relations und Journalismus. Sie beleuchtet, wie beide Bereiche voneinander profitieren und sich gegenseitig beeinflussen. Dabei werden sowohl die Vor- als auch die Nachteile der Zusammenarbeit zwischen PR und Journalismus beleuchtet.
Schließlich stellt Schönhagen fest, dass die Ko-Evolution von Public Relations und Journalismus einen fundamentalen Wandel in der Kommunikation bewirkt hat. Sie plädiert für eine umfassende Massenkommunikationstheorie, die die wechselseitige Abhängigkeit und die Rolle des Publikums in diesem Prozess berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Public Relations, Journalismus, Ko-Evolution, Gegenöffentlichkeit, Massenmedien, Informations- und Kommunikationstechnologien, Meinungsbildung, -vielfalt, historische Analyse, PR-Geschichte, Medienpolitik und Kommunikationstheorie.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet die Ko-Evolution von PR und Journalismus?
Es beschreibt die gleichzeitige und wechselseitige Entwicklung beider Bereiche, die sich gegenseitig beeinflussen und voneinander abhängig sind.
Warum entstand Public Relations (PR)?
PR entstand oft als Reaktion auf einseitige Berichterstattung oder Versäumnisse der Massenmedien, um eine „Gegenöffentlichkeit“ zu schaffen.
Sind PR und Werbung dasselbe?
Nein, während Werbung auf Absatz zielt, geht es bei PR um den Aufbau von Vertrauen, Image und langfristigen Beziehungen zur Öffentlichkeit.
Wie beeinflusst PR die journalistische Arbeit?
PR liefert Informationen und Themenvorschläge; Journalisten nutzen diese oft als Quellen, müssen sie aber kritisch prüfen (Interdependenz-Modell).
Was war das Kommunikationsproblem des Vatikans im Fall Williamson?
Eine lückenhafte und behäbige Kommunikation führte dazu, dass die Absichten des Papstes missverstanden wurden und ein weltweiter Proteststurm entstand.
- Quote paper
- Moritz Herrmann (Author), 2009, PR und Journalismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178228