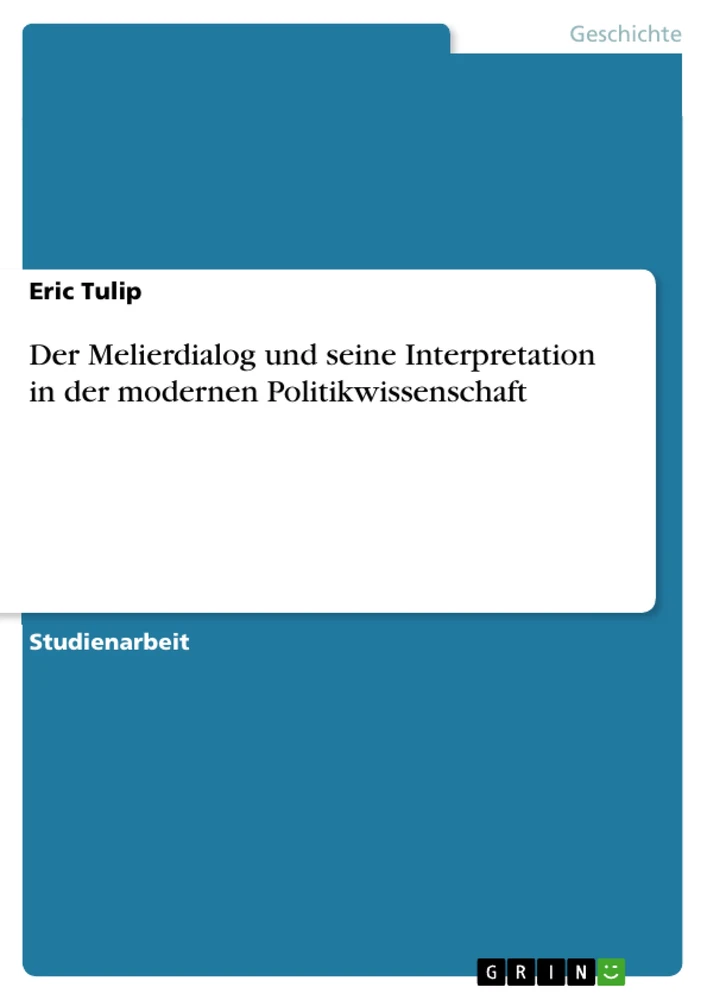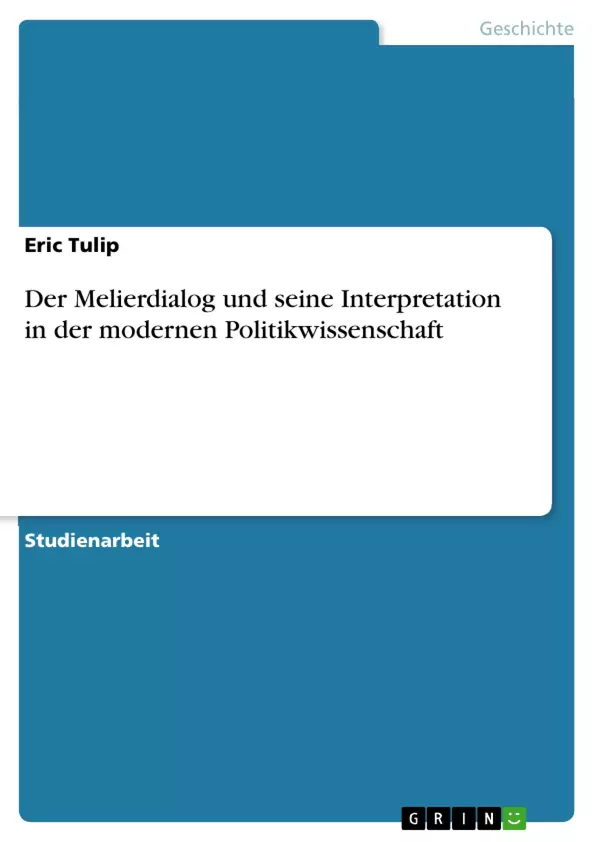Das Ziel dieser Arbeit besteht aus zwei Teilen: Zum einen wird untersucht, aus welchen Gründen und wie Untersuchungen von Politikwissenschaftlern den Dialog zwischen Athenern und Meliern, in Thukydides Werk „Der Peloponnesische Krieg“, interpretieren und welche Schlussfolgerungen sie daraus für Thukydides und die historischen Ereignisse, auf der einen Seite, und für die politische Theorie Internationaler Beziehungen, auf der anderen Seite, zeihen. Resultierend aus der Kritik der Vorgehensweise der Politikwissenschaftler, werden zu dann Schlussfolgerungen gezogen, was jene von der Geschichtswissenschaft bei der Interpretation historischer Quellen lernen können, umgekehrt gilt aber auch: die Geschichtswissenschaft sollte ihre Überlegungen für Erkenntnissen der Politikwissenschaft zugänglich machen.
Zunächst werden in der Arbeit Thukydides und sein Werk vor- und der Peloponnesische Krieg in Grundzügen dargestellt. Nachdem der Melierdialog und seine Interpretationen durch die „Realistische Schule“ vorgestellt wurden, werden, auch mit Hilfe dieser Grundzüge, schließlich (quellen-) kritische Überlegungen zu den Interpretationen getätigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thukydides und sein Werk
- Einordnung des Melierdialogs in den Peloponnesischen Krieg
- Verwendung des Melierdialogs in der modernen Politikwissenschaft
- Thukydides und die Realisten
- Zentrale Punkte in der Argumentation des Melierdialogs
- Der Melierdialog in seiner Reflexion in der „Realistischen Schule“
- Der staatliche Drang nach Macht und Herrschaftsausweitung als Naturgesetz
- Spannungsverhältnis zwischen Macht und Moral
- Staatliches Handeln und menschliche Natur
- Kritik an der „realistischen“ Interpretation des Melierdialogs
- Schlussbetrachtung – Vorteile und Irrtümer einer „realistischen Interpretation“ des Melierdialogs
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Interpretation des Melierdialogs aus Thukydides' "Peloponnesischem Krieg" in der modernen Politikwissenschaft, insbesondere im Kontext des Realismus. Sie analysiert, wie Politikwissenschaftler den Dialog interpretieren und welche Schlussfolgerungen sie daraus für Thukydides' Werk und die Internationale Beziehungen ziehen. Die Arbeit beleuchtet kritisch die Vorgehensweise der Politikwissenschaftler und zieht Schlussfolgerungen darüber, was sowohl die Geschichtswissenschaft von der Politikwissenschaft lernen kann, als auch umgekehrt.
- Interpretation des Melierdialogs in der realistischen Schule der Internationalen Beziehungen
- Kritische Analyse der methodischen Ansätze der Politikwissenschaft bei der Interpretation historischer Quellen
- Der Beitrag der Geschichtswissenschaft zur Interpretation des Melierdialogs
- Das Verhältnis von Macht und Moral im Melierdialog
- Thukydides' Geschichtschreibung und seine methodischen Überlegungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Bedeutung der Bezugnahme auf historische Quellen in den Geistes- und Sozialwissenschaften und führt den Melierdialog als zentrale Wurzel des politischen Realismus ein. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Interpretation des Dialogs durch Politikwissenschaftler zu untersuchen und Schlussfolgerungen für die Interdisziplinarität von Geschichts- und Politikwissenschaft zu ziehen.
Thukydides und sein Werk: Dieses Kapitel stellt Thukydides und sein Werk "Der Peloponnesische Krieg" vor. Es beleuchtet Thukydides' Leben, seine Rolle im Krieg, seine methodischen Ansätze und seine kritische Distanz zu anderen Geschichtswerken. Besonderes Augenmerk wird auf Thukydides' Herangehensweise an die Darstellung von Reden gelegt, welche als rekonstruierte, aber nicht wörtliche Zitate verstanden werden müssen.
Einordnung des Melierdialogs in den Peloponnesischen Krieg: Dieses Kapitel würde den historischen Kontext des Melierdialogs innerhalb des Peloponnesischen Krieges detailliert beschreiben und seine Bedeutung für den Verlauf des Krieges und die Machtstrukturen der damaligen Zeit erörtern. Die strategischen Überlegungen und politischen Hintergründe des Konflikts zwischen Athen und Melos werden analysiert, um den Dialog in seine historische Einbettung zu bringen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Melierdialog
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Interpretation des Melierdialogs aus Thukydides' „Peloponnesischem Krieg“ in der modernen Politikwissenschaft, insbesondere im Kontext des politischen Realismus. Sie untersucht, wie Politikwissenschaftler den Dialog interpretieren und welche Schlussfolgerungen sie daraus für Thukydides' Werk und die Internationale Beziehungen ziehen. Ein weiterer Fokus liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit den methodischen Ansätzen der Politikwissenschaft und den daraus resultierenden Schlussfolgerungen für die Interdisziplinarität von Geschichts- und Politikwissenschaft.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Interpretation des Melierdialogs in der realistischen Schule der Internationalen Beziehungen, eine kritische Analyse der methodischen Ansätze der Politikwissenschaft bei der Interpretation historischer Quellen, den Beitrag der Geschichtswissenschaft zur Interpretation des Melierdialogs, das Verhältnis von Macht und Moral im Melierdialog sowie Thukydides' Geschichtschreibung und seine methodischen Überlegungen. Die Arbeit beinhaltet auch eine Einleitung, die die Bedeutung historischer Quellen in den Geistes- und Sozialwissenschaften betont, und eine Schlussbetrachtung, die die Vor- und Nachteile einer realistischen Interpretation des Melierdialogs beleuchtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zu Thukydides und seinem Werk, ein Kapitel zur Einordnung des Melierdialogs in den Peloponnesischen Krieg, ein umfangreiches Kapitel zur Verwendung des Melierdialogs in der modernen Politikwissenschaft (inkl. Unterkapiteln zu den Realisten, zentralen Argumentationspunkten, der „realistischen Schule“, Kritik an der realistischen Interpretation), und abschließend eine Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung der behandelten Inhalte.
Welche Rolle spielt Thukydides und sein Werk?
Thukydides und sein Werk „Der Peloponnesische Krieg“ bilden die Grundlage der Arbeit. Das Kapitel zu Thukydides beleuchtet sein Leben, seine Rolle im Peloponnesischen Krieg, seine methodischen Ansätze und seine kritische Distanz zu anderen Geschichtswerken. Besonderes Augenmerk wird auf seine Herangehensweise an die Darstellung von Reden gelegt, die als rekonstruierte, aber nicht wörtliche Zitate zu verstehen sind. Der Melierdialog wird als zentrales Element seines Werkes und als Ausgangspunkt für die realistische Interpretation in der Politikwissenschaft betrachtet.
Wie wird der Melierdialog in der modernen Politikwissenschaft interpretiert?
Die Arbeit analysiert die Interpretation des Melierdialogs durch die „realistische Schule“ der Internationalen Beziehungen. Sie untersucht die zentralen Argumente des Dialogs, wie der staatliche Drang nach Macht und Herrschaftsausweitung als Naturgesetz, das Spannungsverhältnis zwischen Macht und Moral und die Verbindung zwischen staatlichem Handeln und menschlicher Natur. Die Arbeit enthält aber auch eine kritische Auseinandersetzung mit dieser Interpretation.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen darüber, was sowohl die Geschichtswissenschaft von der Politikwissenschaft lernen kann, als auch umgekehrt. Die Schlussbetrachtung bewertet die Vor- und Nachteile einer „realistischen Interpretation“ des Melierdialogs und beleuchtet die Bedeutung interdisziplinärer Ansätze bei der Interpretation historischer Quellen.
- Quote paper
- Eric Tulip (Author), 2009, Der Melierdialog und seine Interpretation in der modernen Politikwissenschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178327