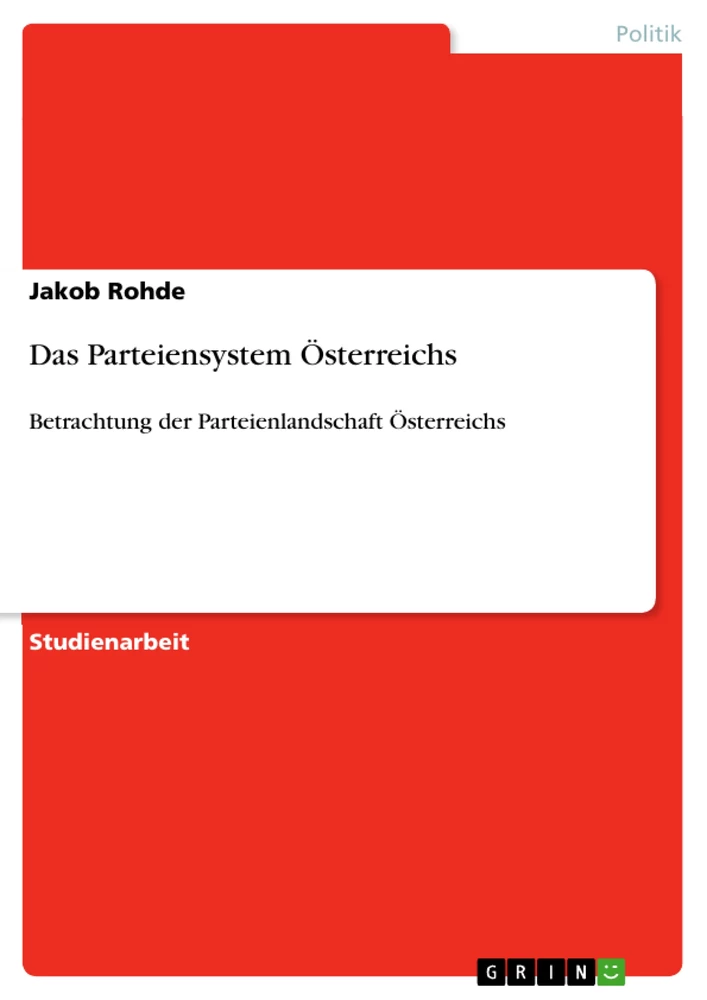Die politische Landschaft in Österreich war in den vergangen vierzig Jahren eine der stabilsten in Europa. Überspitzt konnte man hier schon von einem zwei Parteiensystem sprechen. Diese Lage änderte sich jedoch in den letzten Jahren erheblich und begann zu wackeln. Ähnlich wie in Deutschland, wurde das System zweier großer Volksparteien, durch politische Flügelparteien aufgerüttelt. In Deutschland ist es die Partei „Die Linke“ und in Österreich die FPÖ, sowie die BZÖ.
In meiner Arbeit möchte ich dieses Phänomen versuchen zu erklären, werde mich dabei aber hauptsächlich auf Österreich beziehen. Die Literatur bezeichnet es als „Lücke“ im Parteiensystem und inwieweit dies zutrifft, möchte ich zeigen . Die These bezieht sich darauf, dass durch das Ansiedeln der Volksparteien in der politischen Mitte, Randgruppen wie Links und Rechts an Stimmen dazu gewinnen können, da die „großen“ Parteien diese nicht mehr abdecken können. Dies gilt auch als eine der Begründungen für den Erfolg der Linkspartei in Deutschland.
Zunächst aber möchte ich einen Überblick über das österreichische System geben. Beginnen möchte ich dabei mit einer kurzen Einführung in das Wahlsystem, sowie über die verschiedenen Parteien. Anschließend möchte ich die letzten wichtigen Wahlen und ihre Ergebnisse präsentieren, bevor ich dann versuche die These einer „Lücke“ im System zu erläutern. Schließen werde ich dann mit einem Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Wahlsystem und die politischen Organe Osterreichs
- Die österreichischen Parteien, ihre rechtliche Grundlage und Geschichte
- Die politische Lage und „Lücke im Parteiensvstem
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Entwicklung des österreichischen Parteiensystems und beleuchtet insbesondere das Phänomen der „Lücke" im System. Die Arbeit zielt darauf ab, die Gründe für die Entstehung dieser „Lücke" zu erforschen, die Auswirkungen auf die politische Landschaft zu analysieren und die Rolle der „populistischen Parteien" in diesem Kontext zu beleuchten.
- Das österreichische Wahlsystem und seine Funktionsweise
- Die wichtigsten österreichischen Parteien und ihre Geschichte
- Die Entstehung und Bedeutung der „Lücke" im Parteiensystem
- Die Rolle der „populistischen Parteien" in Österreich
- Die Auswirkungen auf die politische Stabilität und die Zukunft des österreichischen Parteiensystems
Zusammenfassung der Kapitel
-
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert die Relevanz der „Lücke" im österreichischen Parteiensystem. Die Arbeit soll die Gründe für die Entstehung dieser „Lücke" analysieren und die Auswirkungen auf die politische Landschaft beleuchten.
-
Das Kapitel „Das Wahlsystem und die politischen Organe Osterreichs" bietet einen Überblick über das österreichische Wahlsystem und die wichtigsten politischen Organe. Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum deutschen Wahlsystem hervorgehoben und die Funktionsweise der österreichischen Demokratie erläutert.
-
Das Kapitel „Die österreichischen Parteien, ihre rechtliche Grundlage und Geschichte" stellt die wichtigsten politischen Parteien in Österreich vor und beleuchtet ihre Geschichte, ihre rechtliche Grundlage und ihre politische Ausrichtung. Es werden die SPÖ, FPÖ, BZÖ und DIE GRUNEN im Detail betrachtet und ihre Entwicklung im Laufe der Zeit analysiert.
-
Das Kapitel „Die politische Lage und „Lücke im Parteiensvstem" analysiert die Entwicklung des österreichischen Parteiensystems in den letzten Jahren und untersucht die Entstehung der „Lücke" im System. Es werden die Gründe für den Aufstieg der „populistischen Parteien" und die Auswirkungen auf die politische Landschaft beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das österreichische Parteiensystem, die „Lücke" im System, populistische Parteien, FPÖ, BZÖ, Wahlsystem, politische Organe, Geschichte der österreichischen Parteien, politische Stabilität, Wählerwanderung und die Auswirkungen auf die politische Landschaft.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich das österreichische Parteiensystem in den letzten Jahren verändert?
Das ehemals sehr stabile System der zwei großen Volksparteien (SPÖ und ÖVP) hat sich zu einem pluralistischen System gewandelt, in dem Randparteien wie die FPÖ und das BZÖ an Bedeutung gewonnen haben.
Was wird unter der „Lücke“ im Parteiensystem verstanden?
Die These besagt, dass durch die Bewegung der Volksparteien in die politische Mitte an den Rändern (links und rechts) eine Lücke entsteht, die von neuen oder ehemals kleineren Parteien besetzt wird.
Welche Rolle spielen populistische Parteien in Österreich?
Parteien wie die FPÖ und das BZÖ nutzen die Unzufriedenheit mit den Volksparteien und besetzen Themen am rechten Rand, was zu einer Destabilisierung des traditionellen Lagersystems geführt hat.
Welche Parteien werden in der Arbeit detailliert analysiert?
Die Arbeit betrachtet insbesondere die SPÖ, FPÖ, das BZÖ sowie DIE GRÜNEN hinsichtlich ihrer Geschichte und politischen Ausrichtung.
Gibt es Ähnlichkeiten zwischen der politischen Entwicklung in Österreich und Deutschland?
Ja, in beiden Ländern wurde das System der großen Volksparteien durch Flügelparteien aufgerüttelt – in Deutschland etwa durch „Die Linke“, in Österreich durch die FPÖ und das BZÖ.
Wie funktioniert das österreichische Wahlsystem im Vergleich zum deutschen?
Die Arbeit bietet einen Überblick über das Wahlsystem und hebt Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede zum deutschen System hervor, um die Funktionsweise der österreichischen Demokratie zu erläutern.
- Quote paper
- Jakob Rohde (Author), 2009, Das Parteiensystem Österreichs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178332