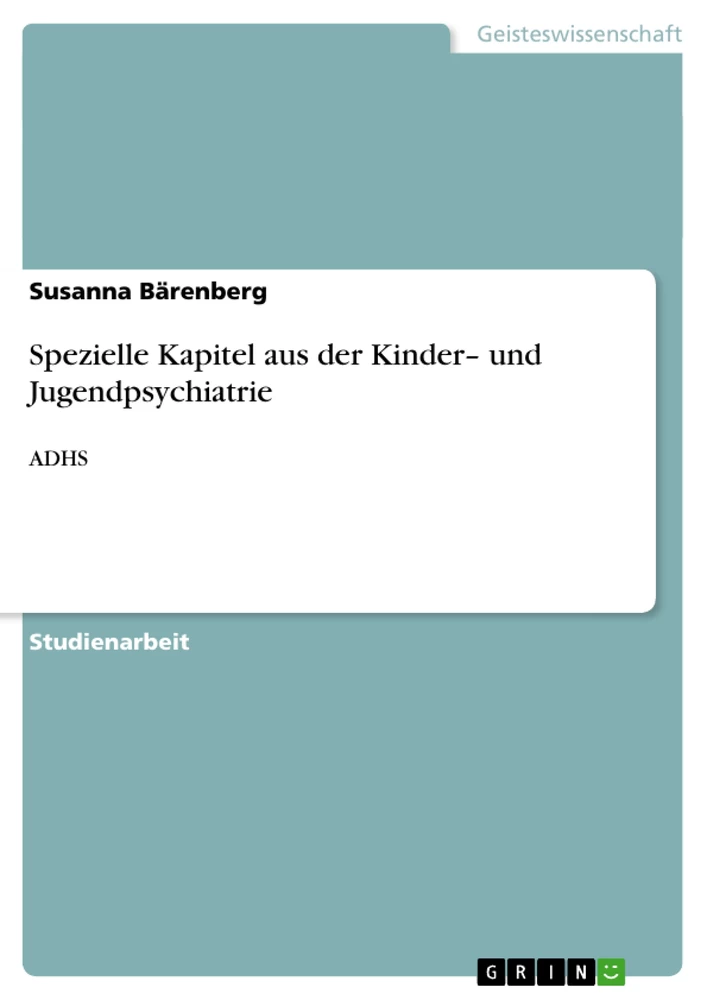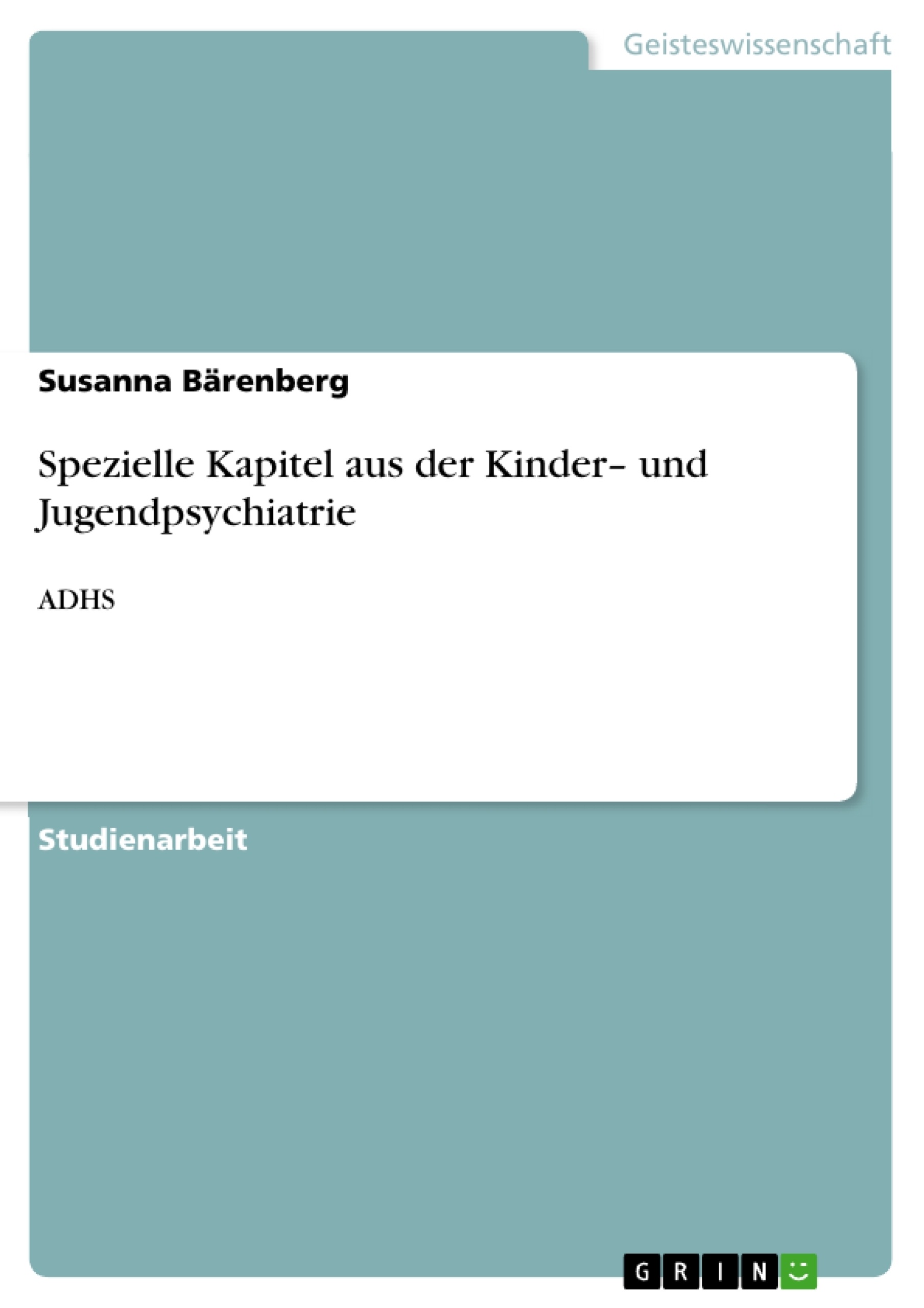Das Phänomen der hyperkinetischen Störung, wenn auch noch nicht als solches bezeichnet, wurde bereits vor 150 Jahren von dem Frankfurter Psychiater und Autor Dr. Heinrich Hoffmann in Form des bekannten Zappelphilipp beschrieben.
Mit dem Zappelphilipp beschreibt Hoffmann ein Kind mit Hyperaktivität so prägnant, dass die Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung (ADS) im deutschsprachigen Raum vielfach auch als Zappelphilipp-Syndrom bekannt geworden ist. In der Geschichte geht es um den Jungen Philipp, der am Tisch nicht still sitzen kann und mit dem Stuhl schaukelt und am Ende mitsamt der Tischdecke und der Mahlzeit auf die Erde fällt.
Früher wurde diese Erkrankung als Hyperaktivitätssyndrom bezeichnet. Die Erkenntnis, dass nicht nur hyperaktive, das heißt unruhige, sondern auch hypoaktive, das sind ruhige, verträumte Kinder, zum gleichen Formenkreis gehören können, hat in den letzten Jahren zu einer Umbenennung des Krankheitsbildes geführt, das jetzt als Aufmerksamkeit – Defizit – Syndrom (ADS) mit und ohne Hyperaktivität deklariert wird, bzw. als Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivität – Störung (ADHS).
Heute gehören die hyperkinetischen Störungen "zusammen mit den Störungen des Sozialverhaltens zu den am häufigsten in kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtungen gestellten Diagnosen".
Das klinische Bild zeigt eine "deutliche Altersabhängigkeit" (Trott, 1993). Dabei bestehen "bei über der Hälfte der Kinder bereits im Säuglingsalter eine ausgeprägte Unruhe und Irritierbarkeit" (Trott, 1993), welche dann im Vorschulalter nicht mehr zu übersehen sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- ADHS
- Diagnose laut ICD-IO und DSM-IV
- Symptome
- Komorbidität
- Ursachen
- Therapie
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei Kindern und Jugendlichen. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über das Krankheitsbild zu geben, indem wichtige Aspekte wie die Diagnose, Symptome, Komorbidität, Ursachen und Therapie beleuchtet werden.
- Definition und Symptome der ADHS
- Diagnostische Kriterien nach ICD-10 und DSM-IV
- Häufige Komorbiditäten und Begleiterscheinungen
- Mögliche Ursachen und Einflussfaktoren
- Psychotherapeutische und medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ADHS ein und beleuchtet die historische Entwicklung des Krankheitsbildes. Sie beschreibt die verschiedenen Bezeichnungen, die im Laufe der Zeit für die Störung verwendet wurden, sowie die Bedeutung der ADHS als eine der häufigsten Diagnosen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie.
- ADHS: Dieses Kapitel definiert den Begriff ADHS und beschreibt die drei Hauptsymptome der Störung: motorische Unruhe, Impulssteuerungsschwäche und verminderte Konzentration. Die Bedeutung der verschiedenen Lebensbereiche, in denen die Symptome auftreten, sowie die Notwendigkeit einer Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit für die Diagnosestellung werden erläutert.
- Diagnose laut ICD-IO und DSM-IV: Dieses Kapitel erklärt die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden gängigen Diagnoseschemata ICD-10 und DSM-IV. Es werden die verschiedenen Subtypen des ADHS nach DSM-IV sowie die Unterschiede in der Gewichtung von Hyperaktivität in den beiden Systemen dargestellt. Die Bedeutung der unterschiedlichen Kriterien für die Prävalenzraten von ADHS wird ebenfalls beleuchtet.
- Symptome: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Symptome der ADHS, die von Alter, Persönlichkeit und sozialem Umfeld des Kindes abhängen können. Neben der Hyperaktivität werden auch die gestörte Aufmerksamkeit, Impulsivität, emotionale Besonderheiten und die Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche des Kindes näher beleuchtet.
- Komorbidität: Dieses Kapitel behandelt die häufigen Begleiterscheinungen von ADHS, wie Aggressivität, Oppositionelle Störung des Sozialverhaltens, affektive Störungen, Ängste, Entwicklungs- und Lernstörungen, Zwänge oder Suchtprobleme. Der Einfluss der Komorbiditäten auf die Entwicklung des Kindes und seine soziale Integration wird untersucht.
- Ursachen: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Theorien über die Ursachen von ADHS, wie erbliche Faktoren, psychosoziale Bedingungen, Nahrungsmittelallergien, Stoffwechselstörungen, genetische Mutationen und Neurotransmitter-Dysfunktionen. Die Bedeutung multifaktorieller Wirkungszusammenhänge wird hervorgehoben.
- Therapie: Dieses Kapitel behandelt verschiedene Therapieformen für ADHS, sowohl psychotherapeutische und psychosoziale Interventionen als auch medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten. Die Bedeutung der Aufklärung von Eltern und Kindern, der Zusammenarbeit mit der Schule sowie der individuellen Anpassung der Therapie an die Bedürfnisse des Kindes werden hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), die Diagnose nach ICD-10 und DSM-IV, die Symptome der Störung, die Komorbidität mit anderen psychischen Erkrankungen, die möglichen Ursachen von ADHS sowie die verschiedenen Therapieformen. Der Text beleuchtet die Bedeutung der ADHS als ein komplexes Krankheitsbild, das sowohl genetische als auch psychosoziale Faktoren beinhaltet.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen ADS und ADHS?
ADHS beinhaltet das Symptom der Hyperaktivität (motorische Unruhe). ADS wird oft als Bezeichnung für den vorwiegend unaufmerksamen Typ verwendet, bei dem die Kinder eher ruhig oder verträumt (hypoaktiv) wirken.
Was sind die drei Hauptsymptome von ADHS?
Die drei Kernsymptome sind motorische Unruhe (Hyperaktivität), Impulssteuerungsschwäche (Impulsivität) und eine verminderte Konzentrationsfähigkeit (Unaufmerksamkeit).
Wie wird ADHS diagnostiziert?
Die Diagnose erfolgt nach international anerkannten Schemata wie dem ICD-10 oder dem DSM-IV. Dabei müssen die Symptome über einen längeren Zeitraum in mehreren Lebensbereichen auftreten und die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen.
Was versteht man unter Komorbidität bei ADHS?
Komorbidität bezeichnet das gleichzeitige Auftreten weiterer Störungen, wie z. B. Aggressivität, Ängste, Lernstörungen, Suchtprobleme oder Störungen des Sozialverhaltens.
Welche Ursachen werden für ADHS vermutet?
Man geht von einem multifaktoriellen Geschehen aus. Dazu zählen erbliche Faktoren, Neurotransmitter-Dysfunktionen im Gehirn sowie psychosoziale Bedingungen im Umfeld des Kindes.
Wie sieht eine typische Therapie bei ADHS aus?
Die Therapie ist meist multimodal und umfasst die Aufklärung der Eltern, Verhaltenstherapie für das Kind, Zusammenarbeit mit der Schule und bei Bedarf eine medikamentöse Unterstützung.
- Arbeit zitieren
- Susanna Bärenberg (Autor:in), 2006, Spezielle Kapitel aus der Kinder– und Jugendpsychiatrie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178360