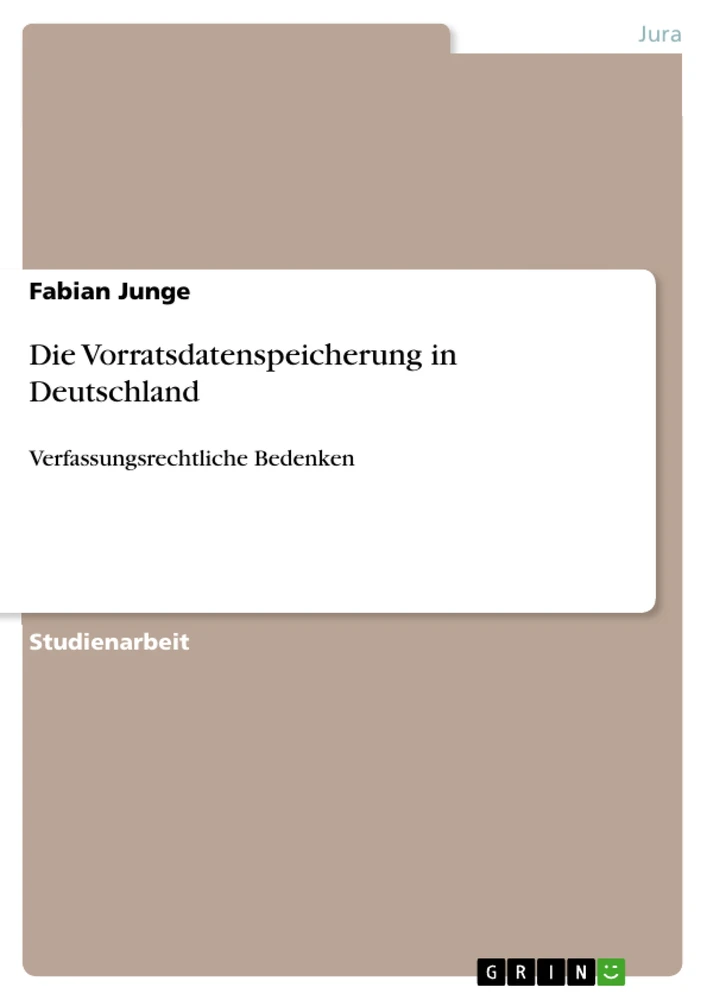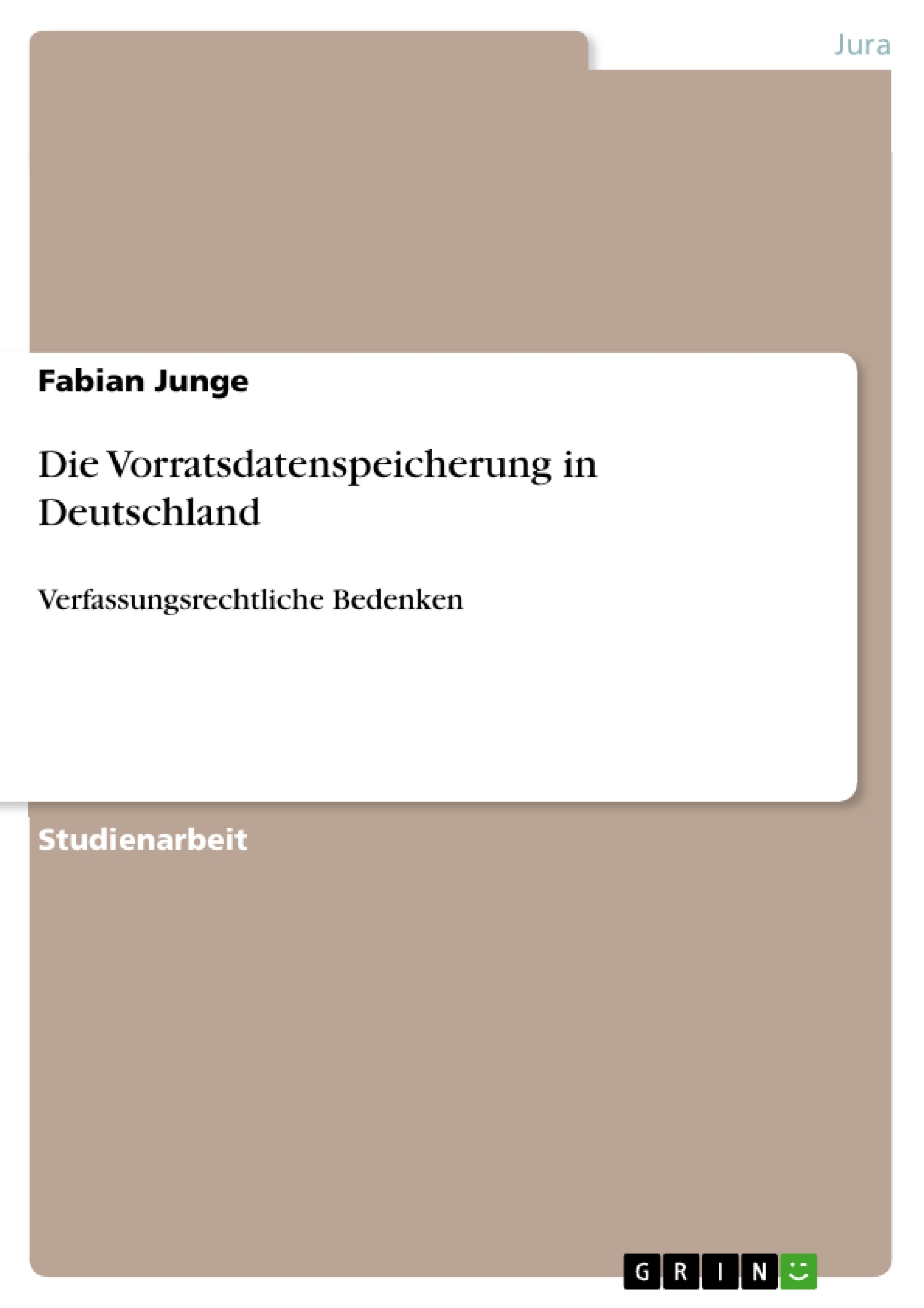Man kann das 21. Jahrhundert mit gutem Gewissen als „das digitale Zeitalter“ bezeichnen, denn heutzutage läuft kaum ein Prozess unseres täglichen Lebens ohne Bits und Bytes ab.
Sei es der Mobilfunk, welcher langsam aber stetig das Festnetz ablöst, das Beantragen eines Visums für den Aufenthalt in einem anderen Land oder das einfache Schreiben einer E-Mail, alles wird digital bearbeitet und umgesetzt.
Die rasende Weiterentwicklung und die große Anzahl der technischen Möglichkeiten sorgt dafür, dass die Masse der Kommunikationsvorgänge und der dabei entstehenden Informationen sprunghaft angestiegen ist, um somit dem gewachsenen Anspruch unserer immer mehr global agierenden Gesellschaft gerecht werden zu können.
Doch diese Entwicklung hat auch negative Seiten, auf die seit Jahren von Bürgerrechtlern und Datenschützern aufmerksam gemacht wird. Denn durch den Umstieg von der analogen zur digitalen Technologie ist es auch sehr viel einfacher, mit geringem Aufwand an große Mengen von Informationen zu gelangen und diese beispielsweise zu überwachen. Dem Laien ist bei diesen komplexen Vorgängen häufig gar nicht bewusst, welche Dritten und vor allem in welchem Umfang diese auf seine Daten zugreifen können. Beispielhaft sind die letzten sogenannten „Datenpannen“ bei großen Konzernen wie dem Finanzdienstleister AWD oder dem Lebensmitteldiscounter Lidl.
Eben diese Vorfälle sorgen für zunehmenden Unmut in der Bevölkerung, sodass die Rufe zum Schutz ihrer persönlichen Daten durch den Staat immer lauter werden. Dieses steigende Sicherheitsbedürfnis der Bürger ist auf der einen Seite verständlich, auf der anderen Seite eröffnet es dem Staat neue Möglichkeiten zur Überwachung.
Die Europäische Union und mit ihr ihre Mitgliedsstaaten haben zur Zeit anscheinend die Maxime, vor allem den internationalen Terrorismus und schwere Verbrechen zu bekämpfen und nehmen dafür sogar Eingriffe in die Freiheitsrechte der EU-Bürger in Kauf.
Das gravierendste Beispiel für einen solchen Eingriff in den letzten Jahren ist die, zurzeit sowohl national als auch international heftig diskutierte, Richtline zur Vorratsdatenspeicherung 2006/24/EG.
Anhand dieses Beispiels soll ein Einblick darin gewährt werden, inwiefern der Schutz der eigenen Grundrechte dem Schutz vor internationalem Terrorismus und schweren Verbrechen weichen muss respektive soll.
Inhaltsverzeichnis
- A) Vorüberlegungen
- B) Die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung 2006/24/EG
- I. Die Entstehung in der Europäischen Union
- II. Die Begründung der Richtlinie
- III. Die wesentlichen Inhalte der Richtlinie
- IV. Die Umsetzung der Richtlinie in Deutschland
- a) Der Verlauf
- b) Die Umsetzung ins nationale Recht
- c) Die Verfassungsbeschwerden und das Bundesverfassungsgericht
- C) Die Vorratsdatenspeicherung unter verfassungsrechtlichen Aspekten
- I. Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung
- II. Das Fernmeldegeheimnis
- III. Verstoß gegen die Wesengehaltsgarantie
- IV. Die Pressefreiheit
- V. Die Garantie eines effektiven Rechtsschutzes
- VI. Aus der Sicht der Telekommunikationsdienstleister
- VII. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
- a) Geeignetheit
- b) Erforderlichkeit
- c) Zumutbarkeit
- VIII. Weitere Bedenken
- D) Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Vorratsdatenspeicherung in Deutschland und analysiert die verfassungsrechtlichen Bedenken, die mit dieser Praxis verbunden sind. Sie untersucht die Entstehung und die Inhalte der Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung 2006/24/EG sowie deren Umsetzung in nationales Recht. Die Arbeit beleuchtet insbesondere die Auswirkungen der Vorratsdatenspeicherung auf das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, das Fernmeldegeheimnis und die Pressefreiheit.
- Die Entstehung und Begründung der Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung 2006/24/EG
- Die Umsetzung der Richtlinie in Deutschland und die damit verbundenen Verfassungsbeschwerden
- Die verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Vorratsdatenspeicherung
- Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Zusammenhang mit der Vorratsdatenspeicherung
- Die Auswirkungen der Vorratsdatenspeicherung auf das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, das Fernmeldegeheimnis und die Pressefreiheit
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel werden die Vorüberlegungen zum Thema Vorratsdatenspeicherung angesprochen. Hierbei wird die Bedeutung der digitalen Kommunikation im 21. Jahrhundert und die damit einhergehende Zunahme von Datenmengen betont. Zudem werden die Herausforderungen im Zusammenhang mit Datenschutz und Überwachung sowie die Notwendigkeit des Schutzes der persönlichen Daten durch den Staat erörtert.
Das zweite Kapitel behandelt die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung 2006/24/EG. Es werden die Entstehung der Richtlinie in der Europäischen Union, ihre Begründungen, die wesentlichen Inhalte sowie die Umsetzung in Deutschland beschrieben.
Das dritte Kapitel widmet sich den verfassungsrechtlichen Aspekten der Vorratsdatenspeicherung. Es werden die Auswirkungen der Vorratsdatenspeicherung auf das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, das Fernmeldegeheimnis und die Pressefreiheit beleuchtet. Darüber hinaus wird der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Kontext der Vorratsdatenspeicherung analysiert.
Schlüsselwörter
Vorratsdatenspeicherung, Richtlinie 2006/24/EG, Grundrechte, informationelle Selbstbestimmung, Fernmeldegeheimnis, Pressefreiheit, Verhältnismäßigkeit, Datenschutz, Überwachung, digitale Kommunikation, Europäische Union, Deutschland, Bundesverfassungsgericht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Vorratsdatenspeicherung?
Die Vorratsdatenspeicherung ist die verdachtsunabhängige Speicherung von Telekommunikationsdaten durch Dienstleister zur Bekämpfung von Terrorismus und schweren Verbrechen.
Welche EU-Richtlinie liegt der Vorratsdatenspeicherung zugrunde?
Es handelt sich um die Richtlinie 2006/24/EG, die zur Harmonisierung der Speicherungspflichten in den EU-Mitgliedstaaten verabschiedet wurde.
Gegen welche Grundrechte verstößt die Vorratsdatenspeicherung potenziell?
Kritiker und das Bundesverfassungsgericht sehen Eingriffe in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, das Fernmeldegeheimnis und die Pressefreiheit.
Was versteht man unter dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit?
Im Kontext der Datenspeicherung wird geprüft, ob die Maßnahme geeignet, erforderlich und für die Bürger zumutbar ist, um die angestrebten Sicherheitsziele zu erreichen.
Welche Rolle spielt das Bundesverfassungsgericht in dieser Debatte?
Das Gericht prüft Verfassungsbeschwerden gegen die nationale Umsetzung der Richtlinie und setzt Grenzen für die Überwachungsbefugnisse des Staates.
- Arbeit zitieren
- Fabian Junge (Autor:in), 2009, Die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178383