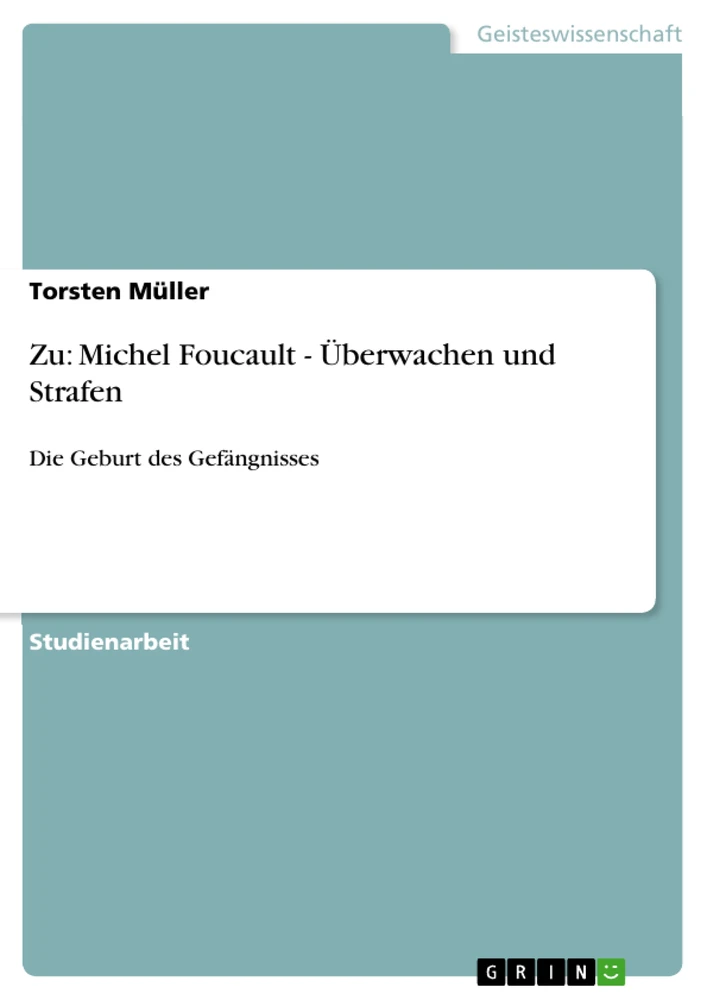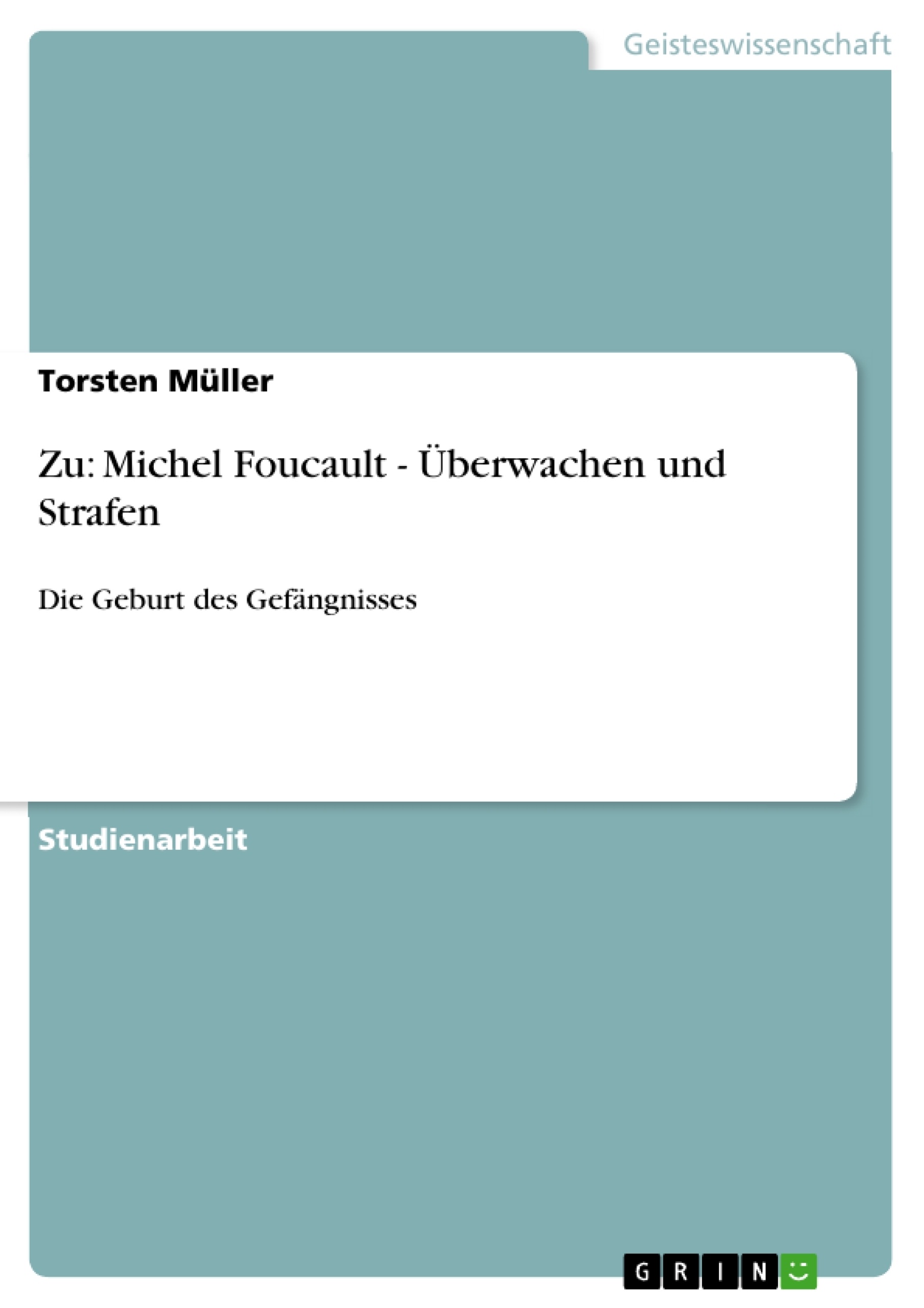Im Buch ,,Überwachen und Strafen: Die Geburt des Gefängnisses" von Michel Foucault, beschäftigt sich der Autor mit der Entwicklung von unterschiedlichen Strafmechanismen, die durch das soziale Medium der Macht bedingt sind. Dabei geht er genauer auf das Thema Macht, ihre Technik und die Auswirkung ein. Eine seiner interessantesten Aussagen in dem Buch ist, dass das Gefängnis in dem Sinne versagt hat und unfähig ist, indem es Delinquenz also Straffälligkeit bewusst produziert und sogar fast schon aktiv fördert. Doch diese Aussage ist nun schon über 30 Jahre alt und wurde auch damals schon sehr stark kritisiert und angezweifelt. Es ist also zu klären, ob es in der heuten Zeit überhaupt noch zutreffend ist. Im Verlaufe dieser Seminararbeit soll unter anderem genau diese Frage erläutert, diskutiert und vielleicht sogar final beantwortet werden. Zuvor sollte allerdings geklärt werden, wer Michel Foucault eigentlich war und was die essentiellen Inhalte seines Werkes ,,Überwachen und Strafen" waren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wer war Michel Foucault?
- Essenzielle Inhalte von „Überwachen und Strafen”
- Die Repressionsthese als Machtprinzip
- Das Panoptikum-Prinzip
- Das moderne Panoptikum
- Kritische Stimmen
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Werk „Überwachen und Strafen: Die Geburt des Gefängnisses“ von Michel Foucault. Sie analysiert Foucaults Thesen zur Entwicklung von Strafmechanismen und Machtverhältnissen im Kontext des Gefängnisses. Die Arbeit hinterfragt insbesondere die Aussage, dass das Gefängnis zur Delinquenz beiträgt, und untersucht, ob diese These auch im heutigen Kontext relevant ist.
- Die Entwicklung von Strafmechanismen im historischen Kontext
- Foucaults Theorie der Macht und ihrer Auswirkung auf soziale Strukturen
- Das Konzept des Panoptikums und seine Bedeutung für die Kontrolle von Individuen
- Die Rolle des Gefängnisses als Instrument der Disziplinierung und Kontrolle
- Die Relevanz von Foucaults Thesen für die heutige Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt Michel Foucault und sein Werk „Überwachen und Strafen: Die Geburt des Gefängnisses“ vor und erläutert die zentrale Forschungsfrage der Arbeit: Ist Foucaults Aussage, dass das Gefängnis Delinquenz produziert, auch im heutigen Kontext gültig?
Wer war Michel Foucault?
Dieses Kapitel bietet eine kurze Biografie von Michel Foucault und skizziert seine wichtigsten Werke und Forschungsschwerpunkte. Insbesondere wird Foucaults Theorie der Macht als Kräfteverhältnis und seine Verbindung von Macht und Wissen hervorgehoben.
Essenzielle Inhalte von „Überwachen und Strafen”
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit den zentralen Inhalten von Foucaults Buch „Überwachen und Strafen“. Hierbei werden die Repressionsthese als Machtprinzip, das Panoptikum-Prinzip und die Kritik an der Funktionsweise des Gefängnisses erläutert.
Die Repressionsthese als Machtprinzip
Das Kapitel erläutert Foucaults Repressionsthese, die die Ausübung von Macht als einseitige Aktion kritisiert und stattdessen ein komplexes Kräfteverhältnis zwischen Machthabenden und Unterworfenen postuliert. Das Konzept der „Big-Brother-Gesellschaft“ wird als Beispiel für die vollständige Abgeschlossenheit einer Gesellschaft von der Außenwelt dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Macht, Disziplin, Überwachung, Panoptikum, Gefängnis, Repression, Delinquenz, Michel Foucault, „Überwachen und Strafen“, Postmoderne, Gesellschaftsstrukturen, Bio-Macht, Wissen und Kontrolle.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema von Foucaults „Überwachen und Strafen“?
Das Buch untersucht die historische Entwicklung von Strafmechanismen und wie Macht durch Disziplinierung und Überwachung in modernen Institutionen (wie dem Gefängnis) ausgeübt wird.
Was versteht Foucault unter dem Panoptikum?
Das Panoptikum ist ein Architekturmodell eines Gefängnisses, bei dem ein einziger Wärter alle Insassen beobachten kann, ohne selbst gesehen zu werden, was zur Selbst-Disziplinierung der Überwachten führt.
Warum behauptet Foucault, das Gefängnis produziere Delinquenz?
Foucault argumentiert, dass das Gefängnis Kriminelle isoliert, sie in kriminelle Milieus drängt und so eine kontrollierbare Klasse von Straffälligen (Delinquenten) erst erschafft.
Was ist die „Repressionsthese“?
Foucault kritisiert die Ansicht, Macht sei rein unterdrückend (repressiv). Er sieht Macht als produktiv an – sie bringt Wissen, Diskurse und bestimmte Formen von Subjekten hervor.
Sind Foucaults Thesen heute noch aktuell?
Die Arbeit diskutiert, inwiefern moderne Überwachungstechnologien (Kameras, Datenanalyse) ein digitales Panoptikum geschaffen haben, das über die Gefängnismauern hinausreicht.
- Citation du texte
- Torsten Müller (Auteur), 2011, Zu: Michel Foucault - Überwachen und Strafen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178415