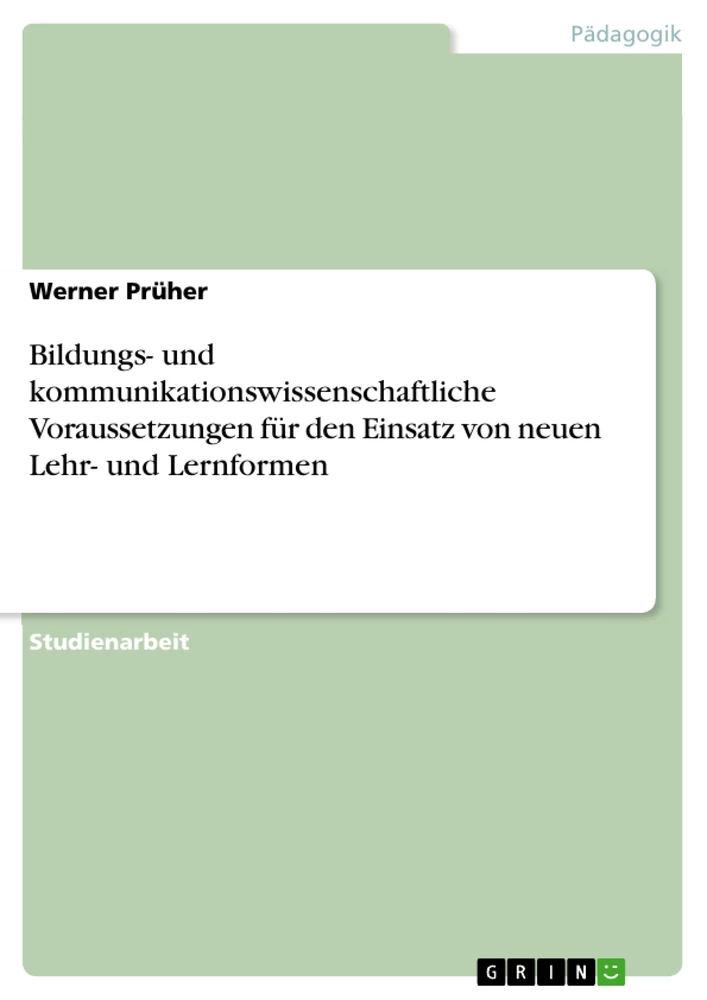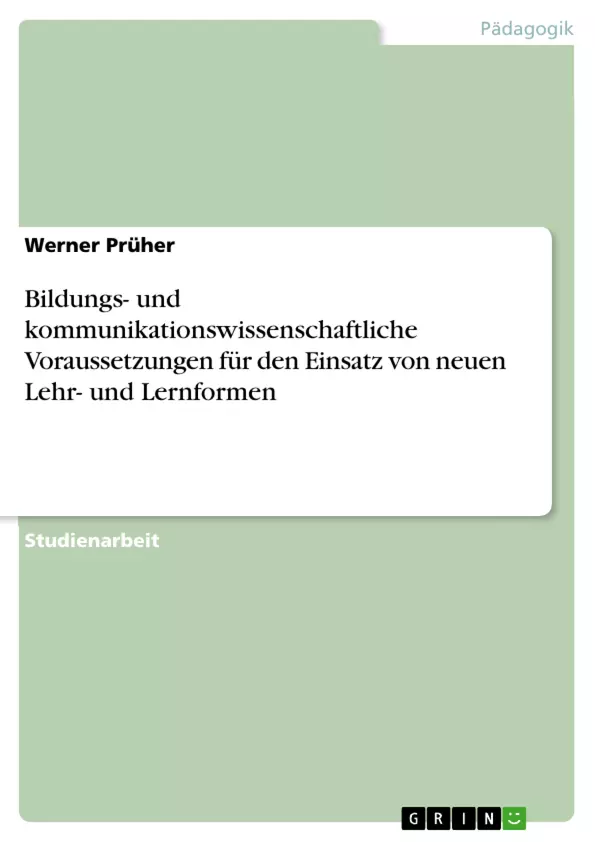Der Lebensalltag vieler Menschen hat sich durch digitale Kommunikationsformen gravierend geändert, Kommunikation ist flexibler geworden. Auch das Lernen ist heute nicht mehr nur auf einen bestimmten Ort und eine bestimmte Zeit beschränkt, sondern kann dank mobiler Geräte und asynchroner Kommunikation überall und jederzeit stattfinden. Die Geräte und in weiterer Folge die Beteiligten sind miteinander vernetzt, ein gegenseitiger Austausch durch das Einstellen von Inhalten in Form von Text, Bild und/oder Ton ist möglich und entspricht einer zeitgemäßen Kommunikationskultur.
Die Schule aber hat sich nur in Randbereichen verändert, Neue Medien werden oft sogar als Störfaktor empfunden, man denke an Handyverbote oder Facebook- und Youtube-Sperren in Schulnetzen. Von der Schule wird gefordert, dass Jugendliche mit zeitgemäßen Lehr- und Lernformen für diese veränderte Gegenwart und für eine Zukunft vorbereitet werden, in der es nur eine Konstante gibt: die Veränderung.
Auf den folgenden Seiten werden die Voraussetzungen für den Einsatz von neuen Lehr- und Lernformen im Berufsschulunterricht in Österreich diskutiert. Wie in Deutschland und der Schweiz werden die Lehrlinge (Azubis) im dualen System ausgebildet: Die überwiegende Arbeitszeit verbringen sie mit der praktischen Ausbildung im Betrieb, den theoretischen und den fachlichen Unterricht erhalten sie entweder in geblockten Lehrgängen (8 – 12 Wochen pro Jahr) oder im ganz-jährigen Tagesunterricht (ein Tag pro Woche).
Ausgehend von den Anwendungsfeldern Neuer Medien für neue Lehr- und Lernformen werden anschließend die Medienkompetenz der Lernenden und die Eigenheiten von elektronischen Lernumgebungen untersucht. Die Rolle der Lehrenden, der Bildungsträger und der Ausblick auf künftige Lehr- und Lernsituationen in der Berufsschule schließen diese Arbeit ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Alles neu: Medien, Lehr- und Lernformen
- Medienkompetenz für Lernende und Lehrende
- Medienkompetenz
- Lernende und die Lernumgebung
- Die Rolle des Lehrenden
- Die Bildungsträger
- Konsequenzen und Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die (bildungswissenschaftlichen) Voraussetzungen für den Einsatz von neuen Lehr- und Lernformen im Berufsschulunterricht in Österreich. Der Fokus liegt dabei auf der Integration von digitalen Medien und der damit verbundenen Herausforderungen für Lernende und Lehrende.
- Entwicklung von E-Learning und Social Software
- Medienkompetenz von Lernenden und Lehrenden
- Didaktische Konzepte für den Einsatz neuer Medien
- Rolle der Bildungsträger bei der Förderung von Medienkompetenz
- Konsequenzen für die Lehrlingsausbildung und den Berufsschulunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und beschreibt die Notwendigkeit von neuen Lehr- und Lernformen im Berufsschulunterricht. Sie beleuchtet die Veränderungen im Lebensalltag durch digitale Kommunikationsformen und die daraus resultierenden Anforderungen an die Schule.
- Alles neu: Medien, Lehr- und Lernformen: Dieses Kapitel definiert E-Learning und neue Medien und beschreibt die Entwicklungsphasen von Computer Based Training (CBT) bis hin zu Kompetenzentwicklung mit Blended Learning und Web 2.0. Es werden Vor- und Nachteile der verschiedenen Phasen analysiert und die Bedeutung von Social Software im Kontext des Lernens beleuchtet.
- Medienkompetenz für Lernende und Lehrende: Dieses Kapitel analysiert die Medienkompetenz von Jugendlichen und Erwachsenen im Vergleich. Es wird die „informelle Medienkompetenz" von Jugendlichen im Kontext von Social Media Plattformen und die Herausforderungen für Lehrkräfte im Umgang mit der „Digital Natives" Generation beleuchtet.
- Medienkompetenz: Dieses Kapitel definiert die Dimensionen der Medienkompetenz nach Baacke und zeigt, wie diese auf die Neuen Medien und Sozialen Netzwerke übertragen werden können. Es werden die Anforderungen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung an die Medienkompetenz von Lernenden und die Bedeutung des „Medienpädagogischen Manifests" hervorgehoben.
- Lernende und die Lernumgebung: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen von Neuen Medien auf die Lernmotivation und die Lernumgebung. Es werden die Vorteile von selbstgesteuertem Lernen im Kontext von konstruktivistischen Lerntheorien und die Bedeutung der Motivation der Lernenden im Berufsschulunterricht diskutiert.
- Die Rolle des Lehrenden: Dieses Kapitel analysiert die Herausforderungen für Lehrende im Umgang mit neuen Lehr- und Lernformen. Es werden die notwendigen Kompetenzen von Lehrkräften im Bereich der Medienkompetenz beschrieben und die Bedeutung von Weiterbildung und Qualifizierung für die Lehrenden hervorgehoben.
- Die Bildungsträger: Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle der Bildungsträger bei der Förderung von Medienkompetenz. Es werden die Bedeutung von Kooperationen zwischen Bildungseinrichtungen, die Initiative „EPICT" und weitere Initiativen zur Qualifizierung von Lehrenden im Bereich der Medienkompetenz vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen E-Learning, neue Lehr- und Lernformen, Medienkompetenz, Social Software, Web 2.0, Didaktik, Berufsschulunterricht, Lehrlingsausbildung, Bildungsträger und Österreich. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen und Chancen, die mit der Integration von digitalen Medien im Bildungssystem verbunden sind, und zeigt die Notwendigkeit von qualifizierten Lehrkräften und einer entsprechenden Ausstattung der Bildungseinrichtungen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Voraussetzungen werden für neue Lehrformen untersucht?
Die Arbeit untersucht bildungs- und kommunikationswissenschaftliche Voraussetzungen für E-Learning und Social Software im österreichischen Berufsschulunterricht.
Was versteht man unter „informeller Medienkompetenz“?
Damit ist die Kompetenz gemeint, die Jugendliche privat im Umgang mit sozialen Netzwerken erwerben, die aber oft nicht direkt im schulischen Kontext genutzt wird.
Wie hat sich E-Learning entwickelt?
Die Entwicklung verlief von einfachen Computer Based Trainings (CBT) hin zu komplexen Blended Learning Szenarien und Web 2.0 Anwendungen (Social Software).
Welche Rolle haben Lehrende in dieser neuen Umgebung?
Lehrende müssen ihre eigene Medienkompetenz ständig weiterentwickeln und didaktische Konzepte entwerfen, die selbstgesteuertes und vernetztes Lernen fördern.
Warum ist das Thema für Berufsschulen besonders relevant?
Da Lehrlinge im dualen System viel Zeit im Betrieb verbringen, ermöglichen mobile Geräte und asynchrone Kommunikation ein flexibleres Lernen über Ort- und Zeitgrenzen hinweg.
- Quote paper
- Dipl.-Päd. Werner Prüher (Author), 2010, Bildungs- und kommunikationswissenschaftliche Voraussetzungen für den Einsatz von neuen Lehr- und Lernformen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178426