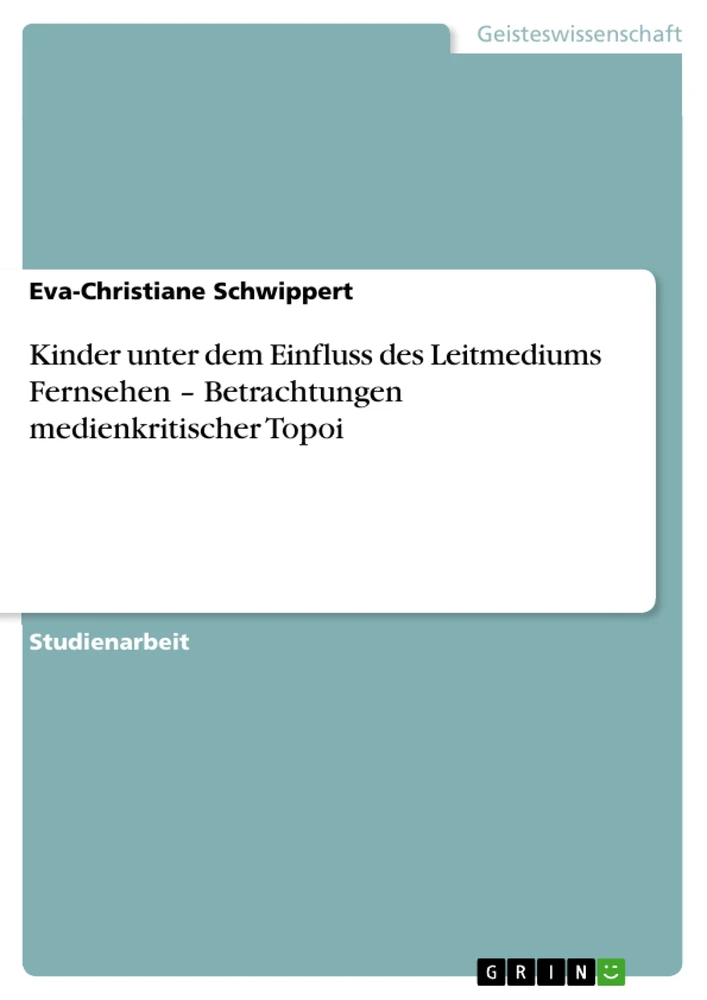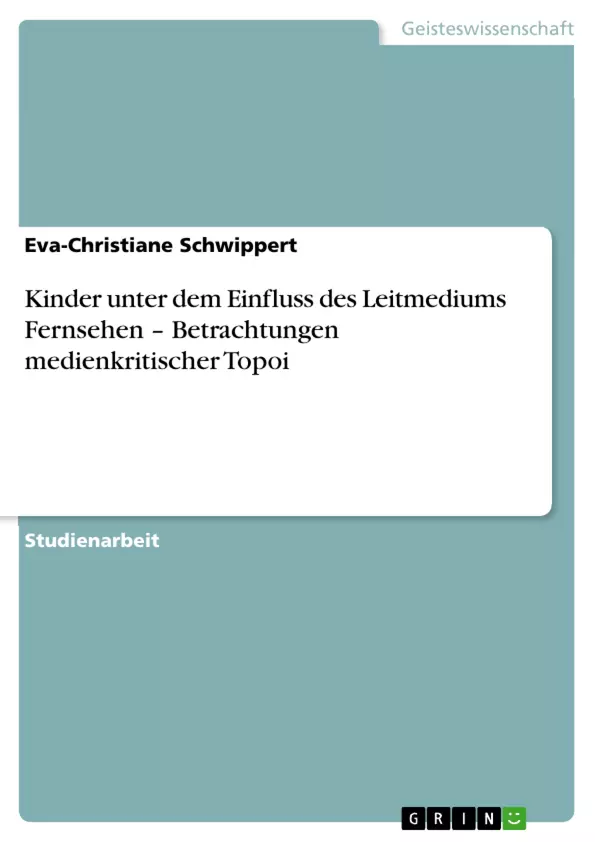Medienkritische Betrachtungen gibt es, seit sich technische Hilfsmittel - der einst nackten Kommunikation durch Sprache - zwischen Sender und Empfänger geschoben haben. So befürchtet Platon, das Nachlassen der Gedächtnisleistung derer, die ihr Wissen auf Schriften stützen, denn „[i]m Vertrauen auf die Schrift werden sich von nun an die Menschen an fremden Zeichen und nicht mehr aus sich selbst erinnern“ können. Ebenso erhalte der Lesende nur den Schein „einer großen Weisheit“, nicht aber die Wahrheit.
Mit der Erfindung des Buchdrucks verstärken sich diese medienkritischen Aussagen. Der Verlust des Wirklichkeitssinns steht auch hier im Vordergrund, wobei Kinder und Jugendliche besonders bedroht scheinen. So schreibt Heinrich Wolgast ca. 2000 Jahre nach Platon eine Medienkritik, die eine schädigende Wirkung der Jugendliteratur ins Blickfeld rückt. Die „Charakterentwicklung unserer Jugend“4 müsse positiv gefördert werden, indem sie nicht in den Genuss von pseudodichterisch verfassten „Sagen und Volksbücher“5 komme, sondern Werke lese, die „Bildungswert“6 haben und von naturnah beschreibenden „echte[n] Dichter[n]“7 stammen. Wolgast kritisiert, dass die natürliche entwicklungsbedingte Phase einer vermehrten Gewaltbereitschaft von Jugendlichen durch den Konsum minderwertiger Literatur verstärkt und verlängert würde.9
In dieser Hausarbeit ist die zentrale Frage, welches sind beliebte Topoi, denen sich Medienkritiker bedienen, um ihre Thesen, einer Beurteilung von Gefahren oder Nutzen durch den Gebrauch des Leitmediums Fernsehen für Kinder und Jugendliche, zu stützen. Haben sie sich seit der Verbreitung des Fernsehens in Bezug auf Heranwachsende verändert und welche Zielgruppen werden mit welchen Topoi belegt? Die Genese der Bildfeindlichkeit und den daran aufgebauten kulturkritischen Topoi, die im unmittelbaren Zusammenhang medienkritischer Diskurse stehen, schließen die Hausarbeit ab. Einige exemplarisch gewählte Medienkritiker sollen den Gebrauch herkömmlicher Argumentationen stützen. Dies sind, die überwiegend journalistisch Tätigen Marie Winn und Steven Johnson und die Medienwissenschaftler Neil Postman und Werner Glogauer, sie führen ihre Thesen in Monografien aus. Der Psychologe Manfred Spitzer liefert hier als Quelle seine Vorlesung „Vorsicht Bildschirm“ die auf video.google.com zur Verfügung steht. Ein exemplarischer Zeitungsartikel aus dem Jahr 2007 von Christian Müller gibt weitere Aufschlüsse über verbreitete medienkritische Argumentationsmuster.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung - Medien, Medienkritik und Topoi
- Rhetorische Topoi der Medienkritiker
- Formale Topoi
- Positionen medienkritischer Diskurse
- Wahrnehmung der Wirklichkeit
- Körper und Seele
- Die Entwicklung des Kindes
- Familie, Erziehung und die Rolle der Eltern
- Gesellschafts- und kulturkritische Diskurse
- Exkurs - Ikonoklasmus verwandelt die Kultur
- Kulturkritische Topoi
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die medienkritischen Topoi, die im Zusammenhang mit dem Einfluss des Fernsehens auf Kinder und Jugendliche verwendet werden. Sie analysiert die Argumente, die Medienkritiker seit der Verbreitung des Fernsehens anführen, um die Gefahren oder den Nutzen des Fernsehens für Heranwachsende zu beurteilen. Insbesondere geht es um die Frage, ob und wie sich diese Topoi seit dem Aufkommen des Fernsehens verändert haben und welche Zielgruppen mit welchen Topoi belegt werden.
- Die Entwicklung und Veränderung medienkritischer Topoi im Laufe der Zeit
- Die Verwendung von Topoi zur Bewertung der Auswirkungen des Fernsehens auf Kinder und Jugendliche
- Die Rolle der Medienplattformen bei der Verbreitung von medienkritischen Diskursen
- Die historische Entwicklung der Bildfeindlichkeit und ihre Verbindung zu kulturkritischen Topoi
- Die Analyse von exemplarischen Medienkritikern und ihren Argumentationsmustern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Medienkritik und des Topos-Begriffs ein und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor. Sie beleuchtet den Wandel von Medienkritik, von der Antike bis zur heutigen Zeit. Das zweite Kapitel widmet sich der Analyse von rhetorischen Topoi der Medienkritik und geht auf die Bedeutung des Topos-Begriffs in der antiken Rhetorik ein.
Kapitel 3 untersucht die Positionen medienkritischer Diskurse im Hinblick auf die Wahrnehmung der Wirklichkeit, Körper und Seele, die Entwicklung des Kindes sowie Familie, Erziehung und die Rolle der Eltern. Es analysiert, wie diese Diskurse sich auf die Rolle des Fernsehens im Leben von Kindern und Jugendlichen beziehen.
Kapitel 4 befasst sich mit gesellschafts- und kulturkritischen Diskursen, wobei ein Exkurs zur Genese der Bildfeindlichkeit und den damit verbundenen kulturkritischen Topoi Einblicke in die historische Entwicklung dieser Diskurse gibt. Es zeigt, wie diese Topoi in den Bereich der Medienkritik Eingang gefunden haben.
Schlüsselwörter
Medienkritik, Topoi, Fernsehen, Kinder, Jugendliche, Wahrnehmung, Wirklichkeit, Körper, Seele, Entwicklung, Familie, Erziehung, Eltern, Gesellschaft, Kultur, Bildfeindlichkeit, Ikonoklasmus.
Häufig gestellte Fragen
Was sind medienkritische Topoi?
Das sind wiederkehrende Argumentationsmuster und Themen, die Kritiker nutzen, um vor den Gefahren von Medien wie dem Fernsehen zu warnen.
Welche Gefahren des Fernsehens werden für Kinder thematisiert?
Thematisiert werden der Verlust des Wirklichkeitssinns, negative Auswirkungen auf Körper und Seele sowie Störungen in der kindlichen Entwicklung und Erziehung.
Gab es Medienkritik schon vor der Erfindung des Fernsehens?
Ja, die Arbeit zeigt, dass schon Platon die Schrift kritisierte und später Wolgast vor schädigenden Einflüssen minderwertiger Jugendliteratur warnte.
Welche bekannten Kritiker werden in der Arbeit analysiert?
Analysiert werden unter anderem Neil Postman, Werner Glogauer, Marie Winn und der Psychologe Manfred Spitzer.
Was bedeutet der Begriff „Ikonoklasmus“ in diesem Zusammenhang?
Er bezieht sich auf die Bildfeindlichkeit und die kulturkritische Ablehnung der Vorherrschaft visueller Medien gegenüber dem geschriebenen Wort.
- Citation du texte
- Eva-Christiane Schwippert (Auteur), 2011, Kinder unter dem Einfluss des Leitmediums Fernsehen – Betrachtungen medienkritischer Topoi, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178439