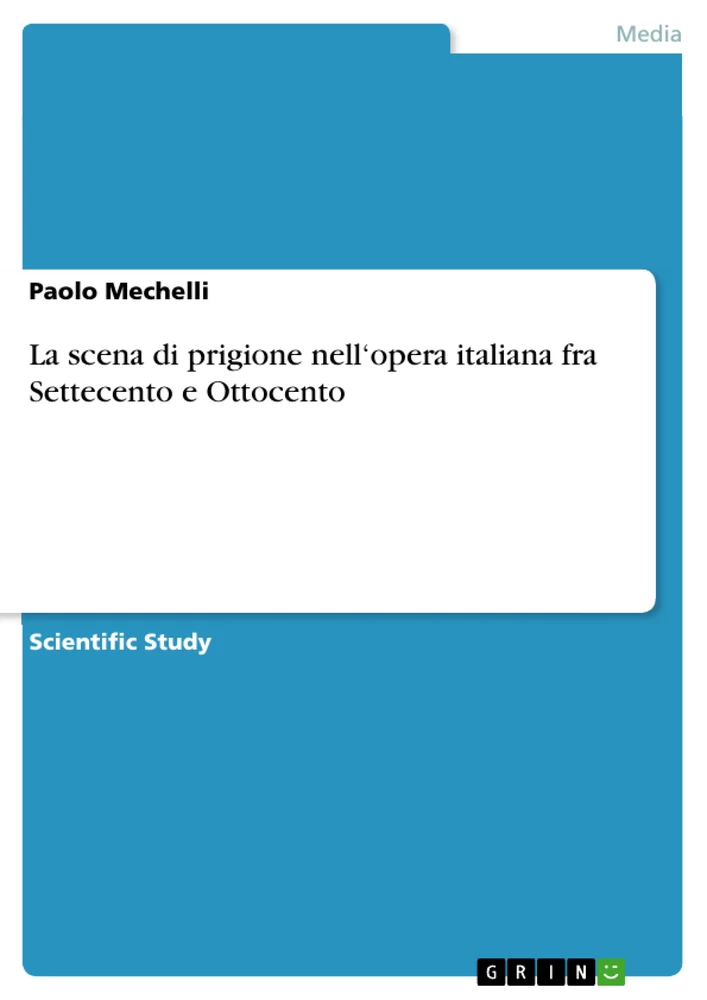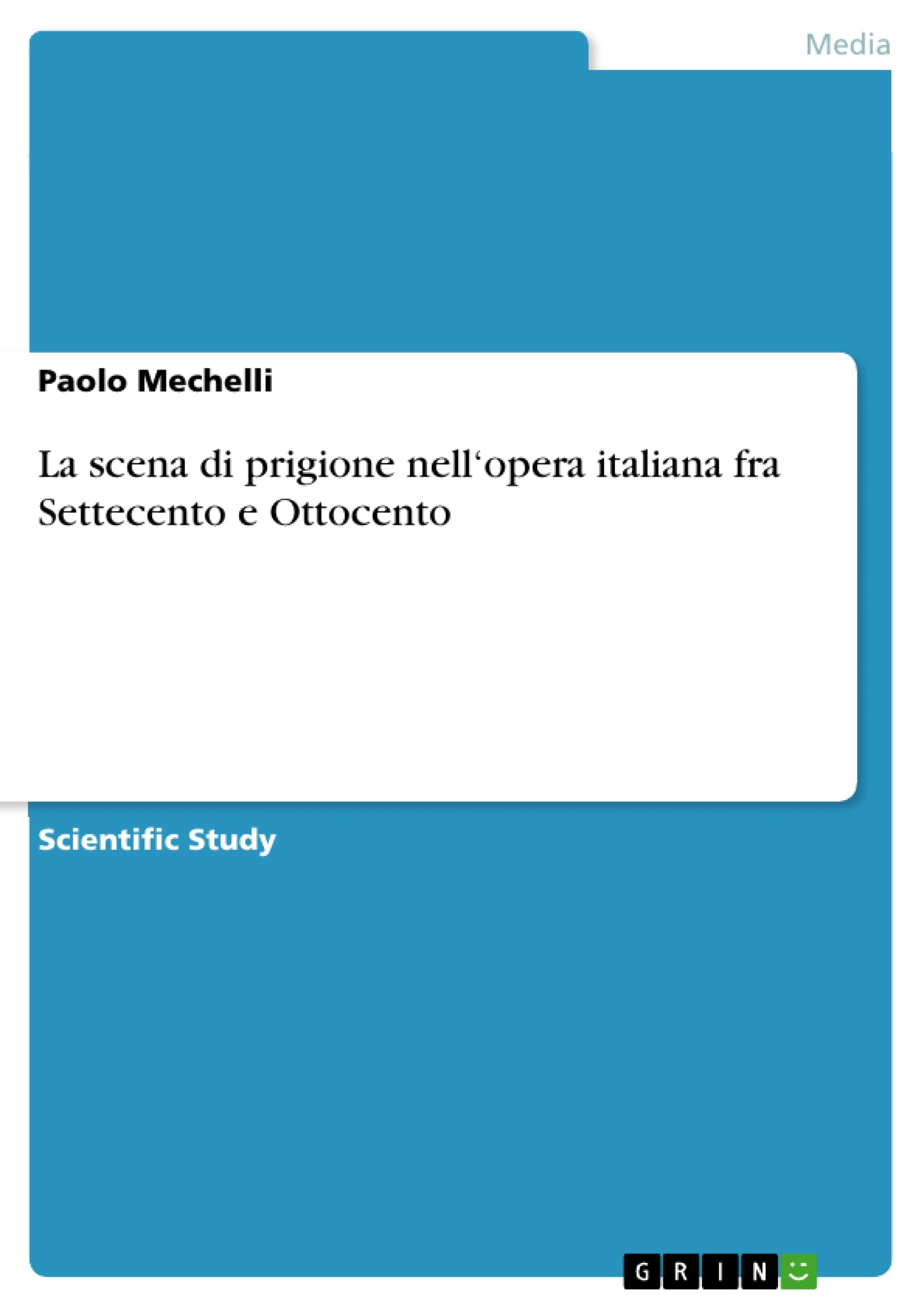Il tema "prigione" nell'opera, apparentemente strano e singolare, è in realtà alla base di una grossa fetta delle vicende intonate ed allestite nell'arco cronologico oggetto di studio (1770-1835). In sintonia con il manicheismo morale e psicologico dei conflitti politico-sentimentali che informano le vicende delle opere a cavallo tra Sette ed Ottocento, ben di frequente è proprio la prigione il luogo cruciale in cui emerge una forte polarizzazione di bene e male, un paradigmatico scontro di forze, che si manifesta spesso nell'antitesi tra l'eroe positivo, ingiustamente imprigionato, ed il tiranno usurpatore. E' così che nella struttrazione delle fasi narrative, la mutazione scenica "prigione", con la relativa sequenza drammatica, diviene un po' l'epicentro emotivo drammaturgico e viene a collocarsi nel cuore della vicenda, al culmine dell'intreccio, in cui l'innocente vittima, già costretta a soccombere alla perfidia del persecutore, deve subire ricatti e vessazioni di ogni sorta, prima che possa realizzarsi l'auspicato finale «sauvetage». Un monitoraggio, condotto su oltre cinquecento libretti di opere serie, attesta per la scena di prigione una presenza al 32% abbondante nel periodo 1770-1799 e al 28% abbondante nel periodo 1800-1835. Scena fissa prediletta dal pubblico (come anche testimoniato da trattati e recensioni giornalistiche coeve), ma anche eloquente simbolo epocale, la scena di prigione è stata qui analizzata in base alle tipologie drammaturgico-musicali più ricorrenti e significative, con particolare attenzione al ricco campionario di ingredienti stilistici e di caratterizzazioni retorico-musicali, che, addensandosi vistosamente negli episodi-prigione analizzati, eleggono senza dubbio tale tipo di scena al rango di osservatorio privilegiato dell'opera seria.
Inhaltsverzeichnis
- Introduzione
- Ringraziamenti
- Biblioteche e Archivi
- 1. La ricezione del topos
- 1.1 La mutazione scenica 'Prigione'
- 1.2 Prassi esecutive e tendenze di mercato
- 2. Tracce di un itinerario storico
- 3. Luci ed ombre nel Secolo dei Lumi
- 3.1 Le spinte innovatrici d'oltralpe
- 3.2 Verso un realismo dei momenti estremi
- 3.3 OscuritÅ sublime
- 3.4 La prigione nella coscienza collettiva
- 4. La scena di prigione nella trattatistica e nelle gazzette
- 5. Bibliografia della scena di prigione nella librettistica fra il 1770 e gli anni Trenta del 1800
- 6. La drammaturgia
- 6.1 Introduzione
- 6.2 Strutture, situazioni e personaggi
- 6.3 Collocazione della scena di prigione
- 6.4 Tipologia e dinamica interna delle scene
- 6.4.1 11 licatto e i suoi attributi
- 6.4.2 1 casi particolari
- 6.5 La scena del sonno
- 6.6 Tra prigione e morte
- 6.7 Cattura e prigionia come elementi dominanti di una vicenda
- 6.8 Una prigione «semiseria»
- 7. 11 testo poetico
- 7.1 Introduzione
- 7.2 La prigione come «parto di pura fantasia»
- 7.3 1 recitativi
- 7.4 Le forme strofiche
- 8. La musica
- 8.1 Introduzione
- 8.2 Ai primordi dell'episodio-prigione
- 8.3 La ricchezza linguistica degli anni Ottanta
- 8.4 Gli anni Novanta fra tradizione e innovazione
- 8.5 Uno sguardo al primo Ottocento
- 8.6 Conclusioni
- Appendice
- 1. Introduzione
- 2. I luoghi e gli spazi della prigionia
- BIBLIOGRAFIA
- Indice dei nomi
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Buch "La scena di prigione nell'opera italiana fra Settecento e Ottocento" ist eine überarbeitete und erweiterte Version der Dissertation des Autors. Es befasst sich mit der Darstellung von Gefängnisszenen im italienischen Operntheater zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert. Die Arbeit analysiert die Entwicklung dieses Topos in Bezug auf die Dramaturgie, den Text und die Musik sowie die szenische Gestaltung. Dabei wird die historische und gesellschaftliche Entwicklung des Gefängnisses als Ort der Macht und des Terrors im Kontext der Aufklärung und des Vormärz berücksichtigt.
- Die Entwicklung des Topos der Gefängnisszene im italienischen Operntheater
- Die Dramaturgie und Funktion der Gefängnisszene im Kontext der Opernhandlung
- Die sprachliche und stilistische Gestaltung von Gefängnisszenen im Libretto
- Die musikalische Umsetzung von Gefängnisszenen und ihre Besonderheiten
- Die szenische Gestaltung von Gefängnisszenen und ihre Bedeutung für die Inszenierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Zielsetzung und den Umfang der Arbeit dar. Sie beleuchtet die historische und gesellschaftliche Entwicklung des Gefängnisses als Ort der Macht und des Terrors im Kontext der Aufklärung und des Vormärz.
Das erste Kapitel befasst sich mit der Rezeption des Topos der Gefängnisszene im italienischen Operntheater. Es analysiert die Entwicklung der szenischen Gestaltung von Gefängnisszenen und die Bedeutung der Musik und des Textes für die Darstellung von Gefühlen und Handlungen.
Das zweite Kapitel bietet einen historischen Überblick über die Entwicklung der Gefängnisszene im Theater. Es zeichnet die Entwicklung von der Antike bis zum 17. Jahrhundert nach und zeigt, wie sich die Gefängnisszene im Laufe der Zeit zu einem festen Bestandteil des Opernrepertoires entwickelte.
Das dritte Kapitel beleuchtet die kulturellen und politischen Veränderungen im 18. Jahrhundert, die die Entwicklung der Oper beeinflussten. Es analysiert die Bedeutung der Aufklärung, des Preromantismus und des Konzepts des Sublimen für die Entwicklung der Gefängnisszene.
Das vierte Kapitel untersucht die Behandlung der Gefängnisszene in der Opernkritik und in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts. Es zeigt, wie die Gefängnisszene in der Kritik und in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts wahrgenommen wurde und welche Bedeutung ihr zugeschrieben wurde.
Das fünfte Kapitel bietet eine umfangreiche Bibliographie der Gefängnisszenen in der italienischen Opernlibretti zwischen 1770 und 1830. Es listet alle Opern auf, die eine Gefängnisszene enthalten, und gibt Informationen über den Titel, den Komponisten, den Librettisten und die Aufführungsdaten.
Das sechste Kapitel analysiert die Dramaturgie der Gefängnisszene. Es untersucht die typischen Strukturen, Situationen und Charaktere, die in Gefängnisszenen vorkommen, sowie die Rolle der Erpressung und des Ritus des Todes.
Das siebte Kapitel befasst sich mit dem poetischen Text der Gefängnisszene. Es analysiert die sprachliche Gestaltung von Gefängnisszenen im Libretto und die Verwendung von rhetorischen Figuren und poetischen Mitteln.
Das achte Kapitel widmet sich der Musik der Gefängnisszene. Es untersucht die musikalische Umsetzung von Gefängnisszenen und ihre Besonderheiten. Es werden verschiedene Opern aus der Zeit zwischen 1770 und 1830 analysiert, um die Entwicklung der musikalischen Gestaltung von Gefängnisszenen aufzuzeigen.
Der Anhang befasst sich mit der szenischen Gestaltung von Gefängnisszenen. Es werden die typischen Elemente der Bühnenbildgestaltung von Gefängnisszenen beschrieben und die Bedeutung der Bühnenbildgestaltung für die Inszenierung von Gefängnisszenen erläutert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Topos des Gefängnisses, die italienische Oper des 18. und 19. Jahrhunderts, Dramaturgie, Libretto, Musik, szenische Gestaltung, Aufklärung, Preromantismus, Macht, Terror, Erpressung, Tod, Liebe, Familie, Gesellschaft, Kulturgeschichte.
Häufig gestellte Fragen zur Gefängnisszene in der italienischen Oper
Warum war die Gefängnisszene in der Oper so beliebt?
Die Gefängnisszene diente als emotionales Zentrum der Handlung. Sie bot eine starke Polarisation zwischen Gut (unschuldiger Held) und Böse (Tyrann) und war ein Höhepunkt dramatischer Zuspitzung.
Welchen Zeitraum deckt die Untersuchung ab?
Die Arbeit analysiert die Jahre zwischen 1770 und 1835, eine Epoche des Umbruchs zwischen Aufklärung, Preromantismus und Vormärz.
Wie häufig kamen Gefängnisszenen in Opern vor?
Untersuchungen von über 500 Libretti zeigen, dass zwischen 1770 und 1799 etwa 32 % der Opern eine Gefängnisszene enthielten, im Zeitraum danach (bis 1835) waren es noch etwa 28 %.
Welche Rolle spielte die Musik in diesen Szenen?
Die Musik nutzte spezielle rhetorisch-musikalische Charakterisierungen, um Gefühle wie Verzweiflung, Einsamkeit oder die Hoffnung auf Rettung („sauvetage“) klanglich darzustellen.
Was hat das „Konzept des Sublimen“ mit der Gefängnisszene zu tun?
Das Subtile und die „sublime Dunkelheit“ des Kerkers entsprachen dem ästhetischen Empfinden der Zeit und wurden genutzt, um extreme emotionale Zustände beim Publikum hervorzurufen.
- Arbeit zitieren
- Paolo Mechelli (Autor:in), 2011, La scena di prigione nell‘opera italiana fra Settecento e Ottocento, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178440