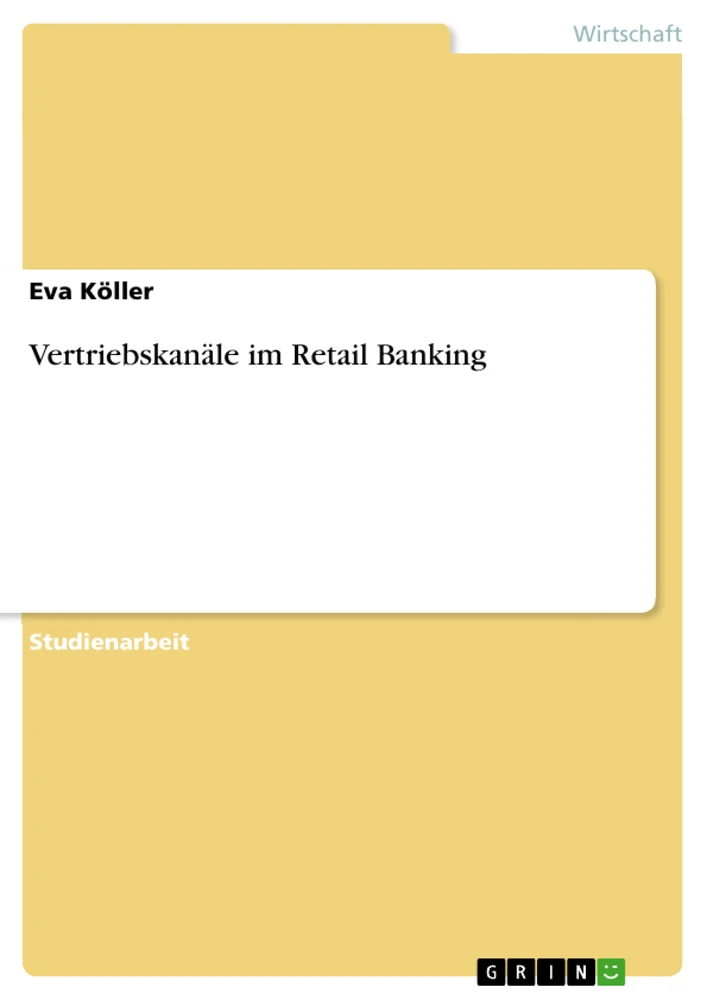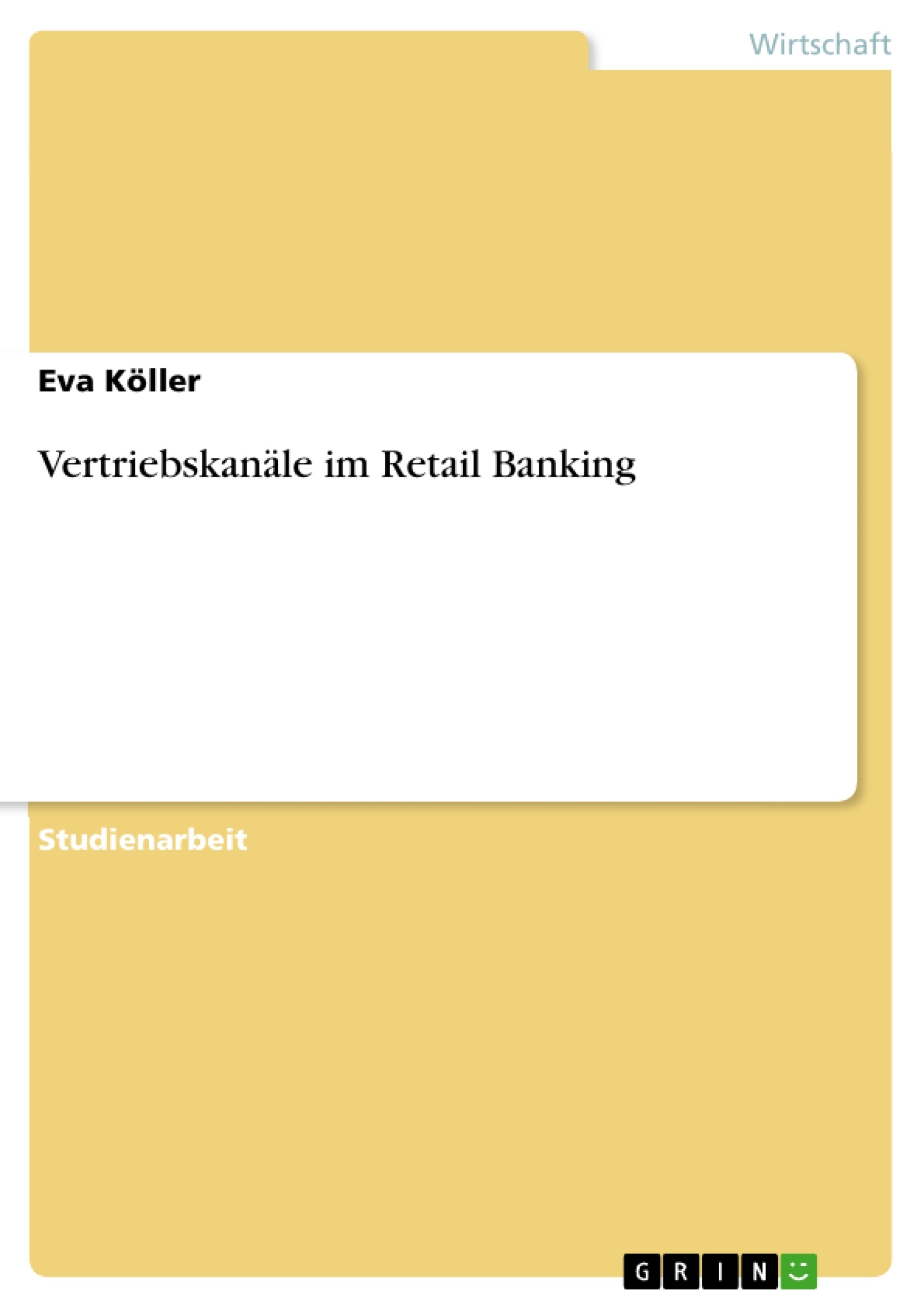In den 90er Jahren wurde das Retail Banking wegen fehlender bzw. zu geringer Deckungsbeiträge in den Hintergrund gedrängt. Die Finanzmarktkrise zeigte jedoch, dass Investmentbanking und margenträchtige, aber undurchschaubare Finanzinnovationen als Fundament nicht standhalten können – „Zurück zu den Wurzeln heißt deshalb die Devise.“
Die Banken haben die Bedeutung des Retail Banking für sich wiederentdeckt, aber in der Bankenlandschaft hat sich die Wettbewerbssituation in den letzten Jahren zunehmend verschärft und somit den Wettbewerb um den Retail-Kunden intensiviert. Die zunehmende Bedeutung von Direktbanken und neuen Nischenanbietern, die rasante Ausdehnung der technischen Möglichkeiten, immer wieder neu auftretende Vertriebswege sowie unberechenbare Kunden stellen die Banken vor immer neue Herausforderungen. Microsoft-Chef Bill Gates brachte dies auf den Punkt und schreckte die gesamte Bankenwelt mit seinem Zitat „Banking is necessary, banks are not.“ auf, was frei übersetzt so viel bedeutet wie: Die Welt braucht das Banking, aber keine Banken.
Die vorliegende Arbeit gibt zunächst einen Überblick über die traditionellen und medialen Vertriebskanäle im Retail Banking und zeigt anschließend deren Zusammenspiel im Multi-Channel-Vertrieb. Nach Erläuterung der Bedeutung und Definition des Multi-Channel-Vertriebs werden die Motive einer Bank sowie die damit verbundenen Probleme und Ziele dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung: Die Bankenlandschaft im Umbruch
2. Die Vertriebskanäle des Retail Bankings im Überblick
2.1 Traditionelle Vertriebskanäle
2.2 Mediale Vertriebskanäle
3. Multi-Channel-Vertrieb als Schlüssel zum Erfolg
3.1 Definition und Bedeutung
3.2 Motive, Probleme und Ziele
4. Schlussbemerkung: Nur der richtige Mix führt zum Ziel
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Warum hat Retail Banking in den letzten Jahren wieder an Bedeutung gewonnen?
Nach der Finanzmarktkrise wurde das Privatkundengeschäft als stabiles Fundament gegenüber risikoreichen Investment-Innovationen wiederentdeckt.
Was ist der Unterschied zwischen traditionellen und medialen Vertriebskanälen?
Traditionelle Kanäle sind physische Filialen, während mediale Kanäle Online-Banking, Mobile-Apps und Telefon-Banking umfassen.
Was versteht man unter Multi-Channel-Vertrieb?
Es ist das gleichzeitige Angebot und die Verknüpfung verschiedener Vertriebswege, um Kunden flexibel über alle Kanäle hinweg zu erreichen.
Welche Herausforderungen stellen unberechenbare Kunden dar?
Kunden nutzen heute oft mehrere Kanäle gleichzeitig (Hybrid-Kunden) und erwarten nahtlose Übergänge sowie Transparenz bei Preisen und Leistungen.
Was bedeutet das Zitat "Banking is necessary, banks are not"?
Bill Gates wies damit darauf hin, dass die Dienstleistung (Banking) essenziell bleibt, die klassischen Institute aber durch neue technische Anbieter ersetzbar werden könnten.
- Arbeit zitieren
- Eva Köller (Autor:in), 2011, Vertriebskanäle im Retail Banking, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178461