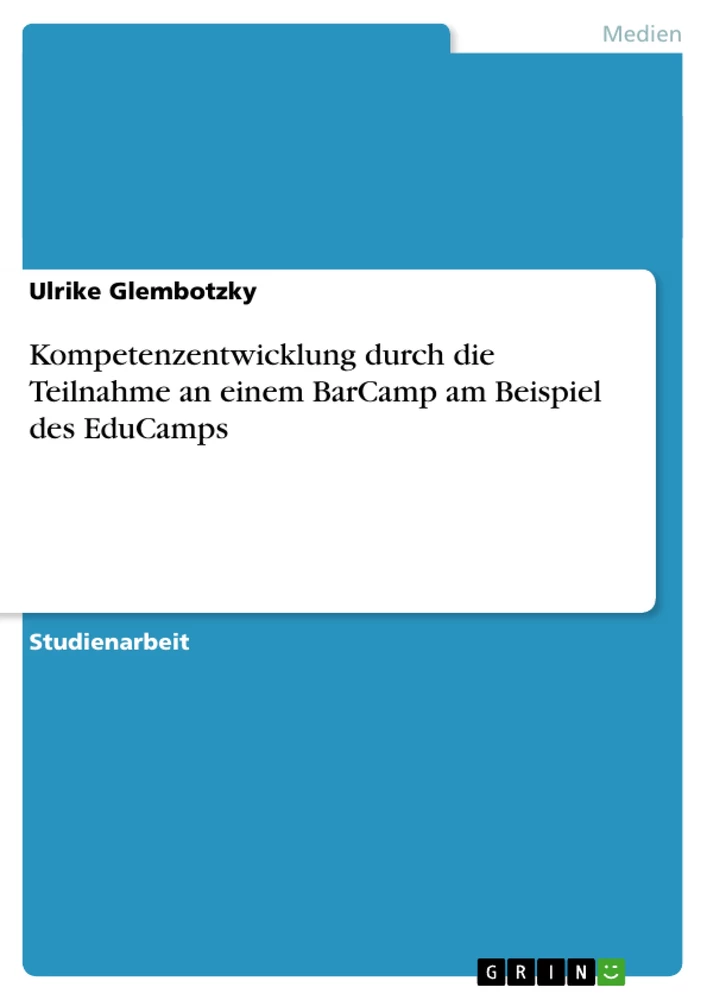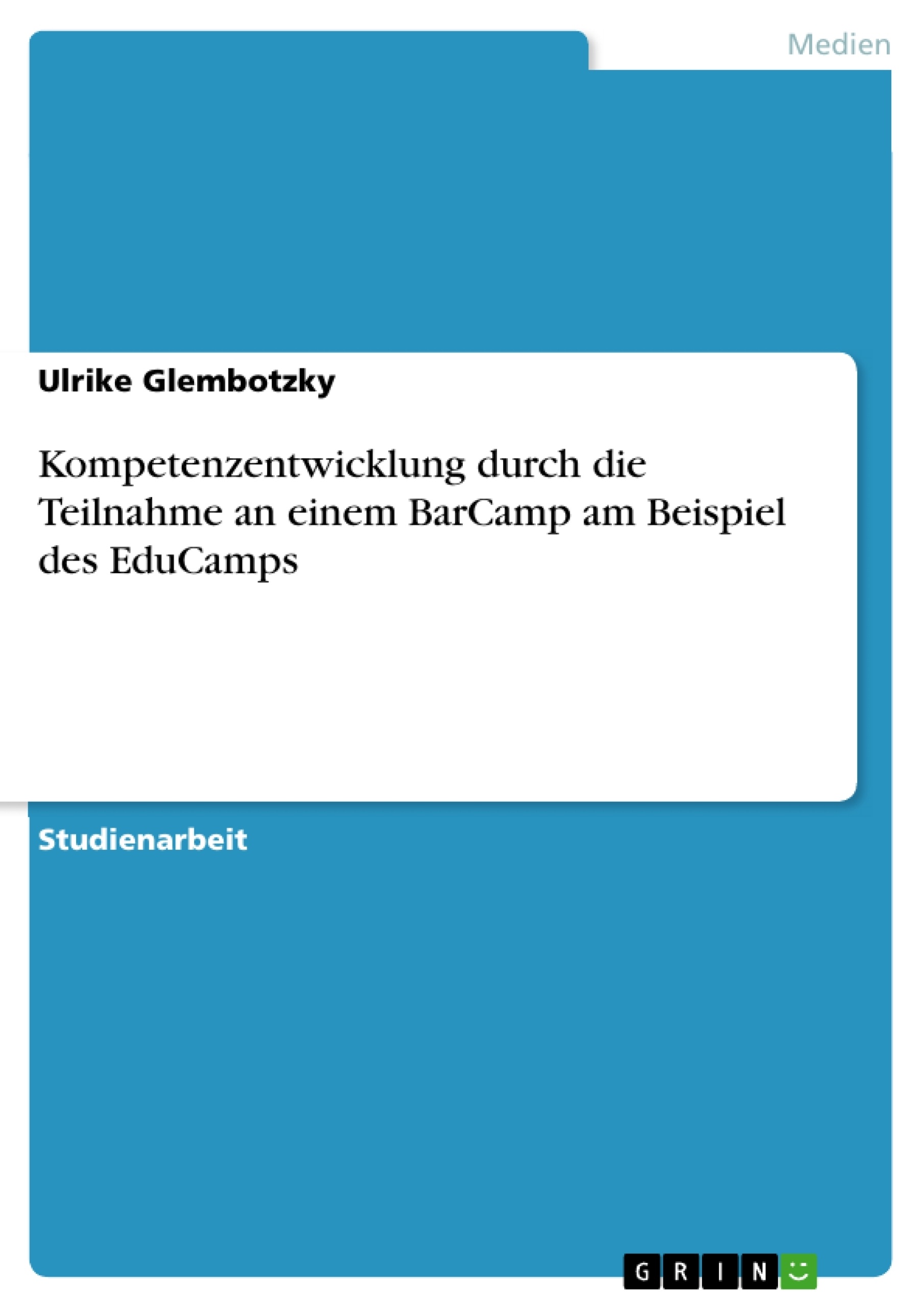Weiterbildungsinstitutionen verfolgen immer noch das hauptsächliche Ziel der Wissensvermittlung (Erpenbeck & SAuter 2007). Der gesellschaftliche Wandel macht jedoch die Entwicklung von Kompetenzen erforderlich (ebd.). Bildungswissenschaft muss in diesem Zusammenhang den Umgang der Gesellschaftsmitlieder mit dem Internet thematisieren, da dadurch neue Kulturtechniken und Kommunikationsmöglichkeiten entstehen (Glameyer 2009). Diese Arbeit leistet keinen Beitrag zur Beschreibung von Kompetenzerkennung oder Kompetenzmessung, sondern Überlegungen dazu, ob und wie ein BarCamp Kompetenzentwicklung fördern kann.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Kompetenzen und Kompetenzentwicklung
2.1 Bedeutung des Kompetenzbegriffs
2.2 Bedeutung von Kompetenzentwicklung
2.2.1 Kompetenzentwicklung als im Subjekt vorkommender Prozess
2.2.2 Kompetenzentwicklung im Kontext äußerer Bedingungen
2.2.3 Kompetenzentwicklung in Gruppen
3. Kompetenzentwicklung im Web 2.0
3.1 Bedeutung von Web 2.0
3.2 Förderung von Kompetenzentwicklung im Web 2.0
3.3 Wikipedia - Beispiel einer Web 2.0 Anwendung
4. Offene Bildungsinitiativen
4.1 Beispiel eines BarCamps: Das EduCamp
4.2 Bisherige Forschungsergebnisse zum Format BarCamp
4.3 Kritik am EduCamp
5. Auswertung der Forschungsfrage
6. Fazit und Ausblick
Tabellenverzeichnis Literaturverzeichnis
1. Einleitung
„In der Schule lehrt man uns, daß wertvolles Lernen das Ergebnis von Schulbe- such sei; daß der Wert des Lernens mit dem Einsatz steige, und daß sich dieser Wert an Graden und Zeugnissen messen und nachweisen lasse. Tatsächlich ist Lernen diejenige menschliche Tätigkeit, die am wenigsten der Manipulation durch andere bedarf. Das meiste Lernen ist nicht das Ergebnis von Unterwei- sung. Es ist vielmehr das Ergebnis unbehinderter Teilnahme in sinnvoller Um- gebung.“ (Illich 2003, S. 65)
Gegenwärtig steht in Schule, Universität und Weiterbildungseinrichtungen immer noch Wissensvermittlung anstatt Kompetenzentwicklung im Vorder- grund (vgl. Erpenbeck & Sauter 2007, S. 83-84). Die Vermittlung von Sach- und Fachwissen reicht jedoch nicht mehr aus (vgl. Erpenbeck & Sauter 2007, S. 289). Im Rahmen des gesellschaftlichen Wandels, der rasantere kulturelle, politische und ökonomische Prozesse mit sich bringt, wird kreatives und wir- kungsvolles Handeln zunehmend wichtiger (Erpenbeck & Sauter 2007, S. 2), vor allem in Bezug auf den Umgang mit Wissen und Informationen (Albrecht et al. 2007, S. 2).
Als Gegenstand der Bildungswissenschaft lässt sich „die Untersuchung der Bedingungen für eine gelingende Entwicklung des menschlichen Potentials“ [!] (Glameyer 2009, S. 91) benennen. Dabei sollen gleichermaßen die Entfaltung des Individuums als auch die Entwicklung von Kulturtechniken innerhalb des gesellschaftlichen Lebens berücksichtigt werden (ebd.). Die Bildungswissen- schaft muss sich daher fragen, welche neuen Kulturtechniken und Kommunika- tionsmöglichkeiten durch das Internet entstehen und Konzepte der Zugangs- möglichkeiten zu diesen Kulturtechniken für alle Gesellschaftsmitglieder erar- beiten (vgl. Glameyer 2009, S. 92).
Diese Arbeit leistet keinen Beitrag zur Beschreibung von Kompetenzerken- nung oder Kompetenzmessung, sondern Überlegungen dazu, ob und wie ein BarCamp Kompetenzentwicklung fördern kann. Ein BarCamp ist ein innovati- ves Konferenzformat, welches offen ist für alle Interessierten (vgl. Kap. 4.1). Die Autorin hat bereits an zwei EduCamps teilgenommen. Das EduCamp ist ein BarCamp mit der Themeneingrenzung ‚mediengestütztes Lernen’ (vgl. Kap. 4.1). Basierend auf unsystematischen Beobachtungen während ihrer Teil- nahmen an den EduCamps vermutet die Autorin, dass es sich beim BarCamp- Format um eine für Kompetenzentwicklung förderliche Lernumgebung han- delt. Die Forschungsfrage dieser Hausarbeit lautet daher: Welche Potenziale für Kompetenzentwicklung bietet die Teilnahme an einem BarCamp? Der Begriff ‚Potenziale’ (in Anlehnung an Glameyer 2009, S. 91, s.o.) meint hierbei Bedingungen, welche als förderlich für Kompetenzentwicklung identifiziert werden können. Die Forschungsfrage ist eingegrenzt auf äußere Bedingungen des BarCamps und berücksichtigt weniger den im Subjekt ablaufenden Prozess während der Kompetenzentwicklung. Dieser wird jedoch auch aus Gründen der theoretischen Vollständigkei behandelt.
In Kapitel 2 werden ausführlich die Begriffe Kompetenz und Kompetenzentwicklung behandelt. Zu Beginn werden diese Begriffe in ihrer Bedeutung entfaltet (Kap. 2.1, 2.2). Folgend wird Kompetenzentwicklung als im Subjekt vorkommender Prozess (Kap. 2.2.1) und im Kontext äußerer Bedingungen (Kap. 2.2.2) und schließlich im Kontext von Gruppen (vgl. Kap. 2.2.3) thematisiert.
Es folgt eine Darstellung von Kompetenzentwicklung im Web 2.0 (Kap. 3), die mit einer Erläuterung des Begriffs Web 2.0 beginnt (Kap. 3.2). Anschließend werden Überlegungen zur Förderung von Kompetenzentwicklung im Web 2.0 vorgestellt (Kap. 3.2). Als Beispiel für eine Web-2.0-Anwendung wird die Arbeit in der Wikipedia bzw. mit einem Wiki im Hinblick auf ihr Potenzial für Kompetenzentwicklung reflektiert (Kap. 3.3).
In Kapitel 4 werden „Offene Bildungsinitiativen“ erläutert und es folgen die Darstellung des EduCamps als Beispiel für ein BarCamp (Kap. 4.1), sowie bisher vorgelegte Forschungsergebnisse zum Format BarCamp (Kap. 4.2). Das Kapitel 4 abschließend, wird eine Kritik zum EduCamp referiert (Kap. 4.3). Kapitel 5 behandelt die Auswertung der Forschungsfrage. Den Abschluss dieser Hausarbeit bildet ein „Fazit und Ausblick“ (Kap. 6).
Alle Hervorhebungen in Zitaten wie kursiver Text und fettgedruckte Wörter sind in originalgetreuer Form übernommen.
In dieser Hausarbeit wird die geschlechtsneutrale Form bevorzugt. Mit der männlichen Form sind ausdrücklich Personen beider Geschlechter gemeint.
2. Kompetenzen und Kompetenzentwicklung
2.1 Bedeutung des Kompetenzbegriffs
Obwohl der Kompetenzbegriff bereits in den 1970er Jahren durch den Deut- schen Bildungsrat in die pädagogische Diskussion eingebracht wurde, findet seine intensive Erörterung erst seit kurzem statt (vgl. Preißer & Völzke 2007, S. 62). Eine einzige oder gar endgültige Kompetenzdefinition gibt es (bisher) nicht (ebd., vgl. Erpenbeck & Sauter 2007, S. 65).
Nach Erpenbeck und Sauter sind Kompetenzen „ Dispositionen zur Selbstorganisation, also Selbstorganisationsdispositionen “ (Erpenbeck & Sauter 2007, S. 65). Dabei sind Dispositionen innere Voraussetzungen, die bis zu einem spezifischen Zeitpunkt einer Handlung vorliegen (ebd.). Unter selbstorganisiertem Handeln wird ein Handeln im Kontext offener Problem- und Entscheidungssituationen wie etwa in den Kontexten Wirtschaft, Politik und Alltag verstanden (vgl. Erpenbeck & Sauter 2007, S. 65 - 66).
Anhand des Beispiels eines selbstorganisierten Abenteuerurlaubs erläutern Erpenbeck und Sauter vier von ihnen definierte Kompetenzarten (vgl. Erpen- beck & Sauter, S. 65), welche sie als Befähigung zu selbstorganisiertem Han- deln verstehen (vgl. Erpenbeck & Sauter 2007, S. 67): Droht eine Krankheit im Dschungel, dienen fachlich-methodische Kompetenzen, die in Erfahrungen, Hoffnungen und Motiven eingebettet vorliegen, als Basis für lösungsorientier- tes Handeln. In diesem Zusammenhang kommen auch personale Kompetenzen wie Kreativität, Selbstvertrauen und Mut zum Einsatz. Sozial-kommunikative Kompetenzen kommen in sozialer Interaktion zur Anwendung, wenn Personen innerhalb einer Gruppe Urlaub machen oder auf Fremde treffen. Aktivitäts- und Umsetzungskompetenzen gelten schließlich als Voraussetzung dafür, dass die oben genannten Kompetenzen willensstark durchgeführt werden (ebd.).
2.2 Bedeutung von Kompetenzentwicklung
2.2.1 Kompetenzentwicklung als im Subjekt vorkommender Prozess
Nach Kuhlmann und Sauter ist die Vermittlung von Kompetenzen nicht mög- lich (vgl. Kuhlmann & Sauter 2008, S. 2). Kompetenzen können ausschließlich durch das Subjekt selbst erworben werden (ebd.), was durch die „Interiorisati- on von Regeln, Werten und Normen zu eigenen Emotionen und Motivationen“ (Erpenbeck & Sauter 2007, S. 2) gelingt. Interiorisation wird auch als Verin- nerlichung bezeichnet (vgl. Franz 1994, S. 131). Nur durch direktes Handeln ist Interiorisation möglich (vgl. Erpenbeck & Sauter 2007, S. 2), wobei Widersprüche und Unsicherheiten ausgehalten werden müssen. Daraus folgen Dissonanzen und Labilisierungen, die vom Subjekt zu neuen Emotionen und Motivationen verarbeitet werden. So entwickelt es während des Erwerbs von notwendigem Sachwissen auch Regeln, Werte und Normen, welche die Kerne von Kompetenzen bilden (ebd.), (vgl. Tab. 1).
Erpenbeck und Sauter verwenden den Begriff Dissonanzen im Sinne von „Cognitive dissonance“ nach Festinger (Erpenbeck & Sauter 2007, S. 61), der folgendes darunter versteht:
„Cognitive dissonance can be seen as an antecedent condition which leads to activity oriented toward dissonance reduction just as hunger leads to acti vity oriented toward hunger reduction.“ (Festinger 1957, S. 3)
Der Begriff Labilisierungen wird im Sinne von psychicher Labilisierung verwendet (Erpenbeck & Sauter 2007, S. 61).
Tab. 1: Erwerb von Kompetenzen durch eigenständiges Handeln des Subjekts und dabei stattfinde]ndem Interiorisationprozess in Anlehnung an Erpenbeck und Sauter (s.o.), (Quelle: Eigener Entwurf)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.2.2 Kompetenzentwicklung im Kontext äußerer Bedingungen
Erpenbeck und Sauter unterscheiden zwei Arten von Kompetenzentwicklung: Beabsichtigte (intendierte) und beiläufige Kompetenzentwicklung (vgl. Erpen- beck, Sauter 2007, S. 83). Bei ersterer geht es im Sinne einer Ermöglichungs- didaktik um die Beschaffenheit von Handlungssituationen mit dem Ziel der Kompetenzentwicklung. In diesem Kontext wird nach „systematischen, vor- hersagbaren und bleibenden Bedingungen“ (ebd.) für Kompetenzentwicklung gefragt. Beiläufige Kompetenzentwicklung findet statt in der täglichen Hand- lungspraxis, d.h. etwa im Arbeitsprozess und im sozialen Kontext (vgl. Erpen- beck & Sauter 2007, S. 88). Dabei kommt es immer wieder zu individuellen Entscheidungen ohne Bezug zu sachlich reflektierten Lösungswegen (ebd.). In diesen Situationen treten Dissonanzen und emotionale Labilisierung auf, die geringe oder große Änderungen von Werten über eine Situation, das eigene Handeln, sich selbst und andere Personen hervorrufen (vgl. Erpenbeck & Sau- ter 2007, S. 88-89). Diese neuen Werte werden also ohne die geringste Bil- dungsbemühung, d.h. informell erlangt (vgl. Erpenbeck & Sauter 2007, S. 89). Daher ist beiläufige Kompetenzentwicklung trotz fehlender Intention mögli- cherweise eine intensive Form der Kompetenzentwicklung (ebd.).
Die Studienbriefautoren Kalz, Klamma und Specht konstatieren, dass eine Lernumgebung mit dem Ziel der Kompetenzentwicklung, die zu einer Handlungsdisposition befähigen soll, folgende Kriterien erfüllen muss: (vgl. Kalz et al. 2008, S. 20) [im Original mit Spiegelstrichen]: 1. Sie muss eingebettet sein in authentische Lernkontexte und vernetzte Lernbereiche, die selbstbestimmtes Lernen zulassen und auf den Erwerb einer ganzheitlichen Kompetenzentwicklung abzielen. 2. Weiterhin muss die Lernumgebung eingebettet sein in einen sozialen Kontext. 3. Sie sollte außerdem formale und informelle Lernmöglichkeiten verbinden (ebd.).
2.2.3 Kompetenzentwicklung in Gruppen
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Dokuments?
Dieses Dokument befasst sich mit Kompetenzen und Kompetenzentwicklung, insbesondere im Kontext des Web 2.0 und offener Bildungsinitiativen wie BarCamps. Es untersucht, welche Potenziale BarCamps für Kompetenzentwicklung bieten.
Was sind Kompetenzen laut diesem Dokument?
Kompetenzen werden als "Dispositionen zur Selbstorganisation, also Selbstorganisationsdispositionen" definiert. Dies beinhaltet fachlich-methodische, personale, sozial-kommunikative sowie Aktivitäts- und Umsetzungskompetenzen.
Wie wird Kompetenzentwicklung in diesem Dokument beschrieben?
Kompetenzentwicklung wird als ein Prozess beschrieben, der im Subjekt selbst stattfindet, durch die "Interiorisation von Regeln, Werten und Normen zu eigenen Emotionen und Motivationen". Es wird auch zwischen beabsichtigter und beiläufiger Kompetenzentwicklung unterschieden.
Welche Rolle spielt das Web 2.0 bei der Kompetenzentwicklung?
Das Dokument untersucht, wie das Web 2.0, mit Anwendungen wie Wikipedia, die Kompetenzentwicklung fördern kann. Dies wird durch die Möglichkeiten zur kollaborativen Wissensgenerierung und dem selbstgesteuerten Lernen unterstützt.
Was ist ein BarCamp und welche Rolle spielt es in diesem Dokument?
Ein BarCamp ist ein offenes Konferenzformat, das hier am Beispiel des EduCamps (fokusiert auf mediengestütztes Lernen) untersucht wird. Das Dokument stellt die Forschungsfrage, welche Potenziale die Teilnahme an einem BarCamp für Kompetenzentwicklung bietet.
Welche Kriterien muss eine Lernumgebung erfüllen, um Kompetenzentwicklung zu fördern?
Laut dem Dokument muss eine Lernumgebung in authentische Lernkontexte eingebettet sein, selbstbestimmtes Lernen zulassen, in einen sozialen Kontext eingebunden sein und formale sowie informelle Lernmöglichkeiten verbinden.
Wie wird Kompetenzentwicklung in Gruppen betrachtet?
Das Dokument betont, dass Kompetenzentwicklung oft in Gruppen stattfindet und dass individuelles Lernen die Voraussetzung für Lernen in Gruppen oder Teams ist.
Was sind die Kernthemen des Dokuments?
Die Kernthemen sind Kompetenzbegriff, Kompetenzentwicklung als subjektiver Prozess, Kompetenzentwicklung im Kontext äußerer Bedingungen, die Rolle des Web 2.0, BarCamps als offene Bildungsinitiativen und die Bedeutung von Gruppendynamik für Kompetenzentwicklung.
Was sind Dissonanzen und Labilisierungen im Kontext der Kompetenzentwicklung?
Dissonanzen sind Widersprüche und Unsicherheiten, die während des Lernprozesses auftreten und vom Subjekt verarbeitet werden müssen. Labilisierungen beziehen sich auf psychische Labilisierung, die ebenfalls Teil des Lernprozesses sein können.
- Quote paper
- Ulrike Glembotzky (Author), 2011, Kompetenzentwicklung durch die Teilnahme an einem BarCamp am Beispiel des EduCamps, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178487