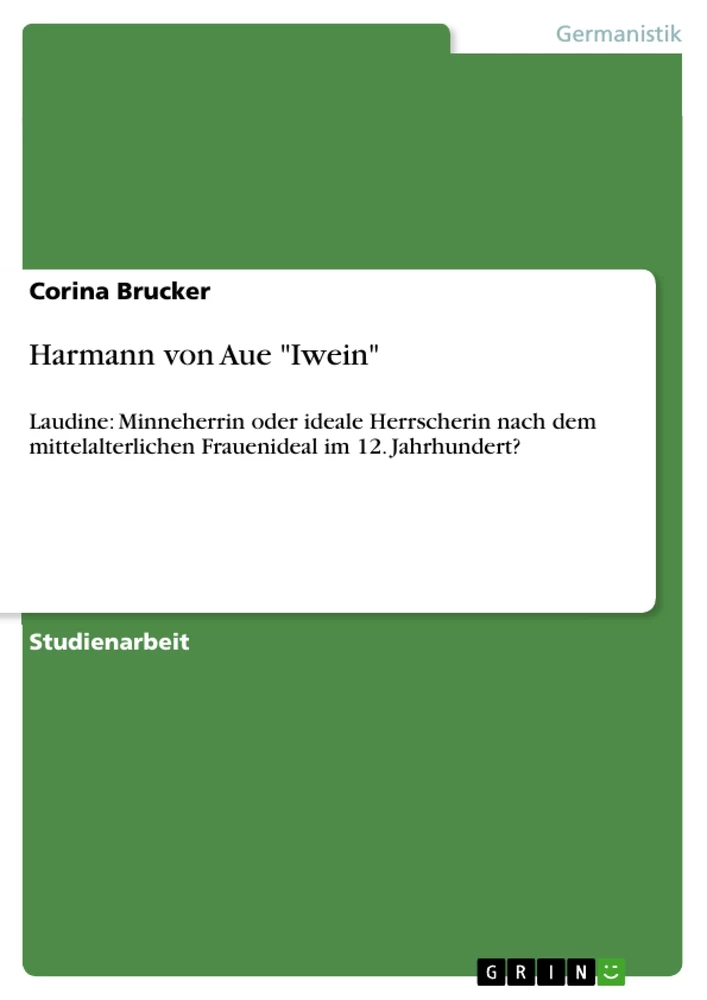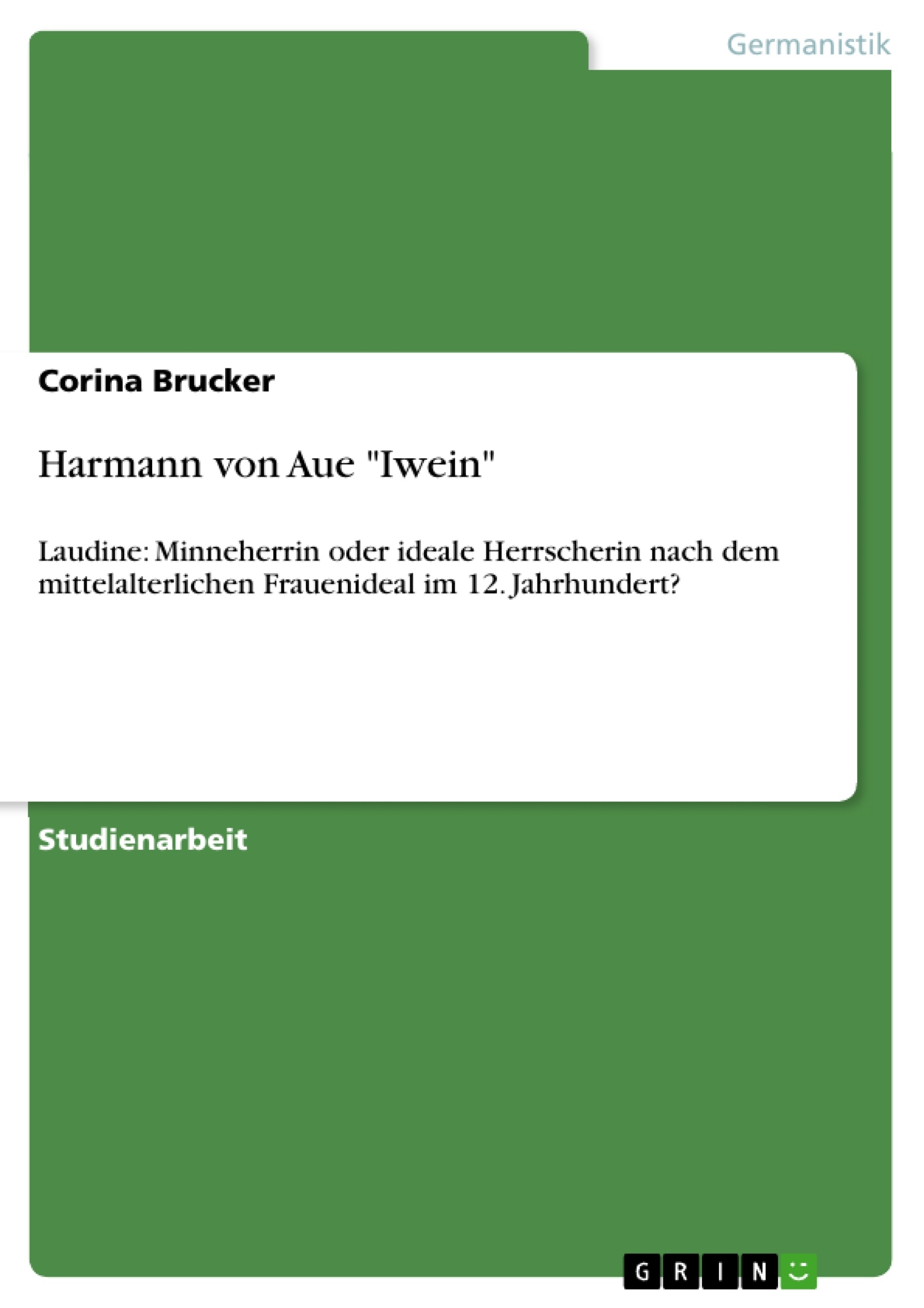Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit dem Frauenbild, beziehungsweise des Frauenideal im Mittelalter. Am Beispiel von Hartmann von der Aues Heldenepos „Iwein“ sollen die von ihm entworfenen Frauenfiguren in Bezugnahme auf die mittelalterliche Realität analysiert werden.
Die Fragestellung hierbei lautet: Inwieweit entspricht das epische Frauenbild der Realität und wie funktioniert die Frau im Spannungsfeld zwischen lyrischer Fiktion und gesellschaftlicher Wirklichkeit?
Am Beispiel von Hartmann von Aues weiblicher Hauptfigur Laudine soll geprüft werden, welchem mittelalterlichem Ideal hiermit entsprochen wird, dem gesellschaftlich-reelem oder dem episch-fiktionalem.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Inhaltsangabe
- Iweins und Laudines Entwicklung
- Iwein
- Laudine
- Zusammenfassung und Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das Frauenbild im Mittelalter am Beispiel von Hartmann von Aues Heldenepos „Iwein". Der Fokus liegt dabei auf der weiblichen Hauptfigur Laudine und der Frage, inwieweit ihr Charakter dem gesellschaftlichen Ideal der Minneherrin oder dem der Herrscherin entspricht.
- Das Frauenideal im Mittelalter
- Die Rolle der Frau in der mittelalterlichen Gesellschaft
- Die Minnekonzeption in Hartmanns "Iwein"
- Die Figur der Laudine als Minneherrin und Herrscherin
- Die Bedeutung von politischer Notwendigkeit und Liebe in der Ehe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erläutert die beiden vorherrschenden Frauenideale im Mittelalter: die Minneherrin und die Herrscherin.
Die Inhaltsangabe fasst die Handlung von Hartmanns "Iwein" zusammen und führt die Figur der Laudine sowie ihre Beziehung zu Iwein ein.
Der Abschnitt "Iweins und Laudines Entwicklung" analysiert die Charakterentwicklung der beiden Hauptfiguren. Iwein wird als ein Ritter dargestellt, der zunächst nur von Minne geleitet wird, während Laudine stets ihre Rolle als Herrscherin im Vordergrund stellt.
Die Zusammenfassung und das Fazit bewerten Laudines Charakter und stellen fest, dass sie eher als eine pragmatische und politisch denkende Herrscherin denn als eine romantische Minneherrin dargestellt wird.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Frauenbild im Mittelalter, die Minnekonzeption, das Heldenepos "Iwein", die Figur der Laudine, die Rolle der Frau in der mittelalterlichen Gesellschaft, die politische Ehe, die Minneherrin und die Herrscherin. Die Arbeit beleuchtet die Spannungen zwischen gesellschaftlichen Normen und individuellen Bedürfnissen im Kontext der mittelalterlichen Liebes- und Ehebeziehungen.
Häufig gestellte Fragen
Welches Frauenbild wird in Hartmann von Aues „Iwein“ untersucht?
Die Arbeit untersucht das Spannungsfeld zwischen der fiktionalen Minneherrin und der realen gesellschaftlichen Rolle der Frau als Herrscherin im Mittelalter.
Wer ist die weibliche Hauptfigur in „Iwein“?
Die zentrale Frauenfigur ist Laudine, die nach dem Tod ihres Mannes den Ritter Iwein heiratet.
Entspricht Laudine dem Ideal der romantischen Liebe?
Die Analyse zeigt, dass Laudine eher als pragmatische und politisch denkende Herrscherin agiert, für die der Schutz ihres Landes wichtiger ist als rein romantische Motive.
Was war die Funktion der Minne im Mittelalter?
Die Minne war ein literarisches und gesellschaftliches Konzept der ritterlichen Liebe, das oft in einem Spannungsverhältnis zur Realität der politischen Ehe stand.
Wie entwickelt sich die Beziehung zwischen Iwein und Laudine?
Iwein wird zunächst von Minne geleitet, während Laudine aus politischer Notwendigkeit handelt. Die Arbeit untersucht, wie diese unterschiedlichen Motivationen die Ehe prägen.
Was ist das Fazit zur Figur der Laudine?
Laudine wird als Figur interpretiert, die gesellschaftliche Wirklichkeit (Herrschaftspflichten) über lyrische Fiktion (reine Minne) stellt.
- Quote paper
- Corina Brucker (Author), 2009, Harmann von Aue "Iwein", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178494