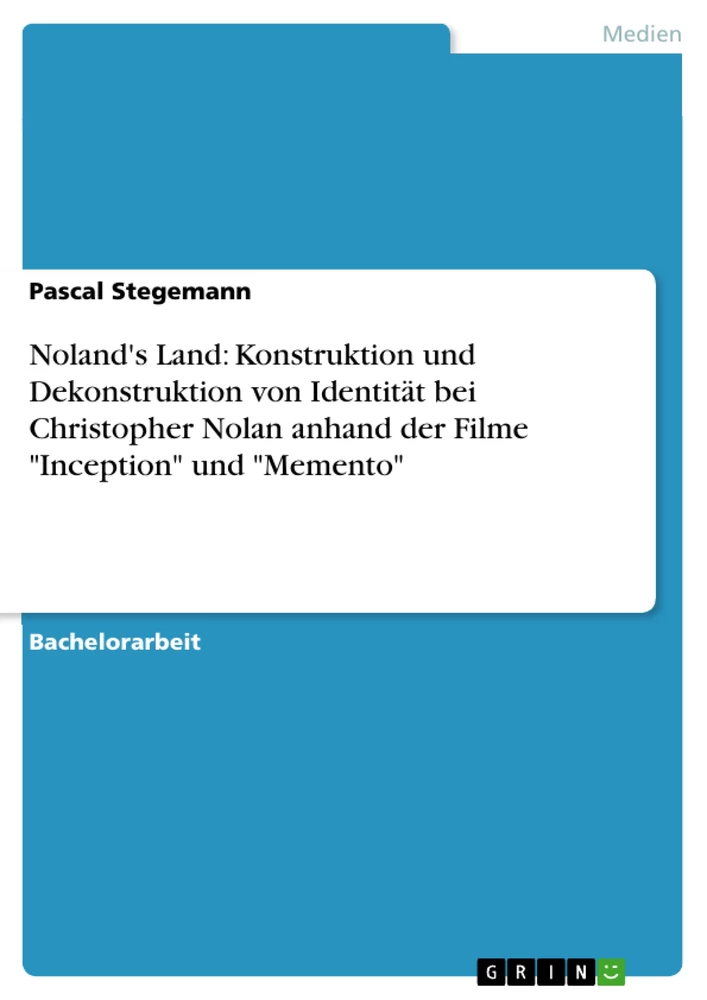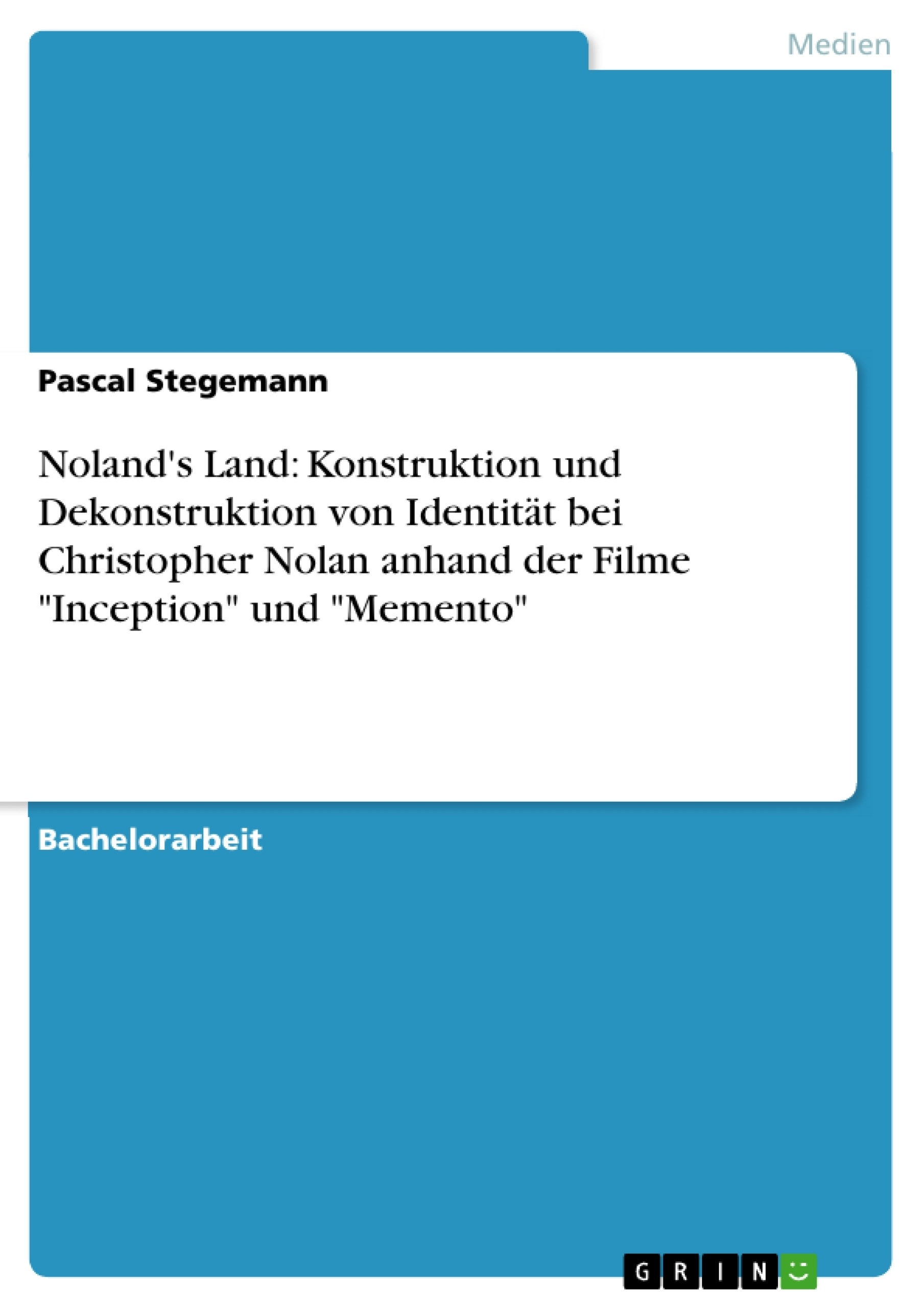Einleitung: Postmodernismus und postmoderne Identität
„Postmoderne, das sei das Ende der leitenden Ideen, wie sie die Moderne bestimmt hätten […] Wenn nämlich der Begriff Postmoderne einen Sinn hat, dann nur weil uns die Moderne um ihre Modernität betrog."
Dieses Zitat von Burghart Schmidt beinhaltet bereits viel Aussagekraft über den Begriff der Postmoderne. Unsere Welt ist voll von postmodernen Phänomenen. Dieses begriffliche Konstrukt bezeichnet eine besondere Sichtweise, Darstellungsform und Philosophie unserer Welt mit ihren vielschichtigen gesellschaftlichen Teilbereichen wie der Wissenschaft, der Kunst, der Politik, der Soziologie und der Kultur. Die Postmoderne ist eine geistig-kulturelle Bewegung, deren Anfänge in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts liegen und die in erster Linie eine Denkweise bezeichnet, die sich gegen die als totalitär und steril empfundenen Methoden, Begriffe, Definitionen und Grundannahmen der Moderne richtet.
1. Postmodernes Denken in Kunst und Kultur
Nach Burghart Schmidt steht nicht das innovative Streben, wie es eigentlich ein grundlegendes Merkmal und Schaffensgedanke des Künstlertums ist, im Mittelpunkt des Postmodernismus, sondern die Rekombination oder die Neuanwendung bereits bestehender Ideen. Postmodernes Denken schlägt sich dabei in der Auffassung nieder, dass eine Vielzahl von gleichberechtigt nebeneinander bestehenden Perspektiven in allen Lebensbereichen und gesellschaftlichen Teilbereichen existiert. Diese grundsätzliche Offenheit von Kunst und Kultur und der daraus resultierende mehrdimensionale Blick auf die Welt machten sich die Künstler der Postmoderne zu Eigen und schufen einen vielschichtigen Begriff der Wirklichkeit der Welt. In der Literatur, in der Architektur, in der Malerei und vor allem im Film wird deshalb ein hohes Maß an Interpretationsmöglichkeiten tradiert, die eine endgültige Wahrheit gibt es nicht: Die Künstler der Postmoderne betrachten die Welt als einen pluralistischen, zufälligen und chaotischen Ort.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung: Postmodernismus und postmoderne Identität
- Postmodernes Denken in Kunst und Kultur
- Postmoderne Identitätskonzepte
- Kriterien für postmoderne Identitätskonzepte
- Filmbeispiel: I'm not there als Prototyp für die postmoderne Identität
- Semiotik: Grundlagen und Voraussetzungen
- Filmsemiotik: Zeichenhaftigkeit und Différance-Konzept
- Das postmoderne Identitätskonzept der Différance nach Jacques Derrida
- Dekonstruktion als Strukturprinzip in postmodernen Filmen
- Ausprägungen und Merkmale von Identität im postmodernen Film
- Filmsemiotik: Zeichenhaftigkeit und Différance-Konzept
- Konstruktion und Dekonstruktion von Identität bei Christopher Nolans Memento und Inception
- Grundlagen und Voraussetzungen: Inhaltsangabe und Ausgangslage der Identität bei Leonard Shelby in Memento
- Mediale Repräsentation von Wirklichkeit und Identität
- Symbolik: Identitätsproblematik als Zeichen
- Konsequenzen von Leonard's Gedächtnisverlust für seine Identitätskonstruktion
- Identitätskrise und finale Dekonstruktion
- Sammy Jankis' Identität als Leonard's Identität zweiter Ordnung
- Grundlagen und Voraussetzungen: Inhaltsangabe und Figurenkonstellation in Inception
- Die fünf Wirklichkeitsebenen als radikale Form der Wirklichkeitsräume
- Dominick Cobb's Realität als weiterer Traum
- Cobb's Team-Mitglieder als Projektionen seines Unterbewusstseins
- Mal's Tod als Auslöser für Cobb's Identitätskonflikt
- Cobb's Identitätskonflikt: Verantwortung vs. Schuldgefühl
- Symbolik: Der Kreisel und der Zug
- Konkrete Traumelemente in der ,Realität'
- Bedeutung des Fischer-Projekts für Cobb's Identitätsstiftung
- Endgültige Lösung des Identitätskonflikts und Identitätsstiftung
- Christopher Nolan's Spiel mit dem Zuschauer
- Postmoderne Identitätskonzepte in Memento und Inception
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit analysiert die Konstruktion und Dekonstruktion von Identität in den Filmen Memento und Inception von Christopher Nolan. Die Arbeit untersucht, wie die beiden Protagonisten Leonard Shelby und Dominick Cobb mit ihren jeweiligen Identitätskrisen umgehen und welche Rolle die postmoderne Denkweise dabei spielt.
- Postmoderne Identitätskonzepte: Die Arbeit beleuchtet die Abkehr von einem einheitlichen und dauerhaften Identitätsbegriff hin zu einer fragmentierten und wandelbaren Identität.
- Semiotik und Film: Die Arbeit analysiert die Zeichenhaftigkeit von Identität in den Filmen und untersucht, wie diese durch die semiotische Dimension des Mediums Film vermittelt wird.
- Wirklichkeitskonstruktion: Die Arbeit untersucht, wie die beiden Protagonisten ihre eigene Wirklichkeit konstruieren und wie diese Konstruktion mit ihrer Identitätsfindung zusammenhängt.
- Traum und Realität: Die Arbeit analysiert die Traumwelten in Inception und untersucht, wie diese als metaphorische Spiegelung von Cobb's innerem Konflikt dienen.
- Identitätskonflikt: Die Arbeit untersucht die Konflikte, mit denen die beiden Protagonisten konfrontiert werden, und wie sie versuchen, diese zu lösen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in den Postmodernismus und die damit verbundenen Identitätskonzepte. Sie beleuchtet die Abkehr von traditionellen, einheitlichen Identitätsvorstellungen und die Bedeutung der Dekonstruktion in der postmodernen Denkweise.
Im zweiten Kapitel werden die Grundlagen der Semiotik erläutert und die Bedeutung von Zeichen in der Filmsemiotik dargestellt. Das Différance-Konzept von Jacques Derrida wird als ein zentrales Element der postmodernen Identitätsdekonstruktion vorgestellt.
Das dritte Kapitel analysiert die beiden Filme Memento und Inception. Die Arbeit untersucht, wie Leonard Shelby und Dominick Cobb mit ihren jeweiligen Identitätskrisen umgehen und welche Rolle die postmoderne Denkweise dabei spielt.
Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung und einem Fazit, das die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Filme in Bezug auf die postmoderne Identität beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Postmodernismus, die postmoderne Identität, die Konstruktion und Dekonstruktion von Identität, die Filmsemiotik, das Différance-Konzept, Memento, Inception, Christopher Nolan, Traum und Realität, Identitätskonflikt, Leonard Shelby, Dominick Cobb, und die Bedeutung von Erinnerungen.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Identität in der Postmoderne definiert?
Die Postmoderne verabschiedet sich von einem einheitlichen Identitätsbegriff und betrachtet Identität als fragmentiertes, wandelbares und durch Dekonstruktion geprägtes Konstrukt.
Was bedeutet das Différance-Konzept von Jacques Derrida für den Film?
Es dient als semiotische Grundlage, um zu zeigen, wie Zeichen und Identitäten im Film ständig verschoben und nie endgültig fixiert werden, was Christopher Nolan in seinen Werken nutzt.
Wie dekonstruiert Christopher Nolan die Identität in "Memento"?
Durch den Gedächtnisverlust des Protagonisten Leonard Shelby wird gezeigt, wie instabil Identität ohne kontinuierliche Erinnerung ist und wie mediale Repräsentationen (Fotos, Tattoos) die Realität verzerren.
Welche Rolle spielen die Traumebenen in "Inception" für die Identitätsfindung?
Die fünf Wirklichkeitsebenen dienen als radikale Räume, in denen Dominick Cobb seinen inneren Konflikt zwischen Schuldgefühlen und Verantwortung verarbeitet, um seine Identität neu zu stiften.
Was symbolisieren Kreisel und Zug in Nolans Filmen?
Diese Symbole dienen als semiotische Anker für die Charaktere und den Zuschauer, um zwischen verschiedenen Realitätsebenen und dem Zustand der Identität zu unterscheiden.
- Citar trabajo
- B.A. Pascal Stegemann (Autor), 2011, Noland's Land: Konstruktion und Dekonstruktion von Identität bei Christopher Nolan anhand der Filme "Inception" und "Memento", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178512