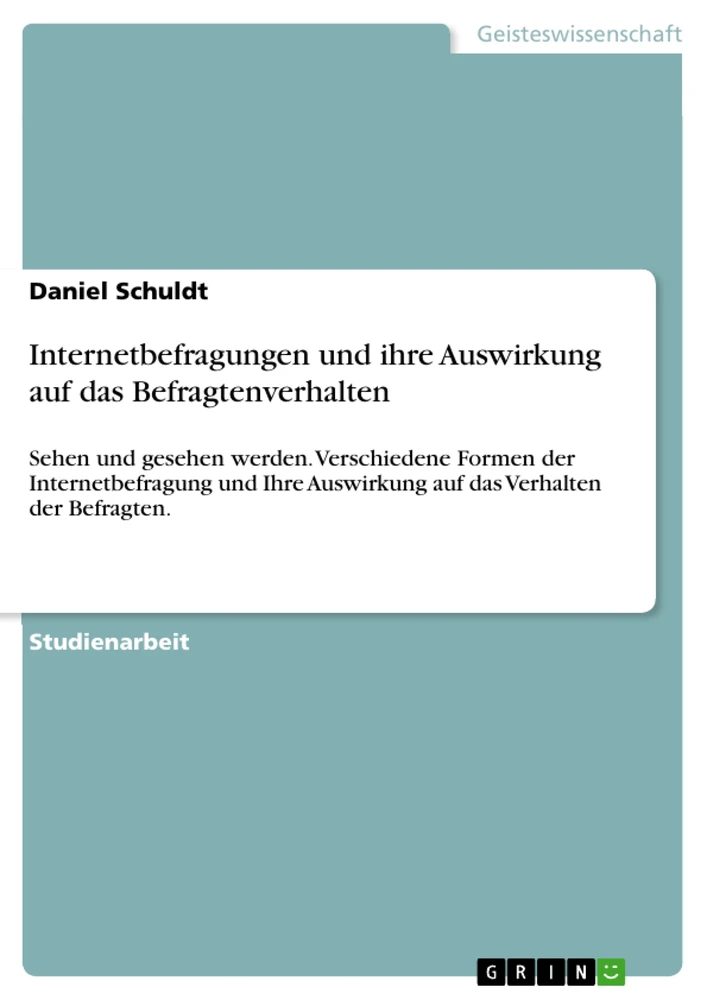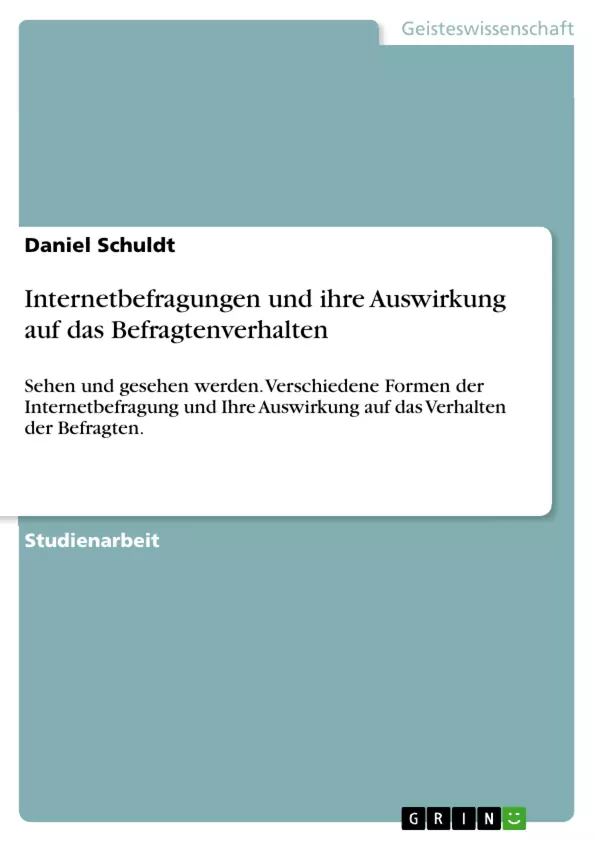Aufgrund der großen Reichweite und Bandbreite der über das Internet erreichbaren Personenkreise wird das World Wide Web auch immer interessanter in Bereichen der Forschung, sei es zu Zwecken der Marktforschung oder zur Durchführung von Studien.
Zwar sind die Instrumente zur Durchführung von Befragungen technisch bereits ausgereift, jedoch weisen diese immer noch methodenimmanente Probleme auf.
Zwar kann über das Internet ohne großen Personal- und Kostenaufwand eine große Menge von Information über eine hohe Anzahl von Personen mittels web-basierten Fragebogen gesammelt werden, nur gibt es wenig Untersuchungen was die Qualität und die Aussagekraft dieser Untersuchungen betrifft, sowie inwieweit sich das Antwortverhalten der Befragten im Vergleich zu persönlicheren Interviewformen ändert.
Genau mit dieser Fragestellung beschäftigt sich auch diese Arbeit. Im Folgenden werde ich somit die Unterschiede zwischen den verschiedenen Formen der Kommunikation im Allgemeinen und der Internetkommunikation im Besonderen herausarbeiten. Zudem werde ich Ihren Einfluss auf das Befragtenverhalten beschreiben, um dann mit Hilfe von verschiedenen Untersuchungsergebnissen herauszustellen, inwieweit sich das Internet und insbesondere die audiovisuelle Fernkommunikation zur Erhebung von Daten zu Forschungszwecken eignen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Arten der interpersonellen Individualkommunikation
- Face-to-Face Kommunikation
- Interpersonelle Fernkommunikation
- Audiovisuelle interpersonelle Fernkommunikation
- Befragung als soziale Interaktion
- Das Problem der sozialen Erwünschtheit
- Soziale Präsenz und ihre Messung
- Mühlenfelds zwei Haupthypothesen
- Untersuchungsergebnisse und kurzes Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht den Einfluss von verschiedenen Formen der Internetbefragung auf das Verhalten der Befragten. Dabei wird der Fokus auf die audiovisuelle Fernkommunikation im Internet gelegt und deren Potenzial zur Datenerhebung im Vergleich zu traditionelleren Interviewformen analysiert.
- Arten der Kommunikation: Untersucht werden verschiedene Formen der Kommunikation, darunter Face-to-Face-Kommunikation und verschiedene Formen der Fernkommunikation.
- Soziale Erwünschtheit: Die Arbeit analysiert die Problematik der sozialen Erwünschtheit in Befragungen und untersucht, wie diese in Online-Befragungen auftreten kann.
- Soziale Präsenz: Die Arbeit beleuchtet den Begriff der sozialen Präsenz in der Online-Kommunikation und untersucht deren Einfluss auf das Antwortverhalten in Befragungen.
- Mühlenfelds Hypothesen: Die Studienarbeit diskutiert die zentralen Hypothesen von Hans-Ullrich Mühlenfeld, der sich mit dem Einfluss von webbasierter, audiovisueller Fernkommunikation auf das Verhalten von Befragten auseinandersetzt.
- Untersuchungsergebnisse: Die Arbeit präsentiert die Untersuchungsergebnisse von Mühlenfeld und zieht daraus ein Fazit über die Eignung des Internets für die Erhebung von Daten zu Forschungszwecken.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung präsentiert die Relevanz des Internets für die Kommunikation und Forschung und stellt die Problematik der methodenimmanenten Probleme bei Online-Befragungen heraus.
- Arten der interpersonellen Individualkommunikation: Dieses Kapitel differenziert zwischen verschiedenen Formen der Kommunikation, darunter Face-to-Face-Kommunikation, interpersonelle Fernkommunikation und audiovisuelle interpersonelle Fernkommunikation.
- Befragung als soziale Interaktion: Dieses Kapitel widmet sich dem Problem der sozialen Erwünschtheit in Befragungen und untersucht die Rolle der sozialen Präsenz in der Online-Kommunikation.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Kommunikation im Netz, Internetbefragung, audiovisuelle Fernkommunikation, soziale Erwünschtheit, soziale Präsenz, Verhalten von Befragten und Untersuchungsergebnisse von Hans-Ullrich Mühlenfeld.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst das Internet das Befragtenverhalten?
Die Anonymität und die physische Distanz im Netz können das Antwortverhalten verändern, wobei die Qualität der Daten oft von der Art der Kommunikation abhängt.
Was ist das Problem der "sozialen Erwünschtheit"?
Befragte neigen dazu, Antworten zu geben, von denen sie glauben, dass sie gesellschaftlich akzeptiert sind. Online-Befragungen können dieses Verhalten je nach Setting reduzieren oder verstärken.
Was bedeutet "soziale Präsenz" bei Online-Umfragen?
Soziale Präsenz bezeichnet das Gefühl, dass ein realer Interaktionspartner vorhanden ist. Bei audiovisuellen Befragungen ist diese höher als bei reinen Text-Fragebögen.
Eignen sich audiovisuelle Fernbefragungen für die Forschung?
Die Arbeit untersucht, ob Video-Interviews eine vergleichbare Datenqualität wie Face-to-Face-Interviews liefern und welche methodischen Hürden dabei bestehen.
Was sind die Vorteile von Web-basierten Fragebögen?
Sie ermöglichen eine große Reichweite ohne hohen Personal- und Kostenaufwand und erlauben die schnelle Erhebung großer Datenmengen.
- Arbeit zitieren
- Daniel Schuldt (Autor:in), 2006, Internetbefragungen und ihre Auswirkung auf das Befragtenverhalten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178515