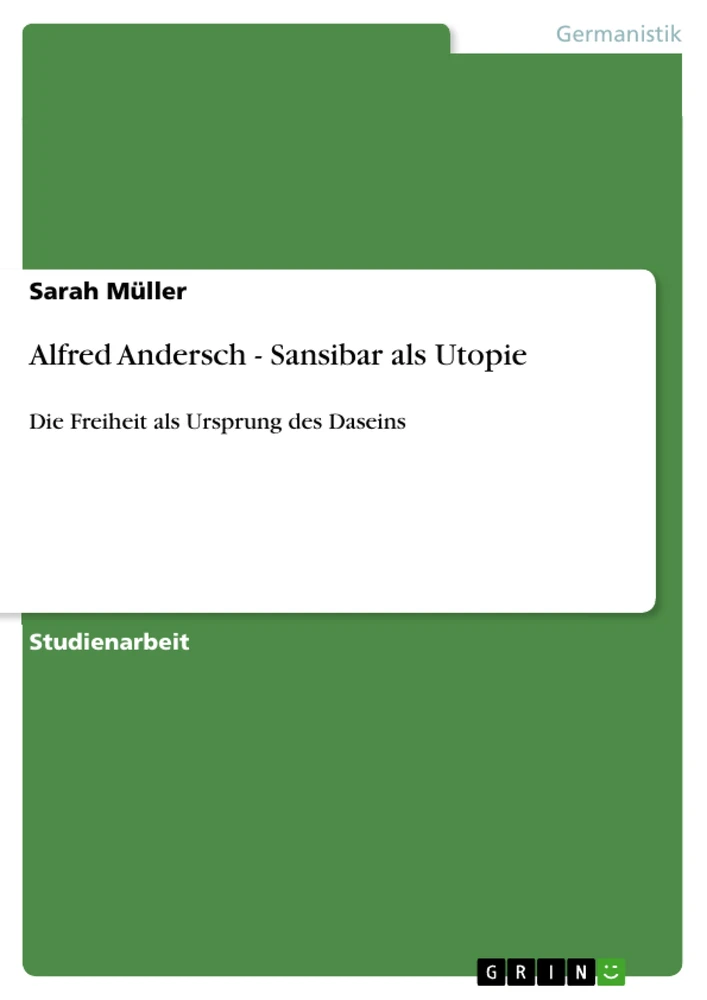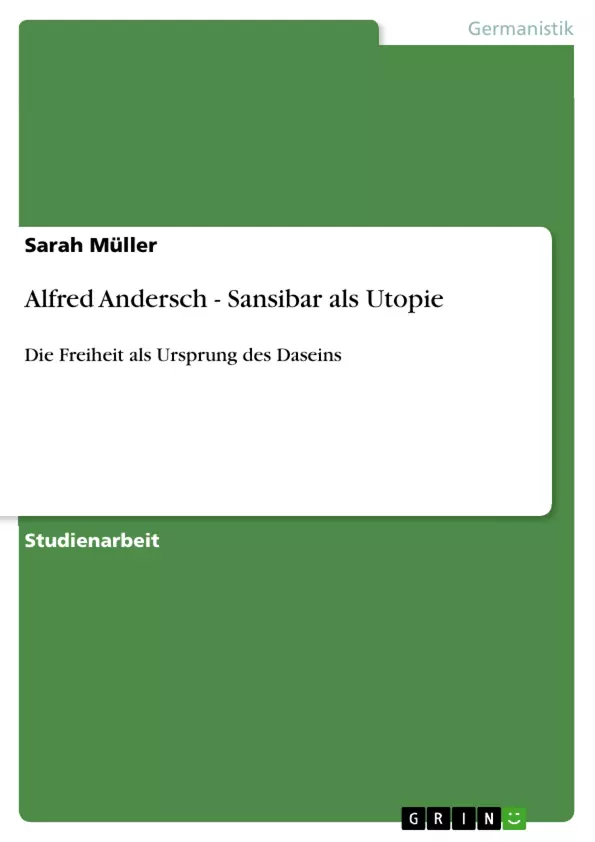Alfred Anderschs autobiographischer Bericht Die Kirschen der Freiheit erntete in Zeiten des politischen und sozialen Wandels im jungen Deutschland lediglich negative Kritiken. Schonungslos berichtete der Autor hier über seine persönlichen Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus und eckte mit seinen eigenen Ansichten dazu bei einigen Lesern an.
Im Gegensatz zu seinem autobiographischen Erlebnisbericht konnte sein erster Roman Sansibar oder der letzte Grund beinahe ausnahmslos positive Kritik verzeichnen.
Er wurde durch seinen ersten Roman zu einem populären Erfolgsautor, der sowohl damals als auch heute noch zum Denken anregt und uns im Schaffen unzähliger Möglichkeiten so viele Spielbälle zuwirft, wie wir niemals auffangen können.
Die vorliegende Arbeit wirft einen Blick auf Alfred Anderschs ganz persönliches Sansibar. Sein ganzes Werk beruft sich immer wieder auf die Freiheit im Sinne des Existentialismus. Das Forschen nach dem letzten Grund ist für ihn die Suche nach der Freiheit. Im weiteren Verlauf widmet sich diese Arbeit Anderschs Sansibar als Fluchtpunkt aus der Krise. Es stellt sich die Frage, ob Andersch einen moralischen Anspruch verfolgt hat. Es handelt sich um ein Werk, das eine Möglichkeit durchspielt und zeigt, dass die Not Menschen zusammenbringt. Des Weiteren ist es interessant, ob Alfred Andersch vielleicht einerseits mit dem erhobenen Zeigefinger auf seinen Leser herabschaut und andererseits den Protagonisten des Romans oder gar weitere Charaktere dazu nutzt seinen eigenen Lebenslauf zu begradigen. Beim Lesen des Werkes könnte sich durchaus die Frage stellen, ob hier eine Art des autobiographischen Verzerrens geschieht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sansibar eine verwandelte Welt
- Die Innenperspektive
- Freiheit als Fluchtpunkt
- Der letzte Grund – die Therapie?
- Der Moralist Alfred Andersch
- Autobiographisches Verzerren?
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Alfred Anderschs Roman „Sansibar oder der letzte Grund“ und analysiert dessen Bedeutung als Fluchtpunkt aus der Krise der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Es wird untersucht, ob Andersch einen moralischen Anspruch verfolgt und ob er autobiographische Elemente in die Romanhandlung einarbeitet.
- Sansibar als Fluchtpunkt aus der Krise
- Der moralische Anspruch des Romans
- Autobiographische Elemente in der Romanhandlung
- Die Darstellung von Freiheit und Individualismus
- Die Bedeutung der Flucht als Motiv im Roman
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt Alfred Andersch und sein Werk vor und erläutert die Problematik seiner autobiographischen Werke im Kontext der deutschen Nachkriegszeit. Sie führt in die Thematik von Freiheit und Moral ein, die im weiteren Verlauf der Arbeit betrachtet werden.
Sansibar eine verwandelte Welt
Dieses Kapitel analysiert die Romanhandlung von „Sansibar oder der letzte Grund“ und beleuchtet die Bedeutung von Sansibar als Fluchtpunkt aus der deutschen Realität. Es wird der Frage nachgegangen, wie die Figuren im Roman mit der Flucht umgehen und welche Auswirkungen diese auf ihr Leben hat.
Die Innenperspektive
Das Kapitel beleuchtet die Charakterisierung der Romanfiguren und analysiert die Erzählperspektive des Romans. Es werden kritische Punkte im Hinblick auf die Darstellung der Figuren und ihre Charaktereigenschaften erörtert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen von Freiheit, Flucht, Moral und Identität im Kontext von Alfred Anderschs Roman „Sansibar oder der letzte Grund“. Die Untersuchung konzentriert sich auf die Analyse der Romanhandlung, der Charakterisierung der Figuren und der Bedeutung von Sansibar als Fluchtpunkt aus der deutschen Nachkriegszeit. Im Fokus stehen die Fragen nach dem moralischen Anspruch des Romans, nach autobiographischen Elementen in der Romanhandlung und nach der Darstellung von Freiheit und Individualismus.
Häufig gestellte Fragen
Was symbolisiert "Sansibar" in Alfred Anderschs Roman?
Sansibar steht als Utopie und Fluchtpunkt für die Sehnsucht nach Freiheit und dem "letzten Grund" im Sinne des Existentialismus.
Welchen moralischen Anspruch verfolgt der Roman?
Das Werk spielt Möglichkeiten durch, wie Menschen in der Not zusammenfinden und zeigt die individuelle Suche nach moralischer Integrität in einer Krisenzeit.
Gibt es autobiographische Bezüge in "Sansibar oder der letzte Grund"?
Die Arbeit hinterfragt, ob Andersch die Protagonisten nutzt, um seinen eigenen Lebenslauf zu "begradigen" und ob eine Art "autobiographisches Verzerren" vorliegt.
Wie wird die Freiheit im Werk dargestellt?
Die Freiheit wird im Sinne des Existentialismus als eine ständige Suche und als Fluchtpunkt aus der bedrückenden Realität des Nationalsozialismus thematisiert.
Warum wurde Anderschs Bericht "Die Kirschen der Freiheit" kritisiert?
Im Gegensatz zum Roman stieß sein autobiographischer Bericht auf negative Kritik, da er seine persönlichen Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus sehr schonungslos darstellte.
- Arbeit zitieren
- Sarah Müller (Autor:in), 2010, Alfred Andersch - Sansibar als Utopie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178599