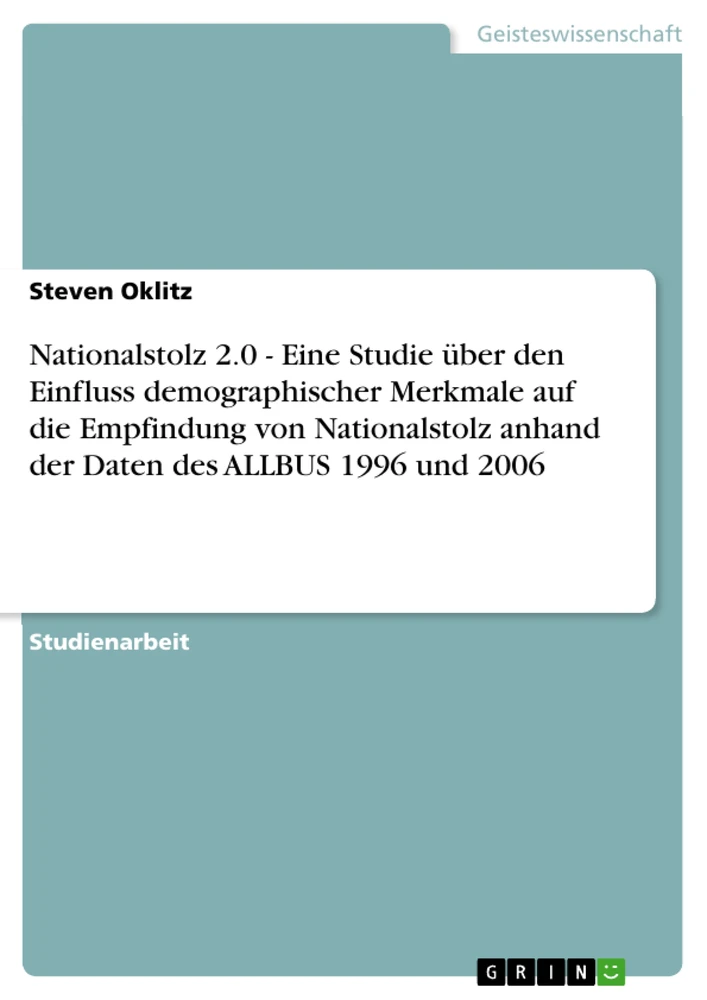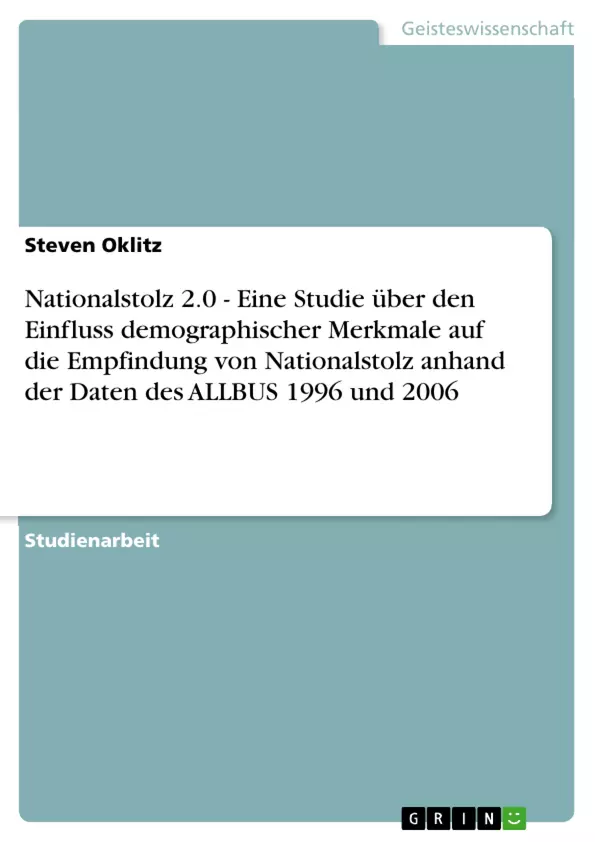Der Nationalstolz ist in vielen Ländern ein selbstverständliches Thema und eine Empfindung, die eher erwünscht als unerwünscht ist. Der unverkrampfte Umgang mit der eigenen Identität und den
Landesfarben ist beispielsweise in den USA eine Normalität. In jedem Vorgarten weht die amerikanische Flagge als Ausdruck eines gewissen Stolzes auf das eigene Land. Nicht nur in Übersee, sondern auch in Europa sind viele Nationen stolz auf sich, und stellen dies ohne
Übertreibung zur Schau. Die Bundesrepublik Deutschland bildet hierbei eine Ausnahme. Wer eine deutsche Fahne im Vorgarten stehen hatte, wurde kritisch beäugt und des latenten Rechtsextremismus beschuldigt. Die Deutschen waren möglicherweise ebenso stolz auf ihre Nation wie die Franzosen oder die Griechen, allerdings wurde die Zurschaustellung dieses Stolzes oftmals missbilligt.
In den letzten Jahren war diesbezüglich ein Wandel festzustellen und besonders beeindruckend wurde dieser Wechsel durch die WM 2006 dokumentiert. Die Deutschen bekannten sich zu ihren Farben und ihrer Identität, was im Ausland zu großen Teilen positiv aufgenommen wurde. Nun stellt sich die Frage, ob es einen neuen Nationalstolz gibt, und wovon dieser abhängen könnte.
Genau diese Thematik ist Fokus der vorliegenden Hausarbeit. Hierfür wird im ersten Teil der Datensatz des ALLBUS beschrieben, die Forschungsfrage erläutert und Hypothesen erstellt, bevor
es anschließend zur Klärung der Variablen kommt. Im Hauptteil der Arbeit kommt es zu einer Klärung der wichtigsten Methoden und Konzepte einer logistischen Regression, bevor diese dann
anschließend in mehreren Modellen Ergebnisse liefert. Nachdem das letzte Modell, welches alle verwendeten unabhängigen Variablen einschließt, interpretiert wurde, wird der Interaktionseffekt
behandelt. Abschließend werden die aufgestellten Hypothesen überprüft und ein Schlussfazit gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Der ALLBUS
- 2.1 ALLBUS 1996
- 2.2 ALLBUS 2006
- 2.3 Relevanz dieser Wellen
- 3 Forschungsfrage
- 3.1 Hypothesen
- 3.2 Variablen
- 3.2.1 abhängige Variable
- 3.2.2 unabhängige Variablen
- 3.3 deskriptive Statistik
- 3.3.1 Häufigkeitsauszählungen
- 3.3.2 Kreuztabellen
- 4 Logistische Regression
- 4.1 Theoretischer Hintergrund
- 4.2 Modelle
- 5 Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Einfluss demographischer Merkmale auf die Empfindung von Nationalstolz in Deutschland. Sie analysiert die Daten des ALLBUS 1996 und 2006, um festzustellen, ob es einen Wandel im Nationalstolz gibt und welche Faktoren diesen beeinflussen könnten.
- Die Entwicklung von Nationalstolz in Deutschland
- Der Einfluss von demographischen Merkmalen auf Nationalstolz
- Die Anwendung der logistischen Regression zur Analyse von Daten
- Die Interpretation der Ergebnisse und Überprüfung der aufgestellten Hypothesen
- Die Bedeutung der Ergebnisse für das Verständnis des Wandels im Nationalstolz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext der Studie und die Forschungsfrage beschreibt. Anschließend wird der ALLBUS-Datensatz vorgestellt, insbesondere die Wellen von 1996 und 2006, die für die Analyse relevant sind. Die Forschungsfrage und die Hypothesen werden erläutert und die verwendeten Variablen definiert.
Kapitel 3 behandelt die deskriptive Statistik, inklusive Häufigkeitsauszählungen und Kreuztabellen. Kapitel 4 beleuchtet die logistische Regression als Methode zur Analyse der Daten, wobei sowohl der theoretische Hintergrund als auch die verwendeten Modelle erläutert werden.
Schlüsselwörter
Nationalstolz, ALLBUS, demographische Merkmale, logistische Regression, Deutschland, Einstellungen, ethnische Gruppen, Wandel, Identität, gesellschaftliche Entwicklungen, Forschung, Sozialwissenschaften, Datenanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich der Nationalstolz in Deutschland verändert?
Die Arbeit untersucht den Wandel von einer eher kritischen Haltung hin zu einem unverkrampfteren Umgang mit nationalen Symbolen, wie er während der WM 2006 sichtbar wurde.
Welche Rolle spielen demographische Merkmale?
Es wird analysiert, wie Alter, Bildung, Wohnort (Ost/West) und Geschlecht die Empfindung von Nationalstolz beeinflussen.
Was ist der ALLBUS?
Die Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften, deren Daten aus den Jahren 1996 und 2006 als Basis für diese statistische Analyse dienen.
Was zeigt die logistische Regression in dieser Studie?
Die Methode wird genutzt, um die Wahrscheinlichkeit für das Empfinden von Nationalstolz in Abhängigkeit von verschiedenen unabhängigen Variablen zu berechnen.
Gibt es Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland?
Die Arbeit vergleicht die Daten beider Regionen, um festzustellen, ob die historische Trennung auch 2006 noch Auswirkungen auf die nationale Identität hatte.
- Citar trabajo
- Steven Oklitz (Autor), 2010, Nationalstolz 2.0 - Eine Studie über den Einfluss demographischer Merkmale auf die Empfindung von Nationalstolz anhand der Daten des ALLBUS 1996 und 2006, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178649