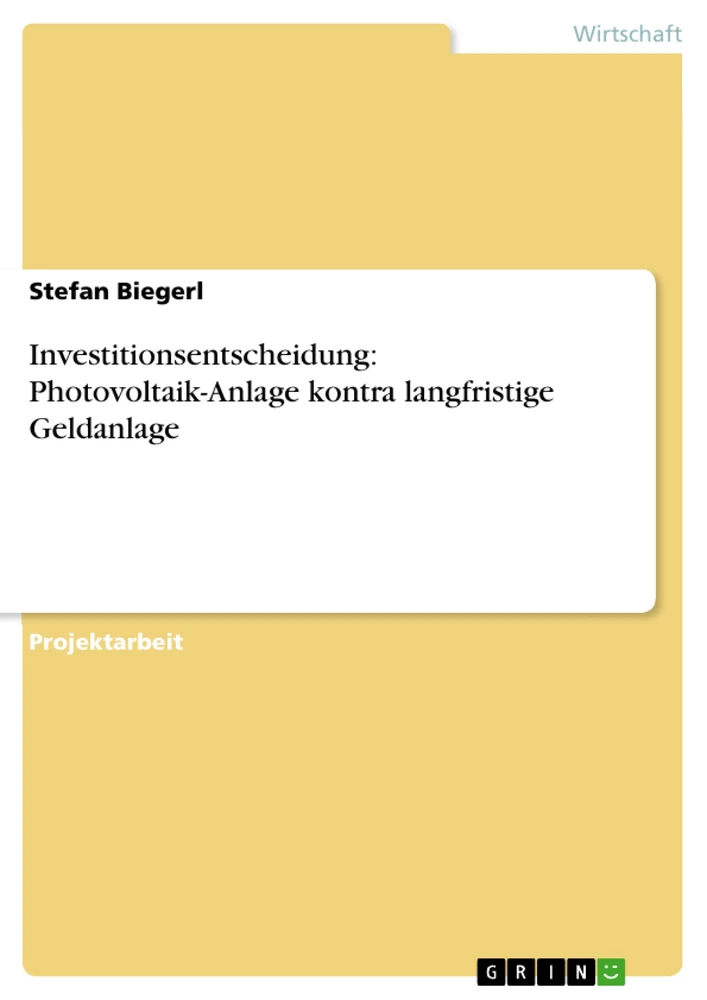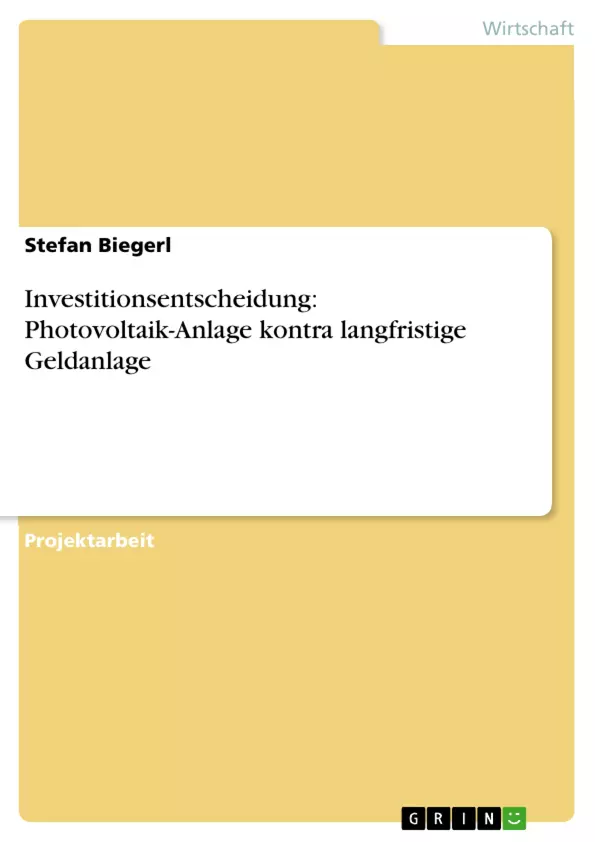Das in Bayern ansässige, mittelständige Unternehmen, auf das in der vorliegenden Arbeit Bezug genommen wird, zählt mit seiner mittlerweile 70-jährigen Erfahrung zu einem der führenden Spezialglasverarbeiter – und das für eine Vielfalt von Anwendungsbereichen. Die einzigartige Fertigungsbandbreite setzt Maßstäbe in Hinblick auf Flexibilität und Termintreue. Ständige Innovationen und der Einsatz neuester Technologien machen das Unternehmen zu einem kompetenten Partner weltweit. Ob für die Beleuchtungsindustrie, die Ofenindustrie, den Maschinen- und Gerätebau, die optische Industrie, die Elektroindustrie oder Forschung und Wissenschaft: Es werden stets höchste Anforderungen an die Produkte gestellt. Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter sind Grundlage für eine solide und erfolgreiche Unternehmensführung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Kurze Unternehmensvorstellung
- 1.2 Erörterung der Unternehmensziele
- 2. Projektierung der Photovoltaikanlage
- 2.1 Das Strahlungsangebot als Einflussgröße der Energiegewinnung
- 2.2 Neigung und Ausrichtung der Anlage
- 2.3 Prognose der Jahres-Strahlungsenergie für den Anlagenstandort
- 2.4 Auswahlkriterien der PV-Komponenten
- 3. Einnahmen und Ausgaben für die Photovoltaikanlage
- 3.1 Einholen einschlägiger Angebote
- 3.2 Ausgaben für den laufenden Betrieb
- 3.3 Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz
- 3.4 Einnahmen durch die Energieerzeugung
- 4. Analyse der langfristigen Kapitalanlage
- 4.1 Entscheidung in Hinblick auf die Anlagenart
- 4.2 Erläuterungen zur Anlagenart
- 4.3 Auswahl eines Bundeswertpapieres
- 4.4 Auslagen und Gebühren für den Ankauf
- 4.5 Kapitalertrag zum Kupontermin
- 4.6 Vorzeitige Auszahlung des Nennwertes
- 5. Wirtschaftlicher Vergleich beider Anlageformen
- 5.1 Besteuerung der Erträge
- 5.2 Die Regula-Falsi-Methode
- 5.3 Wirtschaftlichkeitsberechnung der Photovoltaikanlage
- 5.4 Wirtschaftlichkeitsberechnung der Bundesanleihe
- 6. Empfehlung
- 7. Literaturverzeichnis
- 8. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Projektarbeit untersucht die Wirtschaftlichkeit einer Investitionsentscheidung in eine Photovoltaikanlage im Vergleich zu einer langfristigen Geldanlage in Bundesanleihen. Die Arbeit analysiert die Faktoren, die die Wirtschaftlichkeit beider Anlageformen beeinflussen, einschließlich der Einnahmen und Ausgaben, der Förderung und der Besteuerung.
- Wirtschaftlichkeitsvergleich von Photovoltaikanlage und Bundesanleihe
- Einnahmen und Ausgaben für die Photovoltaikanlage
- Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz
- Analyse der langfristigen Kapitalanlage in Bundesanleihen
- Steuerliche Aspekte der Anlageformen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Projektierung der Photovoltaikanlage
- Kapitel 3: Einnahmen und Ausgaben für die Photovoltaikanlage
- Kapitel 4: Analyse der langfristigen Kapitalanlage
- Kapitel 5: Wirtschaftlicher Vergleich beider Anlageformen
Die Einleitung stellt das Unternehmen und die Projektarbeit kurz vor. Sie beschreibt die Unternehmensziele und die Motivation für die Untersuchung der beiden Anlageformen.
Dieses Kapitel befasst sich mit der Planung der Photovoltaikanlage, einschließlich der Analyse des Strahlungsangebots, der Neigung und Ausrichtung der Anlage, sowie der Auswahl der PV-Komponenten.
Kapitel 3 analysiert die Einnahmen und Ausgaben, die mit der Photovoltaikanlage verbunden sind. Dazu gehören die Kosten für die Anschaffung, den Betrieb und die Wartung, sowie die Einnahmen durch die Stromerzeugung und die Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz.
Dieses Kapitel analysiert die langfristige Kapitalanlage in Bundesanleihen. Es beschreibt die Entscheidung für die Anlagenart, die Auswahl der Bundesanleihe, die Auslagen und Gebühren, den Kapitalertrag zum Kupontermin und die vorzeitige Auszahlung des Nennwertes.
Kapitel 5 führt einen wirtschaftlichen Vergleich der beiden Anlageformen durch. Es berücksichtigt die Besteuerung der Erträge und die Anwendung der Regula-Falsi-Methode zur Ermittlung der Wirtschaftlichkeit.
Schlüsselwörter
Die Projektarbeit beschäftigt sich mit den Themen Photovoltaikanlage, Bundesanleihe, Investitionsentscheidung, Wirtschaftlichkeit, Einnahmen und Ausgaben, Förderung, Erneuerbare-Energien-Gesetz, Besteuerung, Kapitalertrag, Regula-Falsi-Methode.
Häufig gestellte Fragen
Lohnt sich eine Photovoltaikanlage im Vergleich zu Bundesanleihen?
Die Arbeit führt einen detaillierten Wirtschaftlichkeitsvergleich durch, der Faktoren wie Einspeisevergütung, Betriebskosten und steuerliche Aspekte berücksichtigt.
Was beeinflusst die Energiegewinnung einer PV-Anlage?
Zentrale Einflussgrößen sind das regionale Strahlungsangebot, die Neigung der Module sowie die Ausrichtung zum Sonnenstand.
Welche Rolle spielt das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)?
Das EEG regelt die Förderung und die Einnahmen durch die Energieerzeugung, was eine wesentliche Grundlage für die Rentabilitätsrechnung darstellt.
Was ist die Regula-Falsi-Methode?
Es ist ein mathematisches Verfahren (Linearinterpolation), das in dieser Arbeit zur Berechnung der internen Verzinsung der Investition genutzt wird.
Welche Vorteile bietet eine Anlage in Bundeswertpapiere?
Bundesanleihen gelten als sehr sicher, bieten feste Zinserträge (Kupons) und verursachen im Vergleich zu PV-Anlagen kaum laufende Betriebskosten.
- Citar trabajo
- Stefan Biegerl (Autor), 2011, Investitionsentscheidung: Photovoltaik-Anlage kontra langfristige Geldanlage, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178655