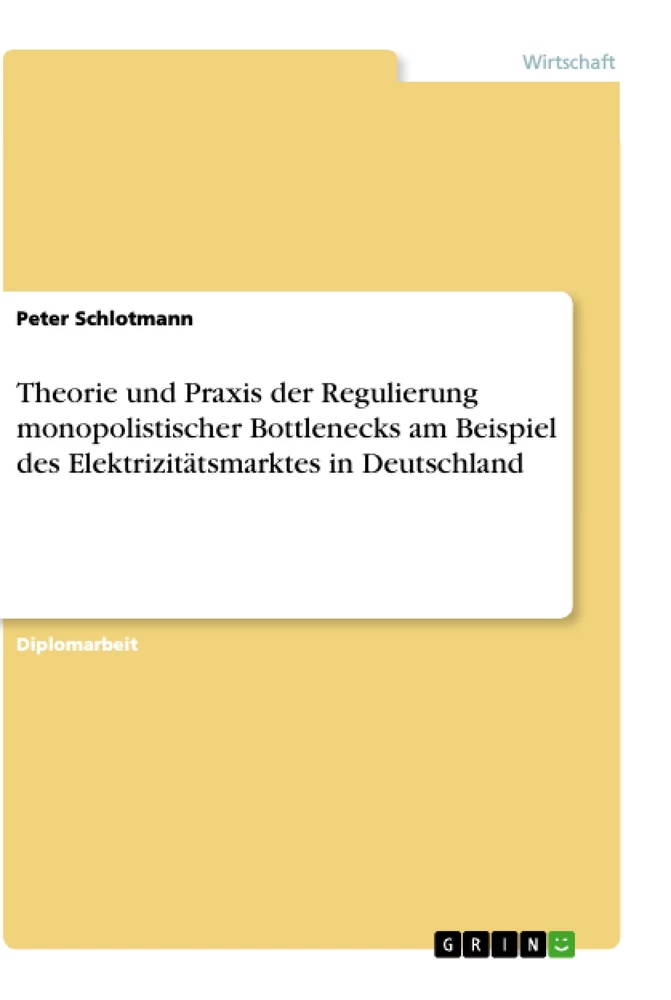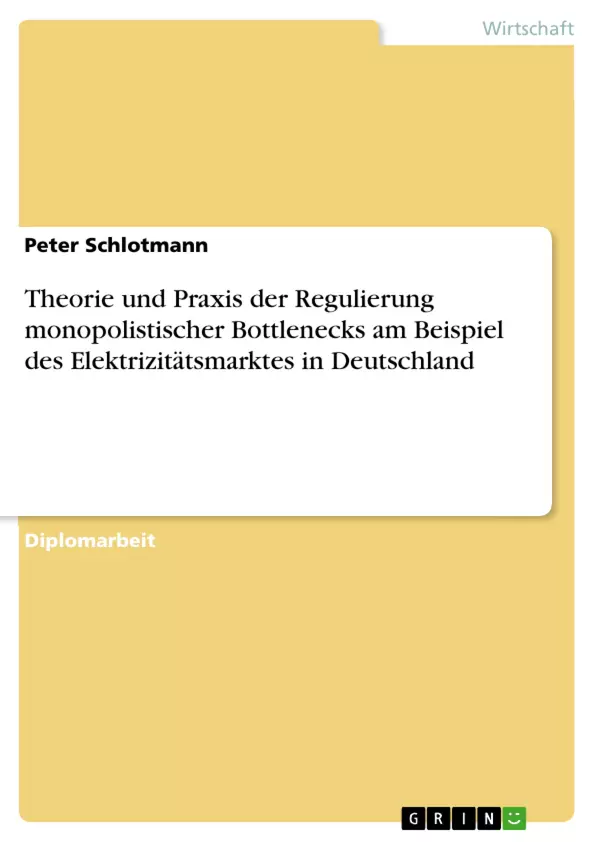Traditionell galt der Stromsektor als ein so genanntes natürliches Monopol. Die günstigste Organisationsform war somit die Versorgung staatlich geschützter Gebietsmonopole durch jeweils ein über alle Wertschöpfungsstufen vertikal integriertes Unternehmen. Die Bereiche Erzeugung und Versorgung werden mittlerweile als wettbewerbsfähig angesehen. In den für den Transport des Stroms notwendigen Netzen ist jedoch kein Wettbewerb möglich. Sie stellen einen monopolistischen Engpass (Bottleneck) dar. Theoretisch können Netzbetreiber ihre Marktmacht über die Netzentgelte in die wettbewerblichen Bereiche übertragen und dort Kampfpreise realisieren, die die Konkurrenz ausschalten (Predatory Pricing).
Die in Deutschland nach der Liberalisierung des Marktes umgesetzten Regulierungsmethoden des verhandelten Netzzugangs, der Kosten- und Anreizregulierung werden zunächst theoretisch dargestellt und verglichen. Es folgen eine ökonomische Analyse der Entwicklungen am deutschen Elektrizitätsmarkt unter dem jeweiligen Regulierungsregime sowie eine Analyse der geplanten Form der Anreizregulierung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Behandlung natürlicher Monopole in Theorie und Praxis
- Natürliche Monopole in der Theorie
- Definition und Effizienz
- Traditionelle und neue Theorie
- Natürliche Monopole in der Praxis
- Verhandelter Netzzugang
- Kostenregulierung: Rate of Return-Regulierung
- Anreizregulierung: Revenue Cap
- Exkurs Benchmarking
- Verhandelter und regulierter Netzzugang im Vergleich
- Natürliche Monopole in der Theorie
- Bottleneck-Regulierung am Beispiel des deutschen Elektrizitätsmarktes
- Erste Phase: verhandelter Netzzugang
- Rechtliche Vorgaben: die erste EnWG — Novelle
- Die Verbändevereinbarungen
- Ökonomische Analyse des verhandelten Netzzugangs
- Marktstruktur und Wettbewerbsintensität
- Großhandel
- Netzentgelte
- Exkurs Netzentgeltvergleiche
- Versorgungsqualität
- Investitionen
- Staatslasten
- Zusammenfassung
- Zweite Phase: regulierter Netzzugang
- Rechtliche Vorgaben: die zweite EnWG-Novelle
- Unbundling
- Kostenregulierung
- Ökonomische Analyse: aktueller Stand
- Zusammenfassung
- Anreizregulierung
- Die Revenue Cap-Formel
- Kritik der Revenue Cap-Formel
- Fazit
- Zusammenfassung
- Limitations
- Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Theorie und Praxis der Regulierung monopolistischer Bottlenecks am Beispiel des Elektrizitätsmarktes in Deutschland. Die Arbeit analysiert die Auswirkungen der Liberalisierung des Strommarktes auf die Marktstruktur, die Wettbewerbsintensität, die Preisentwicklung, die Netzentgelte, die Versorgungsqualität und die Investitionen. Dabei wird die Rolle der staatlichen Regulierungsbehörde, der Bundesnetzagentur (BNA), und die verschiedenen Regulierungsmethoden, wie Kostenregulierung und Anreizregulierung, untersucht.
- Die Auswirkungen der Liberalisierung auf die Marktstruktur und die Wettbewerbsintensität im Stromsektor
- Die Preisbildung im Großhandel und die Rolle von Marktmacht und fundamentalen Faktoren
- Die Entwicklung der Netzentgelte und die Herausforderungen der Regulierung
- Die Bedeutung der Versorgungsqualität und die Auswirkungen der Regulierung auf die Investitionsentscheidungen
- Die Rolle der Staatslasten und deren Einfluss auf die Endpreise
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik der Regulierung monopolistischer Bottlenecks am Beispiel des deutschen Elektrizitätsmarktes dar. Sie beleuchtet die Diskussion um die Marktmacht großer Energiekonzerne und die Rolle der Anreizregulierung.
- Behandlung natürlicher Monopole in Theorie und Praxis: Dieses Kapitel behandelt die theoretischen Grundlagen des natürlichen Monopols und die verschiedenen Ansätze zur Regulierung. Es werden die traditionelle Theorie, die von einem Marktversagen ausgeht, und die neue Theorie, die die Problematik unvollkommener Regulierung berücksichtigt, vorgestellt. Außerdem werden verschiedene Regulierungsmethoden, wie Kostenregulierung und Anreizregulierung, im Detail erläutert.
- Bottleneck-Regulierung am Beispiel des deutschen Elektrizitätsmarktes: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung des deutschen Elektrizitätsmarktes seit der Liberalisierung. Es werden die Auswirkungen des verhandelten Netzzugangs, der in der ersten Phase der Liberalisierung Anwendung fand, und die Einführung des regulierten Netzzugangs unter der Leitung der BNA untersucht. Die Kapitel beleuchten die Preisentwicklung, die Marktstruktur, die Netzentgelte, die Versorgungsqualität und die Investitionen im Detail.
- Fazit: Das Fazit fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und beleuchtet die Herausforderungen und Perspektiven der Regulierung monopolistischer Bottlenecks im Elektrizitätssektor. Es werden die Grenzen der Analyse und der Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Strommarkt gegeben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Förderschwerpunkt Lernen, den inklusiven und exklusiven Unterricht sowie die schulische Inklusion, insbesondere in Nordrhein-Westfalen. Empirische Forschungsergebnisse werden präsentiert, um die Rahmenbedingungen und Herausforderungen der inklusiven Beschulung von Kindern mit dem Förderschwerpunkt Lernen zu beleuchten. Ein besonderer Fokus liegt auf der Bielefelder Längsschnittstudie (BiLieF-Projekt), die die Leistungsentwicklung und das Wohlbefinden von Schülern in inklusiven und exklusiven Förderarrangements vergleicht. Weitere Themen sind Förderempfehlungen, die Herausforderungen der Inklusion sowie Implikationen für die Schulentwicklung und Inklusionspraxis.
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt das Stromnetz als natürliches Monopol?
Weil der Bau paralleler Netze wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Die Netze stellen daher einen monopolistischen Engpass (Bottleneck) dar, der reguliert werden muss.
Was ist das Ziel der Anreizregulierung im Strommarkt?
Sie soll Netzbetreiber motivieren, ihre Kosten zu senken und effizienter zu arbeiten, indem sie einen Teil der eingesparten Kosten als Gewinn behalten dürfen (Revenue Cap).
Welche Rolle spielt die Bundesnetzagentur (BNA)?
Die BNA ist die staatliche Regulierungsbehörde, die den Netzzugang überwacht, die Netzentgelte genehmigt und den Wettbewerb in den Bereichen Erzeugung und Vertrieb sicherstellt.
Was versteht man unter "Predatory Pricing"?
Es beschreibt die Gefahr, dass Netzbetreiber ihre Marktmacht nutzen, um Kampfpreise in wettbewerblichen Bereichen zu realisieren und so die Konkurrenz auszuschalten.
Wie hat sich der deutsche Strommarkt seit der Liberalisierung entwickelt?
Die Arbeit analysiert zwei Phasen: den anfangs verhandelten Netzzugang und den späteren regulierten Netzzugang, wobei Auswirkungen auf Preise, Wettbewerb und Investitionen untersucht werden.
Welchen Einfluss hat die Regulierung auf die Versorgungsqualität?
Es besteht die Herausforderung, dass Kosteneinsparungen durch Regulierung nicht zu Lasten der Instandhaltung und damit der Sicherheit der Stromversorgung gehen dürfen.
- Erste Phase: verhandelter Netzzugang
- Quote paper
- Peter Schlotmann (Author), 2007, Theorie und Praxis der Regulierung monopolistischer Bottlenecks am Beispiel des Elektrizitätsmarktes in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178738