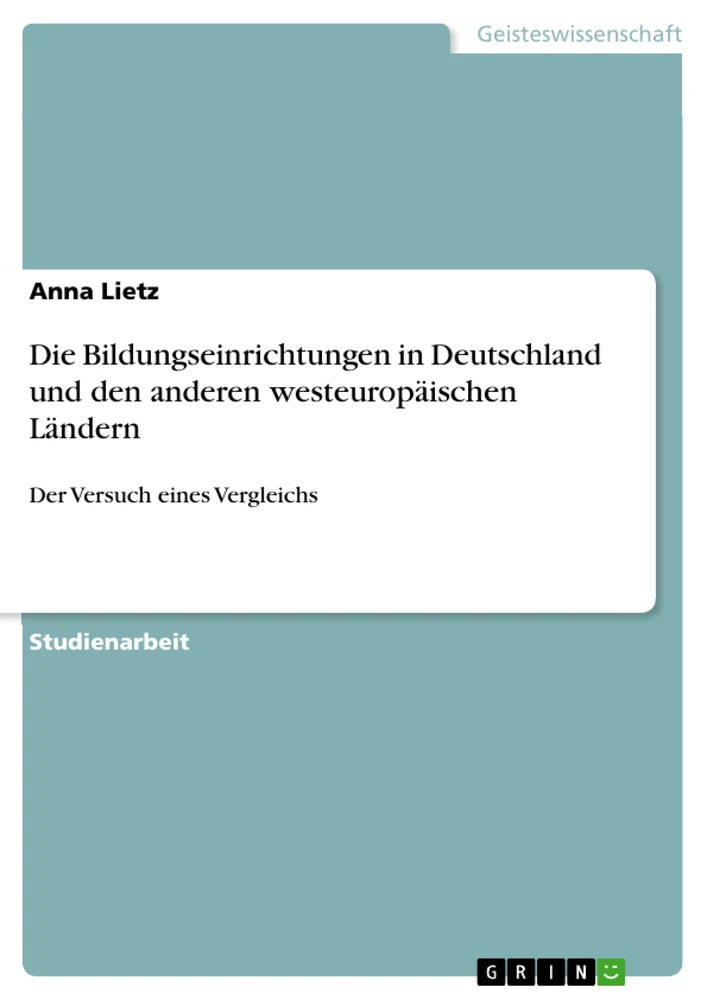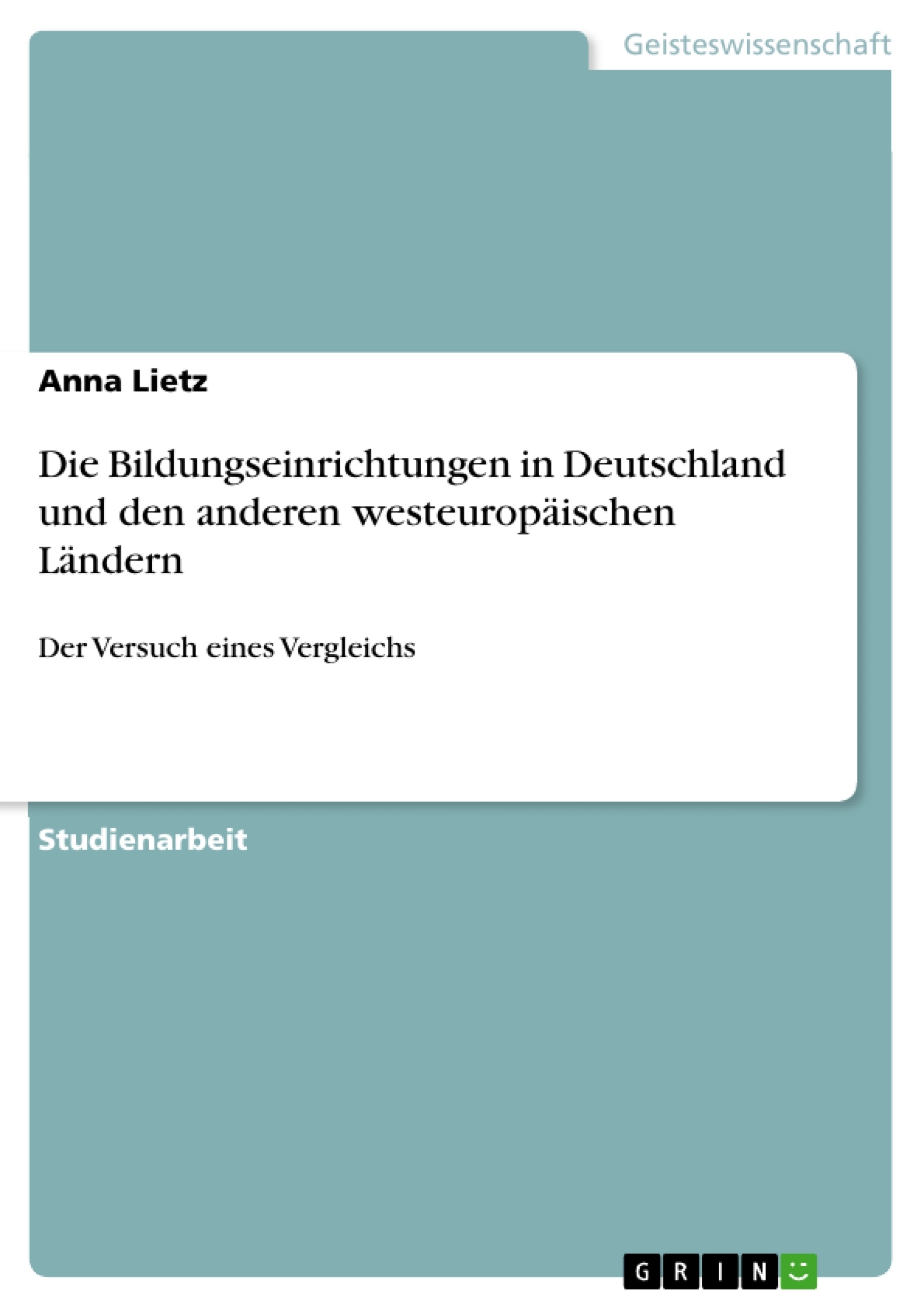„Die meisten Kinder werden mit drei oder vier Jahren in eine Stätte der Kinderbetreuung aufgenommen und viele von ihnen bleiben dann mehr oder weniger kontinuierlich für eine reichlich lange Jugendzeit bis zum Ende des dritten Lebensjahrzehnts in einer der vielfältigen Einrichtungen des Bildungssystems“ (Müller 1997: 177).
In dieser Arbeit werde ich mich mit dem Aufbau der Bildungseinrichtungen in Deutschland beschäftigen, die Bildungseinrichtungen in den westeuropäischen Ländern aufzeigen und anschließend miteinander vergleichen.
Zuerst werde ich hierbei die geschichtliche Entwicklung der schulischen Bildungseinrichtungen in Deutschland darlegen, die mit anderen Teilbereichen der Gesellschaft stark verknüpft ist und nicht isoliert gesehen werden darf. Vor allem die politischen Umbrüche der Jahre 1928, 1933, 1945 und 1990 haben im 20. Jahrhundert die Entwicklung der schulischen Bildungseinrichtungen in Deutschland geprägt. Danach werden die verschiedenen Bildungseinrichtungen des Primärsektors, Sekundärsektors und Tertiärsektors in Deutschland in ihrer jetzigen Situation aufgezeigt. Zu den Bildungseinrichtungen gehört auch das duale System der beruflichen Ausbildung, da es aber, wegen seines Bezugs zum Bildungswesen einerseits und zum Berufswesen andererseits, eine gesonderte Stellung aufweist, ist ihm ein relativ großer Teil dieser Arbeit gewidmet. Im anschließenden Teil dieser Arbeit wird die Struktur der verschiedenen Bildungseinrichtungen in den westeuropäischen Ländern beschrieben. Schließlich bearbeite ich im vierten Abschnitt meiner Arbeit den Vergleich der deutschen Bildungseinrichtungen mit denen der westeuropäischen Länder. Hierbei werde ich die quantitative Bildungsentwicklung in Westeuropa ansprechen. Zum Schluss werde ich kurz auf die PISA-Studie eingehen und dabei Finnland als Paradebeispiel anführen, da die Finnen die europäischen Sieger bei der im Jahr 2000 durchgeführten PISA-Studie gewesen sind.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die schulischen Bildungseinrichtungen in Deutschland
- II.1 Die geschichtliche Entwicklung
- II.2 Das deutsche Bildungssystem
- II.2 a) Primärbereich und Sekundärbereich
- II.2 b) Tertiärbereich
- II.3 Die berufliche Bildung in Deutschland
- II.3 a) Die geschichtliche Entwicklung
- II.3 b) Die beruflichen Bildungseinrichtungen
- III. Die unterschiedlichen Bildungseinrichtungen in Westeuropa
- III.1 Primärbereich und Sekundärbereich
- III.2 Berufliche Bildung
- III.3 Tertiärbereich
- IV. Die westeuropäischen Bildungseinrichtungen im Vergleich
- IV.1 Die quantitative Bildungsentwicklung in Westeuropa
- IV. 2 Die Bildungseinrichtungen in Finnland
- V. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Aufbau der Bildungseinrichtungen in Deutschland und stellt diese im Vergleich zu den Bildungseinrichtungen in den westeuropäischen Ländern dar. Dabei werden die geschichtliche Entwicklung der schulischen Bildungseinrichtungen in Deutschland sowie deren Struktur in den Bereichen Primär-, Sekundär- und Tertiärbereich beleuchtet. Außerdem wird auf das duale System der beruflichen Bildung in Deutschland eingegangen. Anschließend erfolgt eine Beschreibung der Bildungseinrichtungen in den westeuropäischen Ländern, gefolgt von einem Vergleich zwischen den deutschen und westeuropäischen Bildungseinrichtungen.
- Die historische Entwicklung der Bildungseinrichtungen in Deutschland
- Die Struktur des deutschen Bildungssystems im Vergleich zu den westeuropäischen Ländern
- Das duale System der beruflichen Bildung in Deutschland
- Quantitative Bildungsentwicklung in Westeuropa
- Das Beispiel Finnlands als europäischer Vorreiter im Bildungsbereich
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas "Bildungseinrichtungen in Deutschland und Westeuropa" heraus und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit. Kapitel II behandelt die schulischen Bildungseinrichtungen in Deutschland, wobei zunächst die geschichtliche Entwicklung beleuchtet wird. Anschließend werden die einzelnen Bereiche des deutschen Bildungssystems (Primär-, Sekundär- und Tertiärbereich) näher erläutert. Kapitel III widmet sich den Bildungseinrichtungen in den westeuropäischen Ländern, wobei die Bereiche Primär-, Sekundär- und Tertiärbereich im Fokus stehen. Kapitel IV stellt die westeuropäischen Bildungseinrichtungen im Vergleich zu den deutschen Bildungseinrichtungen dar. Dabei wird auch die quantitative Entwicklung der Bildung in Westeuropa betrachtet. Die Arbeit wird mit einem Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Bildungssystems abgeschlossen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit thematisiert die Bildungseinrichtungen in Deutschland und Westeuropa, wobei die Schwerpunkte auf der historischen Entwicklung, den verschiedenen Bildungsbereichen, dem Vergleich zwischen den Ländern sowie der quantitativen Bildungsentwicklung liegen. Weitere wichtige Begriffe sind das duale System der beruflichen Bildung, das deutsche föderale Bildungssystem und die PISA-Studie.
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das deutsche Bildungssystem strukturiert?
Es gliedert sich in den Primärbereich (Grundschule), den Sekundärbereich (weiterführende Schulen) und den Tertiärbereich (Hochschulen und Universitäten).
Was ist das Besondere am dualen System in Deutschland?
Das duale System kombiniert die praktische Ausbildung in einem Betrieb mit der theoretischen Ausbildung in einer Berufsschule, was international als Vorbild gilt.
Warum wird Finnland oft als Vorbild im Bildungsbereich genannt?
Finnland erzielte in der PISA-Studie 2000 Spitzenwerte und zeichnet sich durch ein sehr inklusives und leistungsstarkes Schulsystem aus.
Welche historischen Umbrüche prägten die deutsche Schullandschaft?
Vor allem die Jahre 1933 (NS-Zeit), 1945 (Nachkriegszeit) und 1990 (Wiedervereinigung) führten zu massiven strukturellen Veränderungen im Bildungswesen.
Gibt es Unterschiede in der beruflichen Bildung innerhalb Westeuropas?
Ja, während Deutschland auf das duale System setzt, ist die berufliche Bildung in anderen westeuropäischen Ländern oft stärker rein schulisch organisiert.
- Citar trabajo
- M.A. Anna Lietz (Autor), 2003, Die Bildungseinrichtungen in Deutschland und den anderen westeuropäischen Ländern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178749