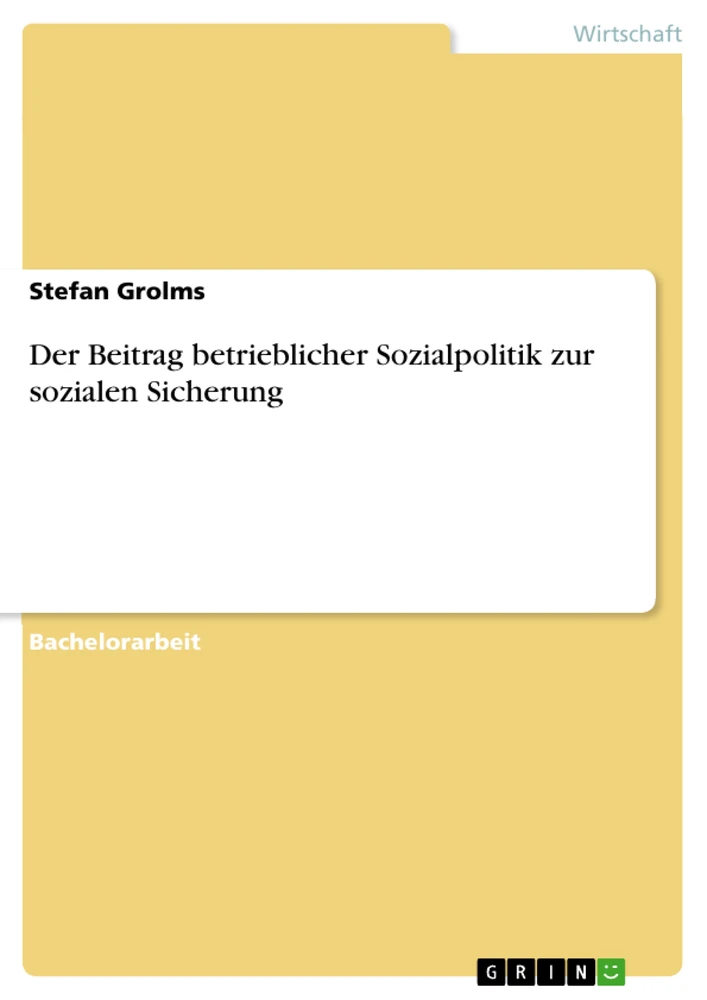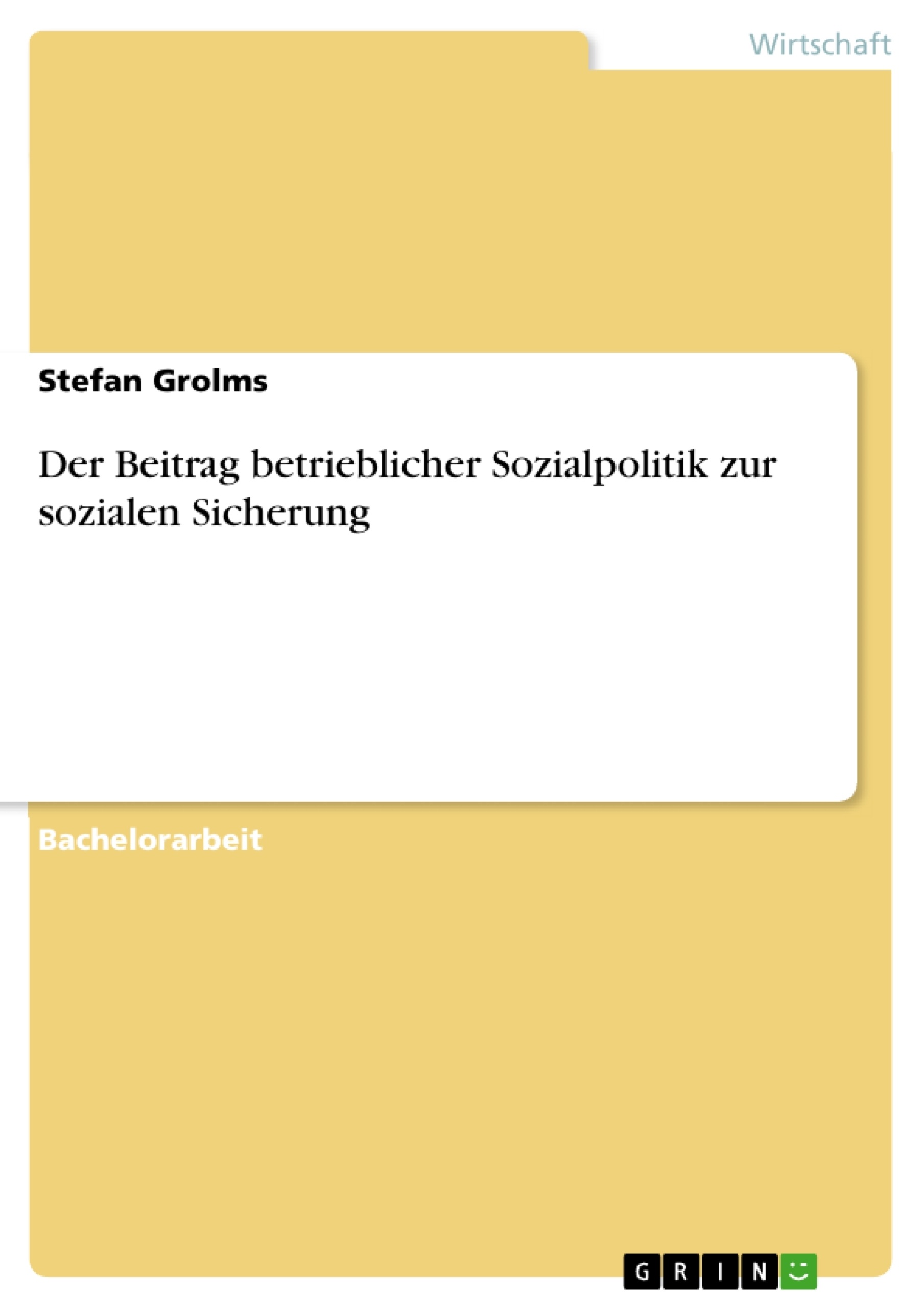Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert. Der einführende Abschnitt liefert eine Beschreibung
der Ausgangslage, die Darstellung der Forschungsfrage und Näheres zur Methodik
und zum Aufbau der Arbeit.
Im zweiten Kapitel erfolgt die Begriffserklärung von „Betrieblicher Sozialpolitik“ und
„Betrieblichen Sozialleistungen“. Weiters wird die Existenz betrieblicher Sozialpolitik
begründet sowie ein historischer Rückblick dieser gegeben. Außerdem findet eine
Typologisierung betrieblicher Sozialpolitik statt. Am Ende des Kapitels werden die
unterschiedlichen Ausprägungen bzw. Formen betrieblicher Sozialpolitik dargestellt
und deren Ausmaß abgeschätzt.
Das dritte Kapitel fokussiert auf die betriebliche Pensionsvorsorge. Zunächst wird dieser
Begriff kurz eingeführt und die Motive und Aufgaben aus verschiedenen Perspektiven
dargestellt, sowie auf mögliche Probleme hingewiesen. Nach Erklärung des historischen
Zusammenhangs werden die gesetzlichen Regelungen und Durchführungsformen
aufgezeigt.
Im vierten Kapitel wird der konkrete Beitrag der betrieblichen Pensionsvorsorge zur
Alterssicherung herausgearbeitet und versucht die Forschungsfrage zu beantworten.
Nach Vorstellung des 3‐Säulen‐Modells erfolgt die Bewertung des öffentlichen und
betrieblichen Alterssicherungssystems anhand von eigens formulierten Kriterien.
Mithilfe des vorletzten Abschnitts wird versucht Aufschluß über die zukünftige
Entwicklung der betrieblichen Altersvorsorge zu geben.
In einer Conclusio am Ende der Arbeit wird das Wichtigste noch einmal zusammengefasst
und die Schwerpunkte herausgearbeitet. Des Weiteren findet eine kritische Reflexion
der Literatur statt.
Inhaltsverzeichnis
- BETRIEBLICHE SOZIALPOLITIK ALS ELEMENT NACHHALTIGER SOZIALER SICHERUNGSSYSTEME
- EINLEITUNG
- PROBLEMATIK
- FORSCHUNGSFRAGE ZIEL UND METHODIK DER ARBEIT
- AUFBAU DER ARBEIT
- BETRIEBLICHE SOZIALPOLITIK ALS ELEMENT NACHHALTIGER SOZIALER SICHERUNGSSYSTEME
- BEGRIFFLICHE GRUNDLAGEN
- Betriebliche Sozialpolitik
- Betriebliche Sozialleistungen
- ENTWICKLUNG
- Geschichtliche Entwicklung
- Zusammenhang zwischen staatlicher und betrieblicher Sozialpolitik
- Die Rechtfertigung betrieblicher Sozialpolitik
- FORMEN UND TYPOLOGISIERUNG BETRIEBLICHER SOZIALPOLITIK
- AUSMAẞ BETRIEBLICHER SOZIALPOLITIK INNERHALB DER EU
- DIE REICHWEITE BETRIEBLICHER SOZIALLEISTUNGEN AM BEISPIEL DER PENSIONSVORSORGE
- DEFINITION DES BEGRIFFS BETRIEBLICHE PENSIONSVORSORGE
- BEGRÜNDUNG EINER BETRIEBLICHEN PENSIONSVORSORGE
- Motive und Aufgaben der betrieblichen Pensionsvorsorge
- Aus der Sicht der Arbeitgeber
- Aus der Sicht der Arbeitnehmer
- Aus der Sicht der Gewerkschaften
- DIE HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER BETRIEBLICHEN PENSIONSVORSORGE
- DIE GESETZLICHE REGELUNG DER BETRIEBLICHEN ALTERSVORSORGE IN ÖSTERREICH
- DURCHFÜHRUNGSFORMEN DER BETRIEBLICHEN ALTERSVORSORGE
- Direktzusage (Pensionszusage)
- Die Direktversicherung
- Pensionskassen
- Die Unterstützungskasse
- DER BEITRAG DER BETRIEBLICHEN PENSIONSVORSORGE ZUR ALTERSSICHERUNG
- SOZIALE ABSICHERUNG UNTER DEM GESICHTSPUNKT DES DREI-SÄULEN MODELLS
- Das Drei-Säulen-Modell in Österreich
- Das Drei-Säulen-Modell im internationalen Vergleich
- Der Beitrag von Betriebspensionen im Vergleich zu öffentlichen Pensionen
- DIE ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG DER BETRIEBLICHEN ALTERSVERSORGUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit analysiert die Bedeutung der betrieblichen Sozialpolitik als Element nachhaltiger sozialer Sicherungssysteme. Im Fokus steht dabei die Frage, inwieweit die betriebliche Sozialpolitik zur Sicherung des Lebensstandards im Alter beitragen kann. Dabei werden die verschiedenen Formen und Ausprägungen der betrieblichen Sozialpolitik beleuchtet, insbesondere die betriebliche Pensionsvorsorge.
- Entwicklung und Bedeutung der betrieblichen Sozialpolitik im Kontext der sozialen Sicherung
- Analyse der verschiedenen Formen und Typen der betrieblichen Sozialpolitik
- Bewertung des Beitrags der betrieblichen Pensionsvorsorge zur Altersvorsorge im Drei-Säulen-Modell
- Herausforderungen und Zukunftsperspektiven der betrieblichen Sozialpolitik im Kontext der demografischen Entwicklung
- Relevanz der betrieblichen Sozialpolitik für die Nachhaltigkeit von sozialen Sicherungssystemen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Betriebliche Sozialpolitik als Element nachhaltiger sozialer Sicherungssysteme: Einleitung, Problembeschreibung, Forschungsfrage, Zielsetzung, Methodik und Aufbau der Arbeit.
- Kapitel 2: Betriebliche Sozialpolitik als Element nachhaltiger sozialer Sicherungssysteme: Definition und Abgrenzung der Begriffe "betriebliche Sozialpolitik" und "betriebliche Sozialleistungen", geschichtliche Entwicklung, Zusammenhang zwischen staatlicher und betrieblicher Sozialpolitik, Rechtfertigung betrieblicher Sozialpolitik, Formen und Typologisierung betrieblicher Sozialpolitik, Ausmaß betrieblicher Sozialpolitik innerhalb der EU.
- Kapitel 3: Die Reichweite betrieblicher Sozialleistungen am Beispiel der Pensionsvorsorge: Definition der betrieblichen Pensionsvorsorge, Begründungen für die Existenz betrieblicher Pensionsvorsorge aus Sicht der Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Gewerkschaften, historische Entwicklung der betrieblichen Pensionsvorsorge, gesetzliche Regelung der betrieblichen Altersvorsorge in Österreich, Durchführungsformen der betrieblichen Altersvorsorge.
- Kapitel 4: Der Beitrag der betrieblichen Pensionsvorsorge zur Alterssicherung: Das Drei-Säulen-Modell in Österreich und im internationalen Vergleich, der Beitrag von Betriebspensionen im Vergleich zu öffentlichen Pensionen, die zukünftige Entwicklung der betrieblichen Altersvorsorge.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der betrieblichen Sozialpolitik, insbesondere mit der betrieblichen Pensionsvorsorge. Im Mittelpunkt stehen die Entwicklung, die Formen und die Bedeutung der betrieblichen Sozialpolitik im Kontext der sozialen Sicherung, die Herausforderungen und Zukunftsperspektiven in Bezug auf die demografische Entwicklung und die Relevanz für die Nachhaltigkeit von sozialen Sicherungssystemen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist betriebliche Sozialpolitik?
Betriebliche Sozialpolitik umfasst alle freiwilligen oder gesetzlich geregelten sozialen Leistungen eines Unternehmens für seine Mitarbeiter, die über das reine Arbeitsentgelt hinausgehen.
Welche Rolle spielt das Drei-Säulen-Modell der Altersvorsorge?
Es teilt die Altersvorsorge in die staatliche Pension (1. Säule), die betriebliche Vorsorge (2. Säule) und die private Vorsorge (3. Säule) auf.
Was sind die Durchführungsformen der betrieblichen Altersvorsorge?
In Österreich und Deutschland gibt es Formen wie die Direktzusage, die Direktversicherung, Pensionskassen und Unterstützungskassen.
Warum bieten Arbeitgeber betriebliche Sozialleistungen an?
Motive sind die Steigerung der Mitarbeiterbindung, die soziale Verantwortung, die Verbesserung des Firmenimages und steuerliche Vorteile.
Wie sieht die Zukunft der betrieblichen Altersvorsorge aus?
Aufgrund der demografischen Entwicklung und sinkender staatlicher Pensionen gewinnt die betriebliche Vorsorge als notwendige Ergänzung zur Sicherung des Lebensstandards massiv an Bedeutung.
- Quote paper
- Stefan Grolms (Author), 2009, Der Beitrag betrieblicher Sozialpolitik zur sozialen Sicherung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178767