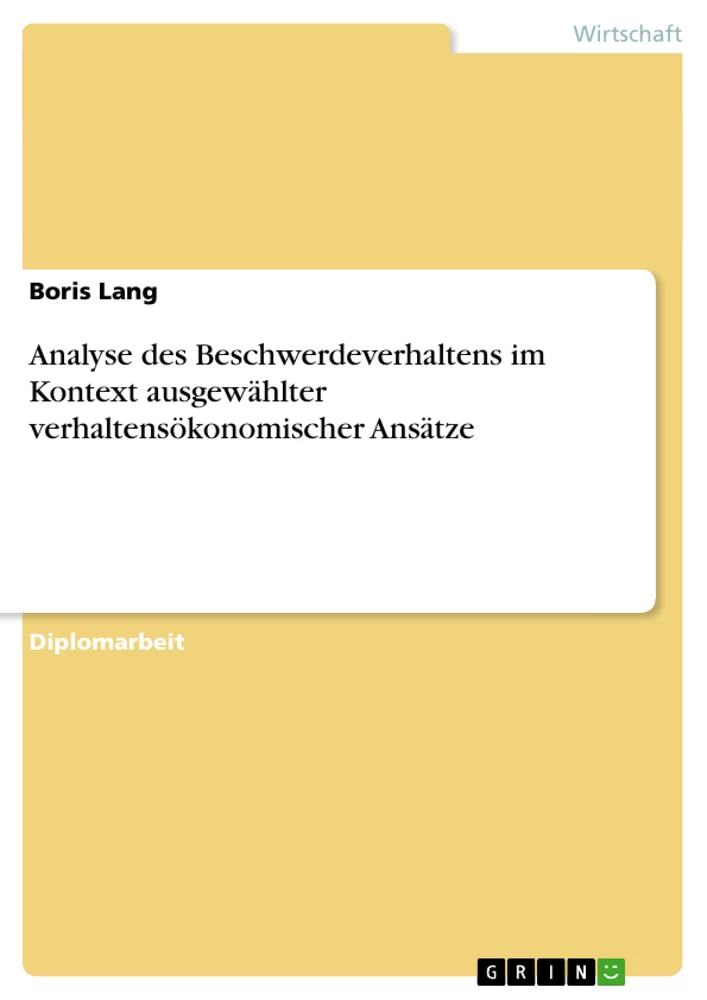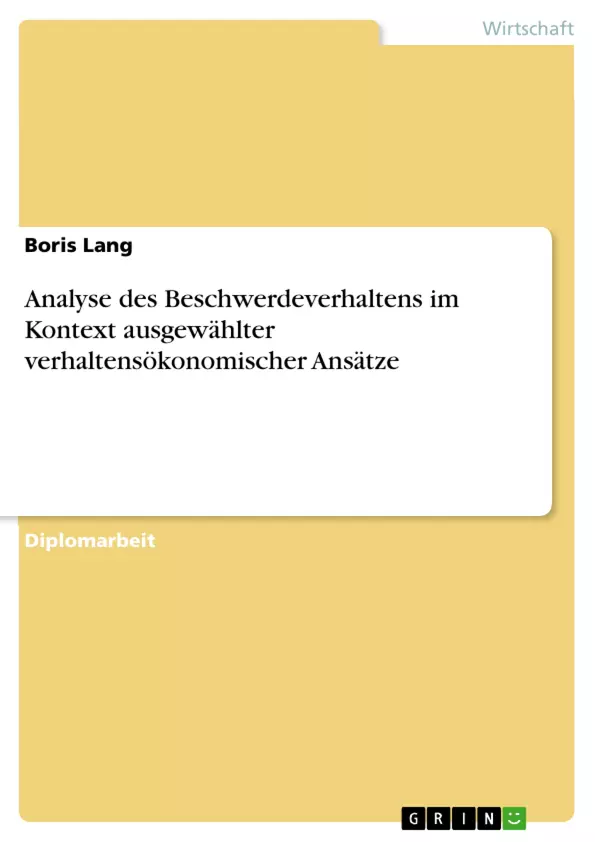Mit der Erforschung empirisch feststellbarer Verhaltensanomalien wurde das ökonomische Verhaltensmodell des Homo Oeconomicus teilweise widerlegt. Der Mensch handelt nicht rational, scheitert an der Nutzenmaximierung, verfügt nicht über alle relevanten Informationen und besitzt weder die Zeit noch die kognitiven Fähigkeiten alle zur Verfügung stehenden Informationen auszuwerten. Unter den menschlichen Verhaltensanomalien versteht man systematische Abweichungen des Entscheidungsverhaltens von den Standardannahmen entscheidungslogischer Ansätze und klassischer ökonomischer Modelle. Die Verhaltensanomalien stellen somit die Grundannahmen der Ökonomie in Frage und wirken sich stark auf das alltägliche menschliche Verhalten aus. Im Rahmen dieser Arbeit soll untersucht werden, welche Konsequenzen der Verhaltensanomalien, für das Beschwerdeverhalten von unzufriedenen Kunden abzuleiten sind. Dazu wird zunächst auf die Entwicklung der Verhaltensökonomie eingegangen, worauf die Theorie der begrenzten Rationalität, die Prospect-Theorie sowie weitere entscheidungstheoretische Ansätze dargestellt werden. Im Anschluss daran erfolgt ein kurzer Überblick über das Beschwerdemanagement sowie das Beschwerdeverhalten, woraus schließlich elf Kriterien abgeleitet werden, welche das Beschwerdeverhalten beeinflussen. Im Anschluss wird mittels einer Tabelle zunächst ein Überblick über relevante Veröffentlichungen zu ausgewählten Verhaltensanomalien gegeben, worauf eine Zuordnung der zuvor festgelegten Kriterien zu den Verhaltensanomalien erfolgt.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Motivation
- Verhaltensökonomische Grundlagen
- Der Mensch als rationales Wesen
- Die Theorie der begrenzten Rationalität
- Ausgewählte entscheidungstheoretische Ansätze
- Die Prospect-Theorie
- Art und Umfang des kognitiven Aufwandes in Entscheidungssituationen
- Eine Einführung in das Beschwerdemanagement
- Der Faktor Zufriedenheit im Kontext des Beschwerdemanagements
- Das Beschwerdeverhalten unzufriedener Kunden
- Ausgewählte Kriterien einer erfolgreichen Beschwerdebearbeitung
- Verhaltensanomalien
- Der Darstellungseffekt (Framing Effect)
- Die Verlustaversion (Loss Aversion)
- Der Besitzeffekt
- Das Herdenverhalten (Herd Behavior)
- Die Disappointment- und Regret-Theorie
- Das Beschwerdeverhalten im Kontext der Verhaltensanomalien
- Relevante Faktoren des Beschwerdeverhaltens
- Übersicht über ausgewählte menschliche Verhaltensanomalien
- Zusammenfassung und Ausblick
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit analysiert das Beschwerdeverhalten von Kunden im Kontext verhaltensökonomischer Ansätze. Sie untersucht, wie die empirisch belegte Abweichung des menschlichen Verhaltens vom rationalen Modell des Homo Oeconomicus das Beschwerdeverhalten beeinflusst. Die Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung der Verhaltensökonomie, insbesondere die Theorie der begrenzten Rationalität und die Prospect-Theorie. Sie stellt wichtige Kriterien für eine erfolgreiche Beschwerdebearbeitung vor und untersucht den Einfluss ausgewählter Verhaltensanomalien auf das Beschwerdeverhalten.
- Die Entwicklung der Verhaltensökonomie und ihre Kritik am Homo Oeconomicus
- Die Theorie der begrenzten Rationalität und die Prospect-Theorie
- Das Beschwerdemanagement und die Faktoren, die das Beschwerdeverhalten beeinflussen
- Der Einfluss von Verhaltensanomalien auf das Beschwerdeverhalten
- Konsequenzen für Unternehmen und zukünftige Forschungsziele
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2. beleuchtet die Entwicklung der Verhaltensökonomie und stellt die Theorie der begrenzten Rationalität sowie die Prospect-Theorie vor. Es wird gezeigt, dass Menschen in Entscheidungssituationen nicht immer rational handeln, sondern durch ihre kognitiven Fähigkeiten und Emotionen eingeschränkt sind. Die Prospect-Theorie von Kahneman und Tversky bietet eine Erklärung für diese Verhaltensanomalien, indem sie die Bedeutung von Referenzpunkten, Verlusten und Wahrscheinlichkeitseffekten in Entscheidungsfindungsprozessen hervorhebt.
Kapitel 3. bietet eine Einführung in das Beschwerdemanagement und das Beschwerdeverhalten von Kunden. Es werden verschiedene Faktoren identifiziert, die das Beschwerdeverhalten beeinflussen, wie z.B. der Kosten-Nutzen-Vergleich, die Angst vor negativen Emotionen und die Erwartungskorrektur. Zudem werden wichtige Kriterien für eine erfolgreiche Beschwerdebearbeitung vorgestellt, wie z.B. die Erreichbarkeit, die Freundlichkeit der Mitarbeiter, die Entschuldigung, die Bearbeitungszeit und das Feedback.
Kapitel 4. analysiert fünf ausgewählte Verhaltensanomalien und ihre Relevanz für das Beschwerdeverhalten. Es werden der Darstellungseffekt (Framing Effect), die Verlustaversion (Loss Aversion), der Besitzeffekt, das Herdenverhalten (Herd Behavior) sowie die Disappointment- und Regret-Theorie vorgestellt. Die Analyse zeigt, dass diese Anomalien das Beschwerdeverhalten von Kunden beeinflussen, indem sie die Wahrnehmung von Verlusten, die Rolle von Emotionen und die Bedeutung von Referenzpunkten in Entscheidungssituationen hervorheben.
Kapitel 5. untersucht die Relevanz von Verhaltensanomalien für das Beschwerdeverhalten genauer. Es werden verschiedene Faktoren, die das Beschwerdeverhalten beeinflussen, den ausgewählten Verhaltensanomalien zugeordnet. Die Analyse zeigt, dass die Verlustaversion, der Status-Quo-Effekt, die Disappointment- und Regret-Theorie sowie der Darstellungseffekt einen signifikanten Einfluss auf das Beschwerdeverhalten von Kunden haben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Verhaltensökonomie, die Theorie der begrenzten Rationalität, die Prospect-Theorie, das Beschwerdeverhalten, das Beschwerdemanagement, die Verlustaversion, den Darstellungseffekt, den Besitzeffekt, das Herdenverhalten, die Disappointment- und Regret-Theorie sowie die Auswirkungen dieser Verhaltensanomalien auf das Beschwerdeverhalten von Kunden.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst die "Prospect-Theorie" das Beschwerdeverhalten?
Die Prospect-Theorie zeigt, dass Menschen Verluste stärker gewichten als Gewinne. Dies führt dazu, dass Kunden bei Unzufriedenheit oft emotionaler reagieren oder den Aufwand einer Beschwerde scheuen, wenn der Erfolg unsicher scheint.
Was versteht man unter dem "Framing Effect" im Beschwerdemanagement?
Der Framing Effect besagt, dass die Art der Darstellung eines Problems die Entscheidung beeinflusst. Wie ein Unternehmen auf eine Beschwerde reagiert (positiv vs. defensiv gerahmt), bestimmt maßgeblich die spätere Kundenzufriedenheit.
Warum handeln Kunden laut Verhaltensökonomie oft nicht rational?
Kunden unterliegen der "begrenzten Rationalität". Sie verfügen weder über alle Informationen noch über die kognitiven Kapazitäten, um in jeder Situation eine rein nutzenmaximierende Entscheidung zu treffen.
Welche Rolle spielt die "Regret-Theorie" bei Kundenbeschwerden?
Kunden antizipieren oft das Bedauern über eine Fehlentscheidung. Wenn sie befürchten, dass eine Beschwerde nichts bringt oder die Situation verschlimmert, verzichten sie aus Angst vor diesem negativen Gefühl auf Feedback.
Was sind wichtige Kriterien für eine erfolgreiche Beschwerdebearbeitung?
Dazu gehören Erreichbarkeit, Freundlichkeit der Mitarbeiter, eine ehrliche Entschuldigung, kurze Bearbeitungszeiten und ein transparentes Feedback an den Kunden.
- Citation du texte
- Boris Lang (Auteur), 2010, Analyse des Beschwerdeverhaltens im Kontext ausgewählter verhaltensökonomischer Ansätze, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178776