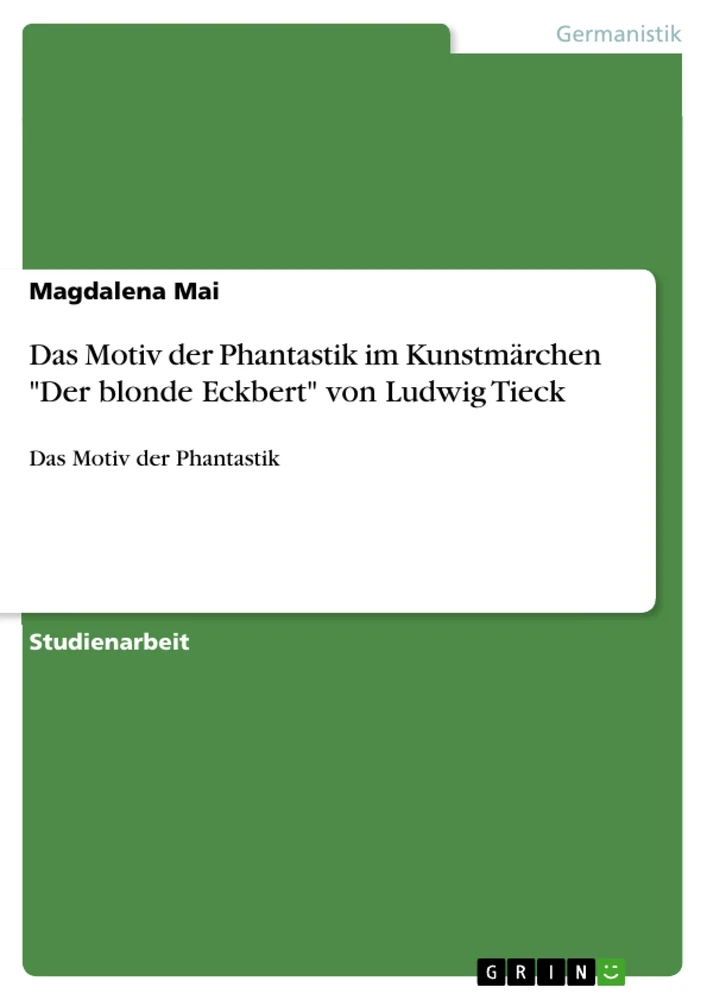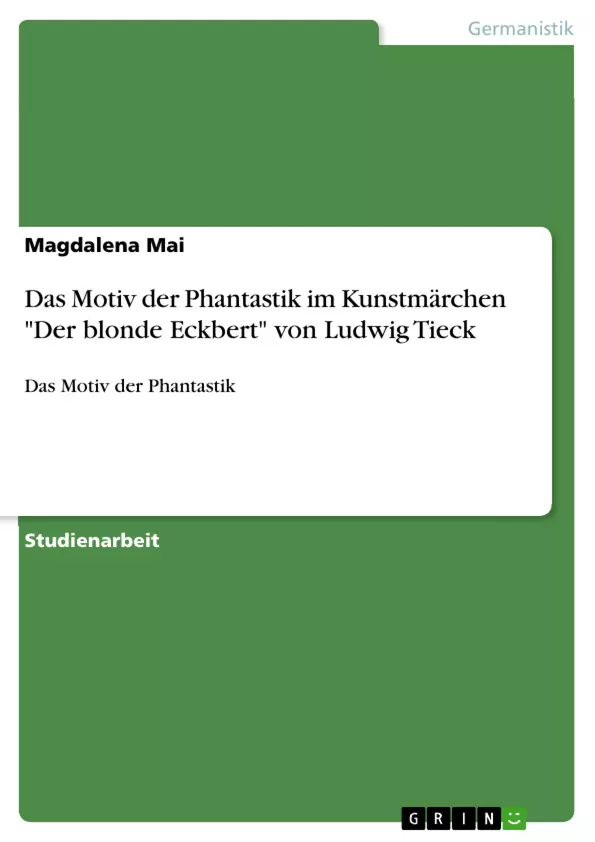Das im Jahr 1796 entstandene Kunstmärchen Der blonde Eckbert von Ludwig Tieck hat von allen Phantasus-Märchen den größten Rezeptionserfolg und bringt nach wie vor eine Vielzahl an Deutungsversuchen hervor. Demnach übt dieses Kunstmärchen noch immer eine Faszination aus, die bis heute anhält. Der blonde Eckbert hebt sich deutlich von den Volksmärchen ab, in denen es vordergründig um einen Helden geht, der sich aus einer Gefahrenlage befreit und am Ende mit Glück und Reichtum belohnt wird. In diesem Kunstmärchen hingegen dominieren Gewalt, Wahnsinn und Tod. Ein glückliches Ende gibt es nicht. Der Titelheld Eckbert wird am Ende wahnsinnig und muss einsehen, dass er sein Leben in völliger Einsamkeit verbracht hat. Seine Gattin Bertha stellt sich als Halbschwester heraus. Welche Figuren sind am Schicksal Eckberts und Berthas beteiligt und wie wirken diese aufeinander? Im ersten Schritt möchte ich auf das Motiv der Phantastik eingehen, das das Ausgangsmotiv für diese Analyse darstellt. Daraus ergibt sich das Kernthema, nämlich die Vermischung von Traum und Wirklichkeit. Zentral und auffällig ist in diesem Zusammenhang die Verwirrung der Figurenidentitäten, auf die ich im Hauptteil konkret eingehe. Die Konstellationen Eckbert – Bertha, Alte – Walther – Hugo und Alte – Vogel – Hund werde ich ausführlich darstellen. Darüber hinaus möchte ich auf die Inzest-Konstellation von Eckbert und Bertha eingehen. Durch die Heirat der beiden macht sich Eckbert unwissentlich schuldig und büßt dafür am Ende mit dem Tod. Der Inzest kann somit als Ursache für den Untergang bezeichnet werden. Kann demnach Bertha als Auslöser für die Katastrophe betrachtet werden? Darauf bezogen möchte ich die Figurenkonstellationen der Alten näher herausarbeiten. Sie weiß darüber Bescheid, dass Eckbert und Bertha Halbgeschwister sind, behält jedoch dieses Wissen für sich und verhindert die Heirat der beiden nicht. Diese Analyse stellt einen Versuch zur Aufklärung des Wahnsinns und Todes Eckberts – unter genauerer Betrachtung der einzelnen Figuren – dar.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Motiv der Phantastik
- Verwirrung von Figurenidentitäten durch Vermischung von Traum und Wirklichkeit
- Eckbert - Bertha
- Das Inzestmotiv bei Eckbert und Bertha
- Alte Walther - Hugo
- Alte Vogel - Hund
- Verwirrung von Figurenidentitäten durch Vermischung von Traum und Wirklichkeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Analyse befasst sich mit dem Kunstmärchen "Der blonde Eckbert" von Ludwig Tieck und analysiert das Motiv der Phantastik im Kontext der Verwirrung von Figurenidentitäten durch die Vermischung von Traum und Wirklichkeit.
- Die Verwirrung von Figurenidentitäten durch die Vermischung von Traum und Wirklichkeit
- Die Auswirkungen der Phantasiewelt auf die Figuren und ihre Wahrnehmung der Realität
- Die Rolle des Inzestmotivs in der Geschichte und seine Beziehung zur Katastrophe
- Die Frage der Verantwortung der Figuren für die tragischen Ereignisse
- Die Bedeutung von Phantasie und Realität in der Romantik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Kunstmärchen "Der blonde Eckbert" vor und erläutert dessen Rezeptionserfolg und Bedeutung im Vergleich zu Volksmärchen. Sie beleuchtet die dominierenden Motive von Gewalt, Wahnsinn und Tod im Märchen sowie den Fokus auf die Verwirrung von Figurenidentitäten durch die Vermischung von Traum und Wirklichkeit.
Das Motiv der Phantastik
Dieses Kapitel definiert das Motiv der Phantastik im Kontext der Romantik und zeigt dessen Bedeutung für die literarische Gestaltung des Kunstmärchens. Es wird die Irritation und Ambivalenz in "Der blonde Eckbert" hervorgehoben, die sich insbesondere in der Vermischung von Traum und Wirklichkeit zeigt.
Verwirrung von Figurenidentitäten durch Vermischung von Traum und Wirklichkeit
Der Abschnitt befasst sich mit der zentralen Figur Berthas und ihrer Geschichte. Die Analyse beleuchtet die Vermischung von Traum und Wirklichkeit in Berthas Kindheitserzählung, die einen starken Einfluss auf die Rahmenhandlung hat. Es werden die Ambivalenzen zwischen Realität und Phantasie in Berthas Lebensweg hervorgehoben sowie ihre Unfähigkeit, zwischen Traum und Wachzustand zu unterscheiden.
Schlüsselwörter
Phantastik, Kunstmärchen, Traum und Wirklichkeit, Figurenidentität, Vermischung, Inzest, Schuld, Verantwortung, Romantik, Phantasie, Realität, Literatur, Ludwig Tieck, "Der blonde Eckbert"
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet „Der blonde Eckbert“ von einem Volksmärchen?
Im Gegensatz zum Volksmärchen gibt es kein glückliches Ende; stattdessen dominieren Wahnsinn, Inzest und Tod die Handlung.
Welche Rolle spielt die Vermischung von Traum und Wirklichkeit?
Die Figuren verlieren die Fähigkeit, zwischen Einbildung und Realität zu unterscheiden, was zur Verwirrung ihrer Identitäten und letztlich zum Untergang führt.
Warum ist das Inzestmotiv zentral für die Katastrophe?
Eckbert und Bertha stellen sich als Halbgeschwister heraus. Ihre Ehe macht sie unwissentlich schuldig, was als Ursache für Eckberts späteren Wahnsinn gedeutet wird.
Wer ist die „Alte“ in Tiecks Kunstmärchen?
Die Alte ist eine rätselhafte Figur, die über das Geheimnis der Herkunft von Eckbert und Bertha Bescheid weiß und deren Schicksal maßgeblich beeinflusst.
Was symbolisiert die Phantastik in der Romantik?
Sie dient als Mittel, um die Abgründe der menschlichen Seele und die Irritation durch das Unheimliche darzustellen, das in den Alltag einbricht.
- Arbeit zitieren
- Magdalena Mai (Autor:in), 2011, Das Motiv der Phantastik im Kunstmärchen "Der blonde Eckbert" von Ludwig Tieck, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178815